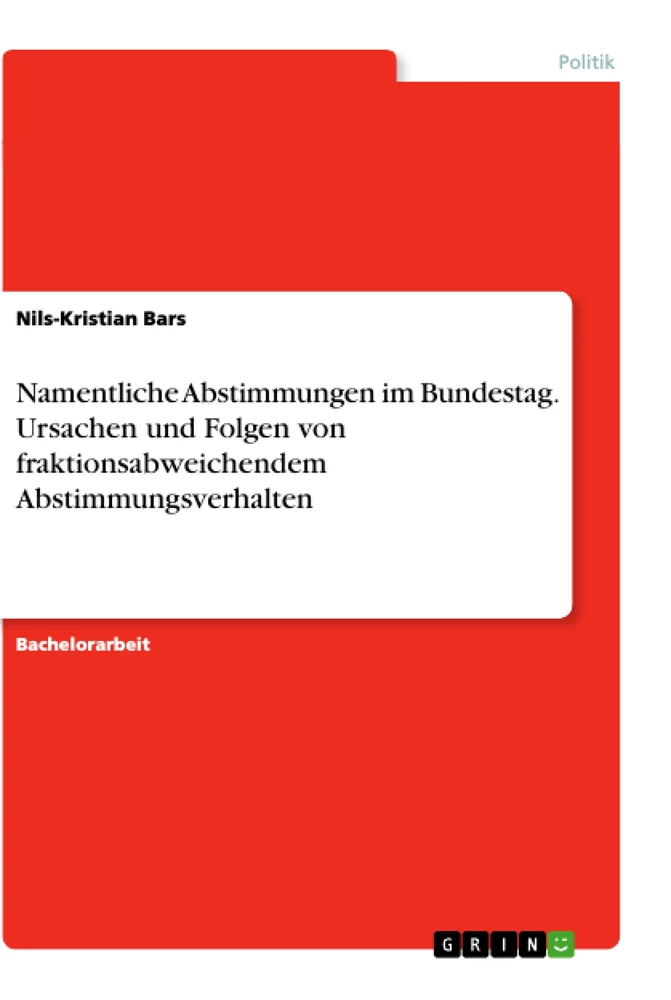
Namentliche Abstimmungen im Bundestag. Ursachen und Folgen von fraktionsabweichendem Abstimmungsverhalten
Bachelorarbeit, 2019
40 Seiten, Note: 1,85
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
2. Fraktionsdisziplin und Fraktionsgeschlossenheit
2.1. Definition
2.2 Fraktionsgeschlossenheit
2.3 Das freie Gewissen der Bundestagsabgeordneten vs die Fraktion
3. Direktmandat im Bundestag
4. Theoretischer Rahmen
4.1 Rational Choice Theory
4.2 Theorie der konkurrierenden Prinzipale
4.3 Institutionelle Bedingungsfaktoren der Fraktionsgeschlossenheit
4.4 Individualisierte Repräsentation und Fraktionsgeschlossenheit
5. Operationalisierung und Methode
5.1 Daten
5.2 Messung der abhängigen und unabhängigen Variablen
6.Empirische Analyse
6.1 Deskriptive Befunde
6.2 Multivariate Analyse
7. Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildung 1: Faktoren innerfraktioneller Geschlossenheit
Abbildung 2: Streudiagramm Abweichungsquote bei namentlichen Abstimmungen
Tabelle 1
Tabelle 2
Tabelle 3
Appendix Tabelle 1
Appendix Tabelle 2
Nur ihrem Gewissen unterworfen? Ursachen und Folgen von fraktionsabweichendem Abstimmungsverhalten im Bundestag
Nils-Kristian Bars
Zusammenfassung: Als Mitglieder einer Fraktion und gleichzeitig mit der Aufgabe des Vertretens ihres eigenen Wahlkreiseses beauftragt stehen direktgewählte Abgeordnete im Bundestag in einem Spannungsverhältnis aus Fraktionstreue und Wahlkreisrepräsentanz. In der Wissenschaft wird davon ausgegangen, dass Direktmandatare eher von der eigenen Fraktionslinie abweichend abstimmen als Listenabgeordnete, da sie durch ihren individuellen Wahlerfolg unabhängiger von der Fraktion sind. Die vorliegende Arbeit argumentiert weiterhin, dass direktgewählte Abgeordnete dann von der Fraktionslinie abweichen, wenn sie sich daraus einen elektoralen Vorteil innerhalb ihres Wahlkreises versprechen. Eine Analyse des namentlichen Abstimmungsverhalten erneut kandierender Direktmandatare während der 17. Legislaturperiode des deutschen Bundestags zeigt hingegen, dass von der Fraktionsmehrheit abweichendes Abstimmungsverhalten und Stimmenzugewinn oder Stimmenverlust nicht signifikant miteinander korrelieren.
Schlüsselwörter: Namentliche Abstimmungen, Fraktionsgeschlossenheit, Direktkandidat, Deutscher Bundestag
1.Einleitung
„Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages [sind] an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“ (GG, Art. 38., Abs. 1)
Namentliche Abstimmungen im deutschen Bundestag sind das für den Wähler wahrscheinlich zielsicherste Instrument, um die politische Arbeit der Bundestagsabgeordneten1 nachzuvollziehen und überprüfen zu können. Sie bieten dem Wähler den direktesten Blick auf das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten und zeigen die simpelste Kausalkette in dem Entscheidungsprozess der parlamentarischen Legislative auf. Das Prinzip ist so logisch wie einfach, durch die namentliche Abstimmung ist für den Wähler direkt ersichtlich, wie sich ein beliebiger Abgeordneter bei einer Abstimmung verhalten hat. Damit unterscheidet sich die namentliche Abstimmung von der im Deutschen Bundestag üblicheren Variante der halb-offenen Abstimmung (Handzeichen) sowie der geheimen Abstimmung. Beide Varianten machen es für Akteure außerhalb des Parlaments quasi unmöglich individuelles Abstimmungsverhalten einheitlich und frei von etwaigen Wahrnehmungsfehlern nachzuvollziehen (Stecker 2011, S.309).
Je nach gesellschaftspolitischer Relevanz wird namentlichen Abstimmungen2 in der Medienlandschaft variierendes Interesse entgegengebracht (Kauder/Potrafke 2017, S.26.; Imerfall1993; von Beyme 1997). Beispielhaft wäre hier die namentliche Abstimmung 2017 über die sogenannte „Ehe für alle“ zu nennen. Das mediale Interesse war deutlich höher als bei gewöhnlichen Abstimmungen, neben diversen Berichten und Schlagzeilen stellte unter anderem die Berliner Zeitung ihren Lesern die individuellen Abstimmungsergebnisse online zur Verfügung3. Eine an sich überflüssige Dienstleistung, alle Zahlen jeder namentlichen Abstimmung werden über die Onlinepräsenz des Deutschen Bundestages veröffentlich und sind somit für jeden Wahlberechtigten offen zugänglich.4 Unabhängig von dem großen medialen Interesse an der Abstimmung selbst oder auch dem Ergebnis der Abstimmung lässt sich eine weitere Besonderheit dieses parlamentarischen Votums hervorheben: Bei der Abstimmung über die „Ehe für alle“ entfiel in allen Parteien ausdrücklich die Fraktionsdisziplin. Damit handelt es sich um eine Seltenheit im Vergleich zu anderen namentlichen Abstimmungen, in welchen im Normalfall die Fraktionen ihren Abgeordneten eine eindeutige Abstimmungsrichtung vorgeben. Denn trotz der im Grundgesetz verankerten Freiheit von Weisung diktieren Fraktionen ihren Abgeordneten, im Normalfall, eine Abstimmungslinie. Anders wären beschluss- sowie handlungsfähige Regierungskoalitionen wohl kaum möglich.
Im Folgenden wird sich diese Arbeit mit beiden Formen namentlicher Abstimmungen befassen, diese aber nicht voneinander unterscheiden und den Sammelbegriff „namentliche Abstimmungen“ verwenden, unabhängig davon ob diese mit direkten Vorgaben der Fraktionsführungen begleitet werden oder nicht. Es wird untersucht, ob sich das individuelle Abstimmungsverhalten direktgewählter Bundestagsabgeordneter auf das Wahlverhalten der Bürger bei Bundestagswahlen auswirkt und inwiefern namentliche Abstimmungen als taktisches Instrument von den Fraktionen und vor allem von den einzelnen Abgeordneten genutzt wird.
Es ist für diese Arbeit irrelevant, ob es eine klare Vorgabe bei namentlichen Abstimmungen der jeweiligen Fraktion gab oder nicht. Hierbei wird davon ausgegangen, dass selbst wenn es keine deutliche Vorgabe bezüglich des Abstimmungsverhaltens für Fraktionsmitglieder gab, zumindest einen Parteikonsens existiert, für den der größte Teil der jeweiligen Fraktion gestimmt hat. Auch in diesem Fall wird in dieser Arbeit von Abweichung gesprochen.
Wird abweichendes Abstimmungsverhalten in den meisten Fällen nicht von der Partei direkt sanktioniert, so besteht doch die Möglichkeit, dass Wähler das jeweilige Wahlverhalten sanktionieren oder belohnen. So zeigt zum Beispiel eine kürzlich erschienene Studie des ifo-Instituts, dass das Abstimmungsverhalten direktgewählter Unionsabgeordneter bei der bereits angesprochenen Abstimmung über die „Ehe für Alle“ in den Zusammenhang mit der jeweiligen Situation in ihrem Wahlkreis und der damit einhergehenden Chance auf Wieder- oder Abwahl gesetzt werden kann (vgl. Kauder und Potrafke 2018).
Nachdem Michigan-Modell, zurückzuführen auf Arbeiten von Wissenschaftlern der in Ann Arbor ansässigen Universität Michigan, lässt sich die Wahlentscheidung für Partei und/oder Kandidaten auf drei zentrale Bereiche herunterbrechen: Parteibindung/Parteiidentifikation, die Sicht auf politische Sachthemen und die Beurteilung der kandidierenden Person (Campel et al. 1971; Kühnel und Mays 2009, S.313). Das Zusammenspiel von Einhalten der Fraktionsdisziplin und dem daraus resultierenden Erststimmenergebnis berührt jeweils jedes der drei Prädikate des Michigan Modells und könnte somit Erklärungsansätze für weiterführende Wahlforschungen bieten. In der vorliegenden Arbeit wird versucht, auf Basis der Daten zu den Bundestagswahlen 2009 und 2013 sowie Daten über das Abstimmungsverhalten des 17. Deutschen Bundestags, zu klären, ob es einen erkennbaren Zusammenhang zwischen fraktionsbrechendem und/oder fraktionswahrendem Abstimmungsverhalten im Bundestag und der nächstfolgenden Erststimmenwahlentscheidung der Wähler gibt.
2. Fraktionsdisziplin und Fraktionsgeschlossenheit
2.1. Definition
Es gibt keine trennscharfe und allgemeingültige Definition des Begriffes Fraktionsdisziplin. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass es sich hierbei um kein institutionell festgeschriebenes Instrument handelt, sondern um ein Phänomen, welches unter Einfluss der Rahmenbedingungen der repräsentativen Parlamentsdemokratie entstanden ist. Der von Leibholz in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägte Begriff des „Parteienstaates“ (Leibholz 1966) kann als rudimentäre Basis eines Erklärungsansatzes verstanden werden. Nach Leibholz sind es in der modernen Demokratie die politischen Parteien, die den Gemeinwillen in der parlamentarischen Demokratie bilden (Isensee 2007, S.255). Der Abgeordnete agiert als Funktionär der Partei, die ihn aufgestellt hat und die auch die Macht hat, ihn seines Amtes wieder zu entheben. Sie diktiert dem Abgeordneten sein parlamentarisches Verhalten und leitet damit auch seine Abstimmungsentscheidungen. Der Abgeordnete selbst ist nicht viel mehr als ein Werkzeug, welches bei Abstimmungen den Willen der Partei wiedergibt. Aufbauend auf Leibholz kann man das Abstimmungsverhalten eines Abgeordneten nicht als individuell unabhängige Handlung, sondern viel mehr als Handlung unter dem klaren Einfluss seiner Partei verstehen. Der Abgeordnete stimmt so ab, wie es die Partei diktiert. Er ordnet seine persönliche Entscheidung dem Wohlwollen der Partei/der Bundestagsfraktion unter. Die Folge ist ein geschlossenes Abstimmungsverhalten der verschiedenen Bundestagsfraktionen.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird, darauf basierend, Fraktionsdisziplin als geschlossenes Abstimmen der Abgeordneten einer Fraktion bei einer Abstimmung im Bundestag verstanden, insofern die Abstimmung mit Vorgaben der Fraktionsführung erfolgt ist. Damit wird davon ausgegangen, dass abweichendes Stimmverhalten von der Mehrheit der eigenen Fraktion als Bruch der Fraktionsdisziplin zu verstehen ist.
Fraktionsdisziplin lässt sich von der Fraktionsgeschlossenheit insofern unterscheiden, dass der Begriff der Disziplin zwangsläufig innerparteiliche Vorgaben voraussetzt, die die Fraktionsgeschlossenheit sichern sollen. Die Begriffe sind also nicht unisono zu verstehen, vielmehr ist die Fraktionsdisziplin eine Art Werkzeug der Parteien zum Erreichen der Fraktionsgeschlossenheit, welche nur aussagt, dass eine Fraktion geschlossen abstimmt, nicht aber wie das Abstimmungsergebnis erlangt wurde/zu erklären ist (Sieberer 2006, S.151). Irrelevant für die Fraktionsgeschlossenheit ist, ob die jeweilige Abstimmung durch besondere innerparteiliche Vorgaben begleitet wurde oder eben nicht. Wichtig ist, dass mögliche Beweggründe für Fraktionsgeschlossenheit einhaltendes oder brechendes Wahlverhalten nicht relevant für die Definition des Begriffes selbst sind.
Zusammenfassend wird in dieser Arbeit fraktions(geschlossenheit)brechendes Abstimmungsverhalten wie folgt definiert:
Stimmt die Mehrheit der Abgeordneten einer Fraktion, die an einer Abstimmung teilnahmen, für “Ja”, “Nein” oder “Enthaltung”, so wird dies als die Fraktionslinie gewertet. Andere Abstimmungsarten werden dementsprechend als Abweichung und damit fraktionsbrechend gewertet.
2.2 Fraktionsgeschlossenheit
Delius et al. (2013, S.546-548) unterscheiden zwischen drei verschiedenen Beweggründen für geschlossene Abstimmungsergebnisse einzelner Fraktionen: Parteiloyalität, Kohäsion und Disziplin. Während Kohäsion eher als eine logische Konsequenz verstanden werden kann, da Abgeordnete derselben Partei von Natur aus ähnliche Überzeugungen und Werte vertreten, sind doch besonders die Parteiloyalität und die damit verknüpfte Disziplin von besonderem Interesse. Beide Mechanismen setzen einen Konflikt zwischen Fraktion und Abgeordneten voraus, also eine abweichende persönliche Meinung von der Fraktion/dem Gros der weiteren Abgeordneten der eigenen Fraktion. Trotz einer divergenten Meinung fügt der Abgeordnete sich der Mehrheit und stimmt entsprechend dem Fraktionswillen ab. Parteiloyalität, also das freiwillige Befolgen der Fraktionslinie, unter der Prämisse dass ein Dissens allgemein rein moralisch abzulehnen ist (Könen 2009, S.29-30) und die Disziplin, das Anschließen an die Fraktion aufgrund von möglichen direkten sowie indirekten Anreizen und Sanktionen von Fraktionsseite aus gegenüber dem Abgeordneten (Delius et al. 2013 S.548) lassen sich nur schwer empirisch messen. Daher lässt sich nicht genau sagen welcher der beiden Mechanismen in welcher Form entscheidender und schwerer zu gewichten ist. Es ist aber davon auszugehen, dass beide, verschieden gewichtet, eine Relevanz besitzen, wenn Fraktionen geschlossen abstimmen.
2.3 Das freie Gewissen der Bundestagsabgeordneten vs die Fraktion
Wie eingangs zitiert sind die Bundestagsabgeordneten, nach dem Grundgesetz nur ihrem eigenen Gewissen unterworfen und sollen explizit ungebunden von Weisungen und Aufträgen agieren. Es handelt sich hierbei um eine klare rechtliche Vorgabe, die nur das Mandat eines Abgeordneten schützt, nicht aber seine Partei- oder Fraktionszugehörigkeit. Demnach ist der Ausschluss aus dem Bundestag aufgrund des Abstimmungsverhaltens eines Abgeordneten rechtlich nicht möglich, der Ausschluss aus der jeweiligen Partei oder Fraktion schon.
Neben diesen beiden Ultima Ratio besitzen Fraktionen weitere Instrumente, um das Abstimmungsverhalten ihrer Abgeordneten zu beeinflussen: Hierbei kann es zu klaren, internen Ankündigungen über die Folgen eines abweichenden Abstimmungsverhaltens kommen, die dann, zum Beispiel, beinhalten, dass ein unsolidarischer Abgeordneter nicht erwarten könnte für einen Ausschussvorsitz/bestimme Funktion nominiert zu werden, dies betrifft weitere Rollen und Positionen die von der Fraktion/Partei selbst besetzt werden. Durch Positionsvergabe, frei nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, kann das Abstimmungsverhalten belohnt oder sanktioniert werden (Schuett-Wetschky 1984, S.174 ff.).
Neben den kausal fassbaren Sanktionen sowie Belohnungen, die aus dissentierendem Abstimmungsverhalten folgen können, besteht auch die Möglichkeit, dass Fraktionen Dissenter weicher sanktionieren, auf einer wenig messbaren Ebene. So werden Abweichler innerhalb der Fraktion eher gemieden und sozial isoliert (Delius et al. 2013, S.548). Hierbei kann es sich um eine gezielte Strafe mit vorheriger Absprache innerhalb der Fraktionen handeln. Es wäre aber auch nur logisch, dass es sich vielmehr um eine simple, jeweils individuelle, Reaktion der einzelnen Fraktionsmitglieder auf fehlende Solidarität der Abgeordneten, die sich nicht an die Fraktionsdisziplin gehalten haben, handelt.
3. Direktmandat im Bundestag
Es ist hinlänglich bekannt, dass sich die Mitglieder des Deutschen Bundestages aus zwei Kategorien zusammensetzen, den Listen- sowie den Wahlkreisabgeordneten. Je nach Art ihres Mandats lässt sich den Abgeordneten, rein logischerweise, eine gewisse Nähe und Abstimmungsverantwortung gegenüber Partei und damit Fraktion (Listenmandat) oder Wahlkreis/Wählern (Direktmandat) zuordnen.
“List PR, for example, creates an incentive for legislators to over-respond to party leaders (who determine list position) and to ignore the needs of individual voters. By contrast, plurality creates an incentive for legislators to over-respond to individual constituents, and to try to get direct credit for solving problems rather than working to prevent their occurrence.” (Bawn 1999, S.490)
Hierbei muss angemerkt werden, dass diese Logik in der Realität nicht so trennscharf und allgemeingültig angewendet werden kann. Dies ist schon allein dadurch bedingt, dass über 80 Prozent der Abgeordneten im Bundestag (in der für diese Arbeit relevanten 17. Legislaturperiode) sowohl auf einer Landesliste sowie auch für einen Wahlkreis kandidierten (Manow 2012, S.53). Dies führt unter anderem dazu, dass auch Listenmandatare eine lockerere oder engere Wahlkreisbindung zur Folge haben können, da sie „[…] als Listenabgeordnete einen Wahlkreis für ihre Partei als MdB mitbetreuen sollen“ (Schweitzer 1979, S.12).
Listenabgeordnete haben (trotz möglicher Wahlkreisbindung) dennoch ihre Nominierung auf der Landesliste ihrem Landesverband und die daraus resultierende Mitgliedschaft im Bundestag dem Zweitstimmen-Ergebnis ihrer Bundespartei (man denke nur an die bundesweite „Zweitstimme ist die Merkel-Stimme“ Kampagne der CDU 20135 ) zu verdanken. Hingegen werden Wahlkreisabgeordnete in den deutlich kleineren Kreisverbänden nominiert und in ihrem jeweiligen Wahlkreis direkt gewählt.
Daraus resultierend können Wahlkreisabgeordnete im Bundestag in einem Spannungsfeld zwischen Wahlkreis/Wähler und der eigenen Fraktion stehen. Sind sie doch auf der einen Seite Teil ihrer Fraktion (und ihr Bundestagsmandat lässt sich auch auf ihre Parteimitgliedschaft zurückführen) und auf der anderen Seite direktgewählte Repräsentanten ihres Wahlkreises. Ihre Mitgliedschaft im Bundestag ist auf ihren Wahlsieg in ihrem Wahlkreis direkt zurückzuführen. Die duale Rolle als Fraktionsmitglied und Wahlkreisrepräsentant kann logischerweise zu Interessenkonflikten führen, man stelle sich einen fiktionalen Abgeordneten aus einem Wahlkreis, dessen Wirtschaft primär auf den Tourismussektor ausgelegt ist, vor, dessen Fraktion einen Gesetzesentwurf zur Erhöhung der Hotel-Steuer einbringt.
4. Theoretischer Rahmen
4.1 Rational Choice Theory
Nach der neoinstitutionalistischen Theorie der rationalen Entscheidung versuchen „[…] Akteure in Entscheidungssituationen unter Restriktionen [versuchen], ihre Präferenzen möglichst gut zu realisieren.“ (Diekmann & Voss 2004, S.15). Handeln und Entscheidungen entstehen also bewusst und geplant mit dem Ziel des eigenen und individuellen Nutzenzuwachses.
Nach dem Rational Choice Modell lassen sich Entscheidungen eines Bundestagsabgeordneten auf zwei Determinanten, eine davon mit zwei Variablen, die andere mit drei Variablen, zurückführen. Die Entscheidungen (im Rahmen der Ausübung des Bundestagsmandates) sind abhängig von den persönlichen Präferenzen des Abgeordneten, den institutionellen Rahmenbedingungen des Bundestages sowie den Eigenschaften des Parteiensystems. Die individuellen Präferenzen werden unterschieden zwischen sachbezogenen Präferenzen (ideologischer Natur) und karrierebezogenen Präferenzen (Wiederwahl- sowie Aufstiegschancen). Die institutionellen Rahmenbedingungen lassen sich aufteilen in staatliche Normen (die gesetzlich-rechtlichen Grundvoraussetzungen des Parlaments), die parteispezifischen Normen (parteiinterne Abläufe und Regeln) sowie die Eigenschaften des Parteiensystems (Anzahl der Parteien im Parlament, Stärke der eigenen Partei, Regierungsverantwortung) (Saalfeld 2005, S.39).
Wie in Abbildung 1 verdeutlicht, fällt der Abgeordnete unter Einfluss dieser Determinanten eine Entscheidung in einer Handlungssituation. Aus der Summe der Entscheidungen jedes einzelnen Abgeordneten einer Fraktion und den damit einhergehenden Handlungen (im Falle dieser Arbeit Abstimmungsverhalten bei namentlichen Abstimmungen) entsteht die interfraktionelle Geschlossenheit (Saalfeld 2005, S.39; Bergmann et al. S.127)
Abbildung 1: Faktoren innerfraktioneller Geschlossenheit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach: Saalfeld 2005, S.39
In der vorgelegten Arbeit wird das Abstimmungsverhalten von direktgewählten Abgeordneten bei namentlichen Abstimmungen betrachtet. Die Anwendung der Theorie der rationalen Entscheidung auf das Abstimmungsverhalten eines Bundestagsabgeordneten bedeutet, dass davon auszugehen ist, dass ein Abgeordneter in der Form abstimmt, von der er sich den größten individuellen Nutzen verspricht. Hinter der Entscheidung für die drei Möglichkeiten „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ verbirgt sich dementsprechend das Kosten-Nutzen-Kalkül. In dieser Arbeit wird daher davon aus gegangen, dass der Abgeordnete vor der Teilnahme an der Abstimmung abwiegt, welche der drei Optionen, den für ihn größten erwartbaren Nutzen (im Vergleich zu den damit einhergehenden Kosten) hätte und dementsprechend abstimmt.
Den größten Nutzen ziehen Abgeordnete aus dem Durchsetzen von Politikinhalten (sachbezogene Präferenzen) und der Maximierung an Wählerstimmen, welche ihnen ihre Position als Abgeordneter sichern (karrierebezogene Präferenzen). Dementsprechend sollten sich Abgeordnete so verhalten, dass die Chancen auf ihre Wiederwahl größtmöglich sind. Eine Wiederwahl sichert nicht nur automatisch die Position als Abgeordneter, sondern ermöglicht auch weiteres Implementieren sowie Durchsetzen politischer Inhalte und Agenden. Es wird daher angenommen, dass das erste Ziel des Handelns eines Abgeordneten die Wiedernomination sowie die Wiederwahl ist (“Müller, & Strøm 2003, S.283 ff.).
Dieses Verständnis des rationalen und nutzenmaximierenden Handelns von Abgeordneten im Rahmen politischer Prozesse, bildet den Ausgangspunkt für weitere theoretische Ausführungen der vorgelegten Arbeit.
4.2 Theorie der konkurrierenden Prinzipale
Das von Carey aufgestellte Modell der konkurrierenden Prinzipale ist zurückzuführen auf das Prinzipal-Agent-Modell aus der neuen Institutionenökonomik der Wirtschaftswissenschaften. Das klassische Modell stellt primär ein Informationsproblem zwischen zwei Akteuren, nämlich Auftragsgeber (Prinzipal) und Auftragsnehmer (Agent) dar (Gilardi und Braun 2002, S.147 ff.). Die Dimension einer Informationsungleichheit gewichtet Carey nicht, dafür erweitert er die Akteurs-Ebene des Prinzipals um einen weiteren Akteur/weitere Akteure. Der Agent erhält nun von zwei (oder mehreren) Prinzipalen Aufträge, die er ausführen soll/auszuführen hat (Carey 2007). Wichtig ist diese Unterscheidung der Prinzipale aber erst dann, wenn ihre Aufträge konvergent zu einander verlaufen, sich also gegenüberstehen und den Agenten vor die Wahl stellen, einen der beiden Aufträge zu folgen und damit gleichzeitig den anderen Auftrag nicht ausführen zu können. Diese Theorie stellt Carey im Kontext eines Parlamentes, in dem ein Abgeordneter zwei oder mehrere Auftraggeber hat.
„[…] figurierenden Akteure finden sich beispielsweise in machtvollen Interessenverbänden oder in (lokalen) Wählergruppen. Sie besitzen ihrerseits Ressourcen wie Wahlkampfmittel oder schlicht Stimmengewicht, mit denen sie um die Loyalität eines Abgeordneten werben können. Kommt es zum Konflikt zwischen den Präferenzen der Fraktionsführung und denen eines competing principals, muss ein Abgeordneter genau abwägen, welchen Prinzipal er zufrieden stellt. Hängt davon sein Mandat ab, wird er auch bereit sein, sich gegen die eigene Fraktion zu stellen.“ (Stecker 2011, S.428)
Demnach lässt sich fraktionsabweichendes Abstimmungsverhalten dadurch erklären, dass neben der Fraktion noch weitere Prinzipale Einfluss auf den abweichenden Abgeordneten haben und der Abgeordnete den Einfluss auf seinen persönlichen Nutzen durch den zur Fraktion konkurrierenden Prinzipals, als stärker einschätzt.
In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass besonders Direktmandatare in einem Spannungsfeld aus Partei/Fraktion und Wahlkreis stehen. Wie bereits erwähnt, ist ihr Bundestagsmandat nicht alleinig ihrer Parteizugehörigkeit und dem Erfolg der Partei zuzuschreiben, sondern auch ihrem Erfolg in ihrem Wahlkreis. Es ist hierbei der Vollständigkeit halber anzumerken, dass in bestimmten Wahlkreisen bereits die Kandidatur für eine bestimmte Partei eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Gewinns des Direktmandates bedeutet. Oft wird hierbei von „sicheren“ Wahlkreisen oder „Hochburgen“ gesprochen6, also von Wahlkreisen innerhalb derer die Parteiidentifikation und Parteibindung der Wählerschaft für eine Partei so hoch ist, dass alleinig die Kandidatur als Vertreter der im Wahlkreis präferierten Partei als ein elementarer Vorteil im Kampf um Wählerstimmen (und damit Erreichen des Direktmandates) verstanden werden kann (Neunhoeffer et al 2018, S.3). Dennoch lassen sich unter anderem im Rahmen des Bundestags Wahlkampfes zur Wahl 2005 eine signifikant hohe Zahl an kandidatenzentrierten Kampagnen um die Direktmandatare nachweisen (Zittel & Gschwend 2007) sowie bei der Bundestagswahl 2009 ein Anstieg der Bekanntheit eines direktkandidierenden Kandidaten innerhalb seines Wahlkreises mit zunehmender Personalisierung seiner Wahlkampagne (Zittel & Gschwend 2011, S.384). Des Weiteren werden Wahlkreiskandidaten von Parteimitgliedern des Wahlkreises nominiert, ein Umstand, der zum einen die Wahlkreisnähe des Abgeordneten begünstigen sollte und zum anderen klar Einflussnahme der Bundestagsfraktion verhindert, vielmehr lässt sich dadurch eher ein gewisser Anreiz zum Fraktionsbruch vermuten, denn „[…] vielmehr scheint es Abgeordnete „zuhause“ an der Parteibasis häufig geradezu zur Ehre zu gereichen, wider den Stachel „der da oben“ zu löcken.“ (Schüttemeyer & Sturm 2005, S.546). Es kann dadurch von einer individuelleren, kandidatenzentrierteren Position der Direktmandatare ausgegangen werden kann, welche zwar als Parteivertreter kandidieren, ultimativ, aber individuell gewählt werden.
4.3 Institutionelle Bedingungsfaktoren der Fraktionsgeschlossenheit
Für eine Konkurrenzsituation der Prinzipale müssen beide Prinzipale über Instrumente verfügen, die den individuellen Nutzen des Abgeordneten beeinflussen. Wie bereits erläutert, wird sich der Abgeordnete nach Wirkungskraft und zu erwartenden Folgen der jeweiligen Instrumente, dafür entscheiden, den Auftrag des Prinzipals auszuführen, der ihm den größten Nutzen verspricht. Besitzt nun aber einer der Prinzipale alleinig die vollumfängliche Kontrolle über Belohnungs- sowie Sanktionsinstrumente, so kann keine Konkurrenzsituation entstehen, da die individuelle Entscheidung eines jedes Abgeordneten standardisiert dem allmächtigen Prinzipal folgen wird. So ist es nur schwer vorstellbar, dass es innerhalb einer Fraktion zu abweichenden Abstimmungen kommt, wenn die Fraktionsführer die Kandidatennominierung bestimmen oder zumindest entscheidend beeinflussen. In diesem Fall wäre die Fraktionsführung nicht nur in der Lage, eine Vorauswahl an fraktionstreuen Kandidaten aufzustellen, sondern würde auch die Möglichkeit besitzen fraktionsabweichendes Wahlverhalten ultimativ, mit dem Versagen einer erneuten Wiederkandidatur zu sanktionieren (Stecker 2011, S.428).
Neben dem direkten Einfluss der Fraktion/Parteiführung auf die Kandidatennominierung gilt die Art des Wahlsystems als bestimmender Faktor für die innerfraktionelle Geschlossenheit bei (namentlichen) Abstimmungen. Hierbei wird zwischen den zwei Idealtypen der parteizentrierten und kandidatenzentrierten Wahlsystemen unterschieden. Wissenschaftlicher Konsens ist es, dass je kandidatenzentrierter ein Wahlsystem ist desto höher die Abweichungsbereitschaft der Abgeordneten, dementsprechend umso geringer ist die Fraktionsgeschlossenheit in den Fraktionen der Parlamente (Carey 2007; Sieberer 2006; Sieberer 2010; Stecker 2011).
Überträgt man diese theoretischen Überlegungen auf das Gemischtwahlsystem der Bundesrepublik Deutschland und betrachtet das Direktmandat gegenüber dem Listenmandat, so ergibt sich hieraus folgend, dass die über einen kandidatenzentrierteren Modus gewählten Direktmandatare eher eine Tendenz zum Dissens aufweisen sollten als die aus dem parteizentierteren Modus gewählten Inhaber der Listenmandate. Empirische Studien über das Abstimmungsverhalten im deutschen Bundestag bei namentlichen Abstimmungen stützen diese theoretische Überlegung. Stratmann (2006) für den Zeitraum 1990-1994 (12. Legislaturperiode), sowie Sieberer (2010) und Neuhäuser et al. (2013) für den Zeitraum 2005-2009 (16. Legislaturperiode) weisen nach, dass direktgewählte Abgeordnete bei namentlichen Abstimmungen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von der Fraktionsgeschlossenheit abweichen als Abgeordnete, die über die Liste in den Bundestag eingezogen sind . Auch Delius et al. (2013) stellen für die 16. Legislaturperiode fest, „[…] dass direkt gewählte Abgeordnete eine stärkere Dissensneigung aufweisen als über die Liste in den Bundestag eingezogene. Im Durchschnitt weichen bei einer Abstimmung zwei Prozent der Listenmandatare, aber drei Prozent der Direktmandatare ab“ (S.560). Anzumerken ist, dass Delius et al. nur das Abstimmungsverhalten der SPD-Abgeordneten und nicht das aller Bundestagsfraktionen untersucht haben.
Insgesamt zeigt sich eine klare Tendenz, dass direktgewählte Abgeordnete im deutschen Bundestag eher dazu neigen gegen die Fraktionsmehrheit abzustimmen. Betrachtet man diese Evidenz im Kontext mit dem Verhaltenstheorem der rationalen Entscheidung und dem Institutionen sowie Präferenzen basierten Modell der konkurrierenden Prinzipale, so ist davon auszugehen, dass es ein Erklärungsansatz für dieses Verhalten darin liegt, dass ein direktgewählter Abgeordneter in gewisser Weise unabhängig von seiner Fraktion agieren kann, da sein Mandat primär an seinen Erfolg in seinem Wahlkreis gekettet ist. Er wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit dann gegen die Fraktionsmehrheit stimmen, wenn die Fraktionsmehrheit konträr zu der Mehrheitsmeinung seines Wahlkreises votiert. Dementsprechend wird erwartet, dass namentlich abweichendes Abstimmungsverhalten im Bundestag dann geschieht, wenn der Abgeordnete einen Vorteil in seinem Handeln sieht, also Zustimmung in seinem Wahlkreis erwartet, welche sich in Wählerstimmen ummünzen lässt. Dementsprechend müssten direktgewählte Abgeordnete mit einer hohen Abweichungsquote innerhalb ihres Wahlkreises mit einem Zuwachs an Stimmen belohnt werden. Auf dieser Basis formuliere ich meine erste Hypothese:
H1: Je höher die Abweichungsquote eines direktgewählten Abgeordneten bei namentlichen Abstimmungen innerhalb einer Legislaturperiode ist, desto höher sein prozentualer Stimmenzuwachs bei der folgenden Bundestagswahl.
Bisher gibt es keine empirische Studie/Arbeit, die sich mit dem Zusammenhang von Abweichungen von der Fraktionsgeschlossenheit und dem Effekt auf den Wähler, beziehungsweise der Reaktion des Wählers, befasst.7 Wie bereits erläutert, wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass direktgewählte Abgeordnete eher zum Dissens neigen, da sie in ihrer Position unabhängiger von der Fraktion sind als Listenabgeordnete. Dieser Erklärungsansatz zeigt institutionelle Gründe für Unterschiede in der Fraktionstreue der zwei Mandatstypen, erklärt aber nicht, worin die Motivation der Direktmandatare liegt, fraktionsabweichend abzustimmen. Careys Ansatz der konkurrierenden Prinzipale, nennt einen konkurrierenden Prinzipalen als Grund für von der Fraktionsmehrheit abweichendes Abstimmungsverhalten. Anhand dieser These soll festgestellt werden, ob die Wahlkreise der Direktmandatare abweichendes Abstimmungsverhalten mit Stimmen belohnen und dementsprechend als relevanter Prinzipal gesehen werden können, dessen Einfluss einen Erklärungsansatz zur Motivation für Dissens bietet.
4.4 Individualisierte Repräsentation und Fraktionsgeschlossenheit
Innerfraktionelle Geschlossenheit im Abstimmungsverhalten sichert nicht nur eine zielführende und umsetzbare Regierungs-/Oppositionsarbeit der Parteien im Bundestag, sie kann auch als wichtiges Repräsentationsgut der einzelnen Parteien angesehen werden. In der Außendarstellung gelten „zerstrittene“ Fraktionen, in denen Mitglieder öffentlich gegeneinander argumentieren (und in Ultima Ratio abstimmen) als schwach, wenig handlungsfähig und dementsprechend als unattraktive Wahloption für Wähler (Dittberner 2003, S.555; Eilfort 2003, S.574 ff.; Könen 2009, S. 106 ff.).
Es kann dementsprechend nicht im Sinne der Fraktionsmitglieder sein, ein Bild des Dissenses innerhalb der Fraktion der Öffentlichkeit zu präsentieren, profitieren sie doch (wie bereits dargestellt, abhängig von ihrem Mandatstyp mehr oder weniger) von der öffentlichen Rezeption der eigenen Partei und haben dementsprechend ein eigenes Interesse daran „[…]eine wählerwirksame Reputation erfolgreicher politischer Führung aufzubauen und zu bewahren“ (Saalfeld 2005, S.40). Dennoch sind (durch namentliche Abstimmungen nachvollziehbare) Abweichungen von der Fraktionsgeschlossenheit im Bundestag eine reale Evidenz.
Namentliche Abstimmungen sind nicht die Regel im deutschen Bundestag. Im Allgemeinen wird per Handzeichen abgestimmt. Bei Zweifel ob des Ergebnisses der Handzeichenabstimmung kommt es zum sogenannten Hammelsprung.8 Diese beiden üblichen Abstimmungsvorgänge unterscheiden sich von der namentlichen Abstimmung darin, dass es nicht möglich ist, ihr Ergebnis kausal auf das Abstimmungsverhalten einzelner Abgeordneter zurückzuführen (Stecker 2011, S.309). Bei Handzeichenvotation sowie Hammelsprung stimmen Abgeordnete (zumindest für die Öffentlichkeit) anonym/halb-offen ab. Anders bei der namentlichen Abstimmung, welche stattfindet, wenn dies von einer Fraktion oder mindestens fünf Prozent der Abgeordneten angemeldet wird. Bei einer namentlichen Abstimmung erhält jeder Abgeordnete drei personalisierte Abstimmungskarten („Ja“, „Nein“, „Enthalte mich“), auf denen sein Name sowie die Fraktion des Abgeordneten abgedruckt sind.9
Da namentliche Abstimmungen im Bundestag nur dann stattfinden, wenn sie angemeldet worden sind, ist davon auszugehen, dass Fraktionen, die selbige anmelden, ein Ziel mit der Durchführung namentlichen Abstimmung verfolgen. Prominent in der Literatur vertreten ist Saalfelds Theorie, wonach namentliche Abstimmungen als eine Art Waffe der Fraktionen und ihrer Fraktionsführer zu verstehen sind. Zum einen werden Fraktionen namentliche Abstimmungen nutzen, um ihre eigenen Abgeordneten zu überprüfen und ihnen die Möglichkeit des anonymen Dissens zu nehmen, den vorhandenen Dissens fehlerfrei zuzuordnen und anschließend sanktionieren zu können. Es ist die Waffe der Fraktionsführung gegen die eigenen Fraktionsmitglieder (im Original „ weapon of the whips“). Zum anderen nutzen Fraktionen namentliche Abstimmungen, um eigene Geschlossenheit zu demonstrieren und andere Fraktionen zu spalten und dem Wähler gegenüber bloßzustellen. So werden namentliche Abstimmungen zur Waffe gegen andere Fraktionen (Saalfeld 1995). In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Theorie der Waffe der Fraktionsführer gegen die eigenen Fraktionsmitglieder als Erklärungsansatz für namentliche Abstimmungen im Bundestag vernachlässigt werden kann. Fraktionen haben kein Interesse an öffentlich nachvollziehbaren Abweichungen innerhalb der eigenen Fraktion. Wie bereits erläutert, ist die Fraktionsgeschlossenheit ein relevantes Repräsentationsgut und es ist anzuzweifeln, ob Fraktionsführer bei Kenntnis über eigenen interfraktionellen Dissens öffentlichen Ansehensverlust riskieren. Also ist nicht davon auszugehen, dass sie eine namentliches Abstimmungsverfahren für eine Abstimmung anmelden, bei der der eigene Mitglieder der Fraktion mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen die Fraktion stimmen werden, wenn den hohen Kosten der öffentlichen negativen Wahrnehmung nur der Nutzen des Wissens über die Namen der Abweichler gegenübersteht. Dies ist besonders in Frage zu stellen, da bei der im Bundestag üblichen Variante des Handzeichens, es durchaus allen Akteuren im Plenum möglich sein sollte, individuelles Abstimmungsverhalten nachzuvollziehen (Stecker 2011 S.309).
Stellt man die Theorie der Waffe der Fraktionsführung gegen die eigenen Fraktionsmitglieder aus dem erläuterten Grund zurück, so rückt die Idee der Waffe gegen andere Fraktionen in den Fokus. Fraktionen melden namentliche Abstimmungen an, mit dem Ziel, die Mitglieder konkurrierender Fraktionen bei Abstimmungen zum Dissens zu bewegen und somit die konkurrierende Fraktion(en) in der Öffentlichkeit als zerstritten und ungeschlossen bloßzustellen (Saalfeld 1995, S.541). Zur Verdeutlichung dieses Vorgangs sei noch einmal auf die theoretische Überlegung der bereits eingangs erwähnten Hotel-Steuer Erhöhung hingewiesen: In dieser fiktionalen Abstimmung vermutet eine Oppositionsfraktion, dass diverse Regierungsabgeordnete, die aufgrund ihrer Wahlkreis Zugehörigkeit (stammend aus Wahlkreisen mit starkem touristischen Sektor) gegen die geplante Steuererhöhung -und damit die gegen die eigene Fraktion- stimmen werden. Um diesen innerfraktionellen Dissens öffentlich aufzuzeigen, meldet die Oppositionsfraktion eine namentliche Abstimmung an. Sie verfolgt damit das Ziel, die Zerrissenheit der konkurrierenden Fraktion öffentlichkeitswirksam zu verdeutlichen.10
Stimmt eine Fraktion bei einer namentlichen Abstimmung hingegen geschlossen ab, so ist davon auszugehen, dass der Reputationsschaden für die gesamte Fraktion abgewendet wurde. Die individuellen Abgeordneten machen sich so aber möglicherweise angreifbar durch gezielte Attacken der politischen Gegner. Delius et al. beschreiben einen realen Sachverhalt aus dem deutschen Bundestag und den jeweiligen Wahlkreisen der Abgeordneten wie folgt:
„Am 28. Mai 2009 stellte die Linksfraktion im Bundestag 17 Anträge zur namentlichen Abstimmung, die verschiedene Verbesserungen für ostdeutsche Rentner verlangten. Mehrere ostdeutsche SPD-Abgeordnete hatten im Vorfeld ähnliche Forderungen vertreten, votierten bei der namentlichen Abstimmung im Bundestag jedoch mehrheitlich gegen die Anträge- innerhalb der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD waren die Wünsche nicht durchsetzbar. Im darauffolgenden Wahlkampf sollte dies einige von ihnen in große Erklärungsnöte bringen: Die Linkspartei hatte – zugeschnitten auf einzelne Bundesländer – Handzettel drucken lassen, auf denen die Diskrepanz zwischen inhaltlicher Überzeugung und Abstimmungsverhalten der SPD-Parlamentarier namentlich festgehalten war.“ (2013, S.546)
Hierbei handelt es sich eindeutig um Negative Campaining mit dem Ziel, Abgeordnete konkurrierender Fraktionen im eigenen Wahlkreis für ihre politische Arbeit im Parlament zu kritisieren, in dem man ihr Abstimmungsverhalten als konträr verlaufend zum Wahlkreisinteresse kommuniziert (Stecker 2011, S.308). Neben der Möglichkeit, dass fremde Fraktionen das Abstimmungsverhalten eines Abgeordneten zu dessen Diskreditierung nutzen, besteht aber auch die Möglichkeit, individuellen Nutzen aus namentlichen Abstimmungen zu ziehen oder zumindest das Negative Campaining der Gegenseite durch Abweichung von der eigenen Fraktion zu vermeiden. In diesem Fall werden Direktmandatare ihr abweichendes Abstimmungsverhalten als Einsatz für den Wahlkreis oder simples Festhalten an Normen und Wertevorstellungen selbstständig und ohne Erklärungsdruck in ihrem Wahlkreis kommunizieren. Ist davon auszugehen, dass der Einsatz des Abgeordneten für den eigenen Wahlkreis wohlwollend aufgenommen wird, insbesondere in Anbetracht der Kosten, die sein abweichendes Abstimmungsverhalten innerhalb der eigenen Fraktion verursacht. Der Abgeordnete inszeniert sich dementsprechend selbst als Rebell und nutzt sein eigenes Abstimmungsverhalten als individuelle Repräsentation seiner selbst.
Folgt man der Theorie, dass namentliche Abstimmungen als gezieltes taktisches Instrument des individuellen Wahlkampfes verwendet werden, so ergibt sich, dass Wählerinnen und Wähler die politische Arbeit der Direktmandatare, für den eigenen Wahlkreis, bewerten und dem folgend auch sanktionieren oder belohnen (Klingemann & Wessels 2003, S.18). Abstimmungsverhalten ist nicht nur ein Kollektivgut der Fraktionen und Parteien, sondern spielt auch in der individuellen Repräsentation der Direktmandatare eine gewichtete Rolle. Während für Fraktionen ein geschlossenes Auftreten als Idealresultat angesehen werden kann, da Geschlossenheit Stärke und Durchsetzungskraft suggeriert, ist es bei dem individuellen Direktmandat viel mehr die Positionierung als Vertreter seines Wahlkreises und nicht die Erfüllung der Rolle als treuer Parteisoldat, die seine Wiederwahlchancen steigern sollte. Besonders in umkämpften Wahlkreisen ist davon auszugehen, dass die individuelle Repräsentation der Kandidaten eine wichtige Rolle spielt, denn je umkämpfter ein Wahlkreis ist, desto eher werden Abgeordnete bereit sein, den Wünschen des wahlentscheidenden Wählers (Medianwählers) zu folgen (Kauder & Potrafke 2018, S.26). Es ist nur logisch, dass ein rational entscheidender direktgewählter Abgeordneter mit einer unsichereren Mehrheit und einer erhöhten Konkurrenzsituation im eigenen Wahlkreis (und der damit einhergehenden Gefahr des Verlustes des Mandates) bereit ist das Allgemeingut der Fraktionsgeschlossenheit aufzugeben um den möglichen eigenen Nutzen aus individueller Abweichung zu ziehen. Auf dieser Überlegung basierend, lautet die zweite Hypothese dieser Arbeit:
H2: Je enger die prozentuale Stimmendistanz im Wahlkreis zum zweitplatzierten Kandidaten, desto häufiger weicht ein direktgewählter Abgeordneter von der Fraktionsmehrheit ab.
Diese Hypothese stützt sich auf die Theorie, dass namentliche Abstimmungen als taktisches Instrument in der Konkurrenzsituation der Fraktionen und auch einzelnen Abgeordneten im Kampf um öffentliches Ansehen und Wählerstimmen zu verstehen sind. Fraktionen melden namentliche Abstimmungen an, wenn sie vermuten, dass konkurrierende Fraktionen nicht geschlossen abstimmen werden. Direktgewählte Abgeordnete nutzen namentliche Abstimmungen, um ein eigenes Profil herauszuarbeiten und sich in ihrem Wahlkreis zu positionieren. Bisherige Forschungsergebnisse unterstützen die Annahme, dass der Aspekt der Öffentlichkeitsdarstellung einen relevanten Ansatz zur Erklärung von Abweichungen bei Abstimmungen liefert. Hug zeigt auf, dass die Mehrzahl der Parteien im Schweizer Parlament (im Zeitraum der 45. sowie 46. Legislaturperiode) signifikant höhere Abweichungsquoten bei namentlichen und veröffentlichen Abstimmungen aufweisen als bei Abstimmungen, deren Ergebnisse nicht veröffentlicht werden (2010). Sieberer kommt zu dem Ergebnis, dass direktgewählte Abgeordnete im 16. Bundestag bei namentlichen Abstimmungen nicht nur häufiger von der Fraktionslinie abweichen, sondern nach der Abstimmung auch signifikant häufiger als Listenmandatare ihr Abstimmungsverhalten im Rahmen von Erklärungen zur Abstimmung, kommentieren, in dem sie entweder Vorbehalte gegenüber der Linie der eigenen Fraktion äußern oder ihren Dissens rechtfertigen (2015, S.291). Neuhäuser et al. weisen für den selben Zeitraum nach, dass die Wahrscheinlichkeit für abweichendes Abstimmungsverhalten bei direktgewählten Abgeordneten sank, je höher deren prozentuale Stimmenanteil im Wahlkreis bei der vorangegangen Bundestagswahl war (2013, S.97)
Geht man davon aus, dass das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten einen Einfluss auf die Wahlentscheidung der Wähler hat, so ist es relevant zu untersuchen, zu welchem Zeitpunkt Wähler ihre endgültige Wahlentscheidung treffen. Der allgemeinwissenschaftliche Konsens ist, dass sich Wähler in zwei Gruppen aufteilen lassen: Die eine Gruppe wählt traditionell bei jeder Wahl die selbe Partei (in dem Fall dieser Arbeit, in dem ein besonderes Augenmerk auf das personenzentrierte Direktmandat gelegt wird: immer den Kandidaten derselben Partei), die andere Gruppe trifft ihre Wahlentscheidung erst kurz vor der Wahl und zeigt individuell biographisch vielleicht eine gewisse Parteientendenz, nicht aber eine klare Parteienbindung auf (Reinemann et al. 2013, S.9). Während die erste Gruppe quasi die Basiswählerschaft der Parteien stellt und wenig umworben werden muss, so sollte die zweite Gruppe der Unentschlossenen und Wechselwähler besonders im Fokus der Parteien stehen. Es konkurrieren die Parteien/Kandidaten untereinander auf diesem Markt um Wählerstimmen. Sieht man nun individuelles Abstimmungsverhalten bei namentlichen Abstimmungen als taktisches Instrument im Kampf um Wählerstimmen, so werden namentliche Abstimmungen genutzt, um die Gruppe der Unentschlossenen und Wechselwähler von sich selbst zu überzeugen und sie dementsprechend zu einer für den erneut kandidierenden Direktmandatsträger positiven Wahlentscheidung zu führen.
Zu welchem Zeitpunkt genau, die unentschlossenen Wähler eine Wahlentscheidung treffen, ist nicht einwandfrei aufzuschlüsseln und Erhebungen in diesem Bereich sind mit Vorsicht zu genießen, beruhen sie doch zu meist auf retrospektiver Selbsteinschätzung der Wähler und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Selbsteinschätzungen durch verschiedene Effekte und Einflüsse verzerrt wurden (Plischke 2014, S.139). Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass späte Wahlentscheidungen immer häufiger auftreten. Bei den Bundestagswahlen 2005 und 2009 haben nach eigener Aussage etwa die Hälfte der Wähler erst in den letzten Wochen vor der Wahl entschieden, welcher Partei sie ihre Stimme geben würden. Im Vergleich dazu waren es bei der Bundestagswahl 1998 nur 38 Prozent (Reinemann et al. 2013, S.13).
Entscheidet ein Großteil der Wähler sich erst kurz vor der Wahl für einen Kandidaten (/eine Partei), so ist davon auszugehen, dass sich die Entscheidung der Wähler auch nach aktuellen Ereignissen richtet, also nach aktuellen Problemen und Inhalten der politischen Realität sowie nach den zur Lösung dieser Probleme vorgeschlagenen Ansätzen der zur Wahl stehenden Kandidaten und Parteien. Inwiefern die zeitliche Nähe zu der Wahl eines für die Wahlentscheidung relevanten Ereignisses entscheidend ist, wurde noch nicht ausreichend erforscht. Es lässt sich also nicht mit endgültiger Sicherheit sagen, dass je zeitlich näher ein die Wahlentscheidung beeinflussendes Ereignis zur Wahl eintritt, desto stärker wirkt es auf die Wahlentscheidung, im Vergleich zu einem zeitlich entfernteren Ereignis. Dennoch gibt es verschiedene Theorien, die auf einen solchen Zusammenhang hinweisen, beispielhaft die Theorie des politischen Konjunkturzyklus. Der von Nordhaus 1975 entwickelte Zyklus besagt, dass Regierungen vor Wahlterminen durch verstärkte öffentliche Nachfrage die Beschäftigtenzahl steigen lassen können, um aus dem kurzfristen Effekt der sinkenden Arbeitslosenzahl Profit im Sinne von Wählerstimmen für die Regierungspartei schlagen zu können (Behrends 2001, S.121 ff.). Ähnlich dieser Theorie ist auch das allgemeinbekannte Konzept der „Wahlgeschenke“ zu verstehen, in dem Regierungen ihre Handlungsmacht nutzen, um kurz vor der anstehenden Wahl einen positiven Eindruck bei dem Wähler zu hinterlassen. Beispiele hierfür wären kurzfristige Steuersenkungen oder auch eine Erhöhung der Anzahl der Lehrerstellen an öffentlichen Schulen. Diese Überlegung auf namentliche Abstimmungen angewandt bedeutet, dass Fraktionen mit voranschreitender Dauer der Legislaturperiode vermehrt namentliche Abstimmungen anmelden werden, da sich Effekte der Geschlossenheit sowie der Uneinigkeit stärker auf die anstehende Wahl auswirken, je näher sie zeitlich an der anstehenden Wahl liegen. Dementsprechend ist auch davon auszugehen, dass Direktmandatare mit zunehmender zeitlicher Nähe zur Wahl ihr Abstimmungsverhalten verändern werden, da auch die Relevanz ihres Abstimmungsverhaltens aufgrund der zeitlichen Nähe für die anstehende Wahl steigen würde. Daher ist die dritte Hypothese dieser Arbeit:
H3: Je näher eine namentliche Abstimmung an der nächsten Bundestagswahl gelegen ist, desto höher ist die Abweichungsquote aller Direktmandatare bei dieser Abstimmung.
5. Operationalisierung und Methode
5.1 Daten
Für die Überprüfung der Hypothesen wird der 17. Deutsche Bundestag genutzt. Die empirische Analyse verwendet Daten des Bundeswahlleiters zu den Bundestagswahlen 2009 und 2013 sowie einen Datensatz des investigativ.de-Teams der Tageszeitung die Welt, welcher gemeinsam mit dem Artikel „Abnicker oder Rebell – Wer ist was im Bundestag?“11 am 27.01.2016 online veröffentlicht wurde und alle namentlichen Abstimmungsergebnisse sowie das individuelle Abstimmungsverhalten aller Bundestagsabgeordneten der 17. und der ersten Hälfte der 18. Legislaturperiode im deutschen Bundestag dargelegt. Der Datensatz stützt sich auf die in der Einleitung bereits erwähnten Onlinepublikationen des Bundestages zu jeder einzelnen namentlichen Abstimmung. Um die Effekte einer Legislaturperiode zu beobachten, wird sich in dieser Arbeit auf die 17. Legislaturperiode konzentriert. Insgesamt saßen in der 17. Legislaturperiode 299 Direktmandatare im Bundestag. 218 von der CDU/CSU -beide Parteien stellen im Bundestag eine gemeinsame Fraktion, dementsprechend werden ihre Abgeordneten in dieser Arbeit gemeinsam gewertet- 64 von der SPD, 16 von der Partei Die Linke und ein Abgeordneter der Partei Bündnis 90/Grüne. Ein besonderes Augenmerk dieser Arbeit liegt auf den erneut kandidierenden Direktmandataren. Von den 299 Direktmandataren im Bundestag haben 240 Direktmandatare bei der Bundestagswahl 2013 erneut kandidiert (175 von der CDU/CSU, 49 von der SPD, 15 von Die Linke, einer von den Grünen). Während der 17. Legislaturperiode haben 202 namentliche Abstimmungen nach dem üblichen Stimmkartenverfahren stattgefunden. Nur ein Teil der Abgeordneten hat an allen namentlichen Abstimmungen teilgenommen (36 an der Zahl, was einen Anteil von 12 Prozent alle Direktmandatare bedeutet). Insgesamt werden in dieser Arbeit 45.230 individuelle Abstimmungsentscheidungen von erneut kandidierenden Direktmandataren ausgewertet.
5.2 Messung der abhängigen und unabhängigen Variablen
Für die Hypothese 1 misst die abhängige Variable die Differenz (den Zuwachs/den Verlust) in Prozentpunkten des Erststimmenergebnisses eines wiederkandidierenden Direktmandatares in seinem jeweiligen Wahlkreis bei der Bundestagswahl 2013 im Vergleich zu seinem Erststimmenergebnis bei der Bundestagswahl 2009. Die unabhängige Variable, auf welche besonderes Augenmerk in dieser Hypothese gelegt, wird ist die individuelle Abweichungsquote von der Abstimmungsmehrheit der eigenen Fraktion eines Direktmandatares während der 17. Legislaturperiode (2009 bis 2013). Diese Quote wird in Prozentpunkten angegeben. Hierbei wird nicht unterschieden zwischen Inhalt/Thematik der jeweiligen Abstimmung und auch nicht gewichtet, ob sich enthalten oder mit „ja“ oder „nein“ gestimmt wurde. Relevant ist nur das Abweichen von der Fraktionsmehrheit. Es werden alle Abstimmungen gewertet, an denen ein Abgeordneter teilgenommen hat. Anhand der Anzahl der Abstimmungen an denen, der Abgeordnete teilgenommen hat und der Anzahl der Abweichungen wird für jeden der 240 erneut kandidierenden Direktmandatare eine individuelle prozentuale Abweichungsquote errechnet. Zu den politischen Kontrollvariablen gehören das Zweistimmenergebnis der Partei des Direktmandatares in seinem jeweiligen Wahlkreis sowie die Fraktionszugehörigkeit (gleichzusetzen mit der Parteizugehörigkeit) des Abgeordneten. In diesem Fall SPD, Die Linke, Grüne12. Die überproportional große Gruppe der direktgewählten Abgeordneten der CDU/CSU (175 von 240 erneut kandidierenden Abgeordneten) dient als Referenzkategorie. Als weitere Kontrollvariable wird das Geschlecht der erneut kandidierenden Abgeordneten (1= männlich, 0= weiblich) betrachtet.
Für die 2. Hypothese misst die abhängige Variable die individuelle Abweichungsquote von der Abstimmungsmehrheit der eigenen Fraktion eines Direktmandatares, angegeben in Prozent, während der 17. Legislaturperiode (2009 bis 2013). Die unabhängige Variable, auf welche besonderes Augenmerk in dieser Hypothese gelegt wird, ist die Differenz in Prozentpunkten zwischen dem Sieger der Erststimmenwahl und dem Unterlegenen mit der nächsthöchsten Erststimmenzahl innerhalb eines Wahlkreises bei der Bundestagswahl 2013. Ob der Abgeordnete die Wahl gewonnen hat oder nicht, wird nicht beachtet. Relevant ist, dass jeder der 240 erneut kandidierenden Abgeordneten entweder wieder sein Direktmandat gewinnen konnte oder als zweitplatzierter unterlegen war. In keinem Wahlkreis belegte ein ehemaliger Direktmandatar einen schlechteren Platz als den zweiten Platz bei dem finalen Erststimmenergebnis. Dem entsprechend ist jeder erneut kandidierende Abgeordneter in dieser Variablen vertreten. Wie in Hypothese 1 ist die politische Kontrollvariable die Fraktionszugehörigkeit der Abgeordneten (SPD, Die Linke, Grüne) mit den Fraktionsmitgliedern der CDU/CSU als Referenzgruppe. Des Weiteren wird auch wieder das Geschlecht der Abgeordneten (1= männlich; 0=weiblich) als Kontrollvariable in das Modell miteinbezogen.
Für die 3. Hypothese misst die abhängige Variable die Abweichungsquote der erneut kandierenden Direktmandatare bei allen einzelnen namentlichen Abstimmungen der 17. Legislaturperiode. Bei jeder Abstimmung werden die Teilnahmen aller erneut kandidierenden Direktmandate gezählt und diesen die Abweichungen der Direktmandatare gegenübergestellt. Die einzelnen Abweichungen werden fraktionsübergreifend zusammengefasst und so als eine gesamte Abweichungsquote aller Direktmandatare bei der entsprechenden Abstimmung gewertet.
Die unabhängige Variable misst in Form der Sitzungsnummer den Zeitpunkt der Abstimmung. Des Weiteren wird für diese Hypothese ein Streudiagramm erstellt, in dem die unabhängige Variable (X-Achse) der Zeitpunkt der Abstimmung in Datumsform ist.
Die Definition sowie die statistischen Kennwerte aller Variablen sind in den Appendix Tabellen 1 und 2 zusammengefasst.
6.Empirische Analyse
6.1 Deskriptive Befunde
Hinsichtlich der individuellen Abweichungsquote zeigt sich die Gruppe der Direktmandatare zwar nicht homogen, es lässt sich insgesamt aber ein klarer Trend zur Fraktionstreue feststellen. 163 erneut kandidierende Direktmandatare (von 240) haben in der 17. Legislaturperiode bei keiner Abstimmung gegen die Fraktionsmehrheit gestimmt. Dies bedeutet, dass ein Anteil von knapp 68% der erneut kandidierenden Inhaber von Direktmandaten bei keiner der Abstimmungen (an denen diese teilgenommen haben) gegen die Fraktionsmehrheit gestimmt hat. Dem gegenüber stehen 77 erneut kandidierende Direktmandatare, die eine Abweichungsquote von 0,5% oder höher aufweisen. Den höchsten Abweichungswert weist der CSU-Abgeordnete Peter Gauweiler mit einer Abweichungsquote von 31,5% (29 Abweichungen bei Teilnahme an 92 Abstimmungen) auf, gefolgt von dem Grünen Heinz-Christian Ströbele (23,4%, 31 Abweichungen bei Teilnahme an 196 Abstimmungen) und dem SPDler Marc Bülow (17%, 25 Abweichungen bei Teilnahme an 147 Abstimmungen). Die Fraktionen weisen jeweils Mittelwerte von 0,12% bei Die Linke (15 erneut kandidierende Direktmandatare), 1,48% SPD (49 e. k. Direktmandatare), 0,86% CDU (175 e. k. Direktmandatare) bei der individuellen Abweichungsquote der erneut kandidierenden Direktmandatare auf. Für den einzelnen Abgeordneten der Grünen lässt sich aufgrund der singulären Anzahl kein Mittelwert ermitteln. Der Abgeordnete der Grünen weist eine individuelle Abweichungsquote von 23,4% auf. Der Mittelwert der Abweichungsquote bei allen erneut kandidierenden Direktmandataren liegt bei 1,03% und damit geringfügig unter dem Mittelwert der nicht erneut kandidierenden Direktmandatare mit 1,08% und unter dem Wert der Listenabgeordneten mit 1,45%. Diese Befunde deuten bereits an, dass die Annahme dieser Arbeit, dass direktgewählte Abgeordnete eine höhere Tendenz aufweisen, von der Fraktionslinie abzuweichen, mit dem Ziel Wählerstimmen zu gewinnen, nicht zutrifft. Es muss hierbei aber bedacht werden, dass diese Gruppen verschiedene Größen aufweisen -240 erneut kandidierende Direktmandatare; 59 nicht erneut kandidierende Direktmandatare; 352 Listenmandatare- und diese Mittelwerte damit nicht repräsentativ vergleichbar sind.
Von den 202 stattgefundenen namentlichen Abstimmungen der 17. Legislaturperiode weisen 91 eine Abweichungsquote aller erneut kandidierenden Direktmandatare von 0% auf. Dies entspricht 45% aller namentlichen Abstimmungen. 111 namentliche Abstimmungen weisen eine Abweichungsquote von 0,43% oder höher auf (entspricht 55% aller namentlichen Abstimmungen). Die höchste Abweichungsquote weist die Abstimmungen Nr. 4 der 188 Sitzung13 mit 7,73% auf. Im Mittelwert nahmen 223,91 erneut kandidierende Direktmandatare an einer namentlichen Abstimmung teil. 2,11 Direktmandatare wichen im Durchschnitt ab, was einen Mittelwert von 0,92% Abweichungen pro namentlicher Abstimmung bedeutet.
6.2 Multivariate Analyse
Die Ergebnisse der multivariaten Analyse sind in den Tabellen 1, 2 und 3 sowie Abbildung 2 zusammengefasst. Jede Tabelle beinhaltet Modelle, die der Überprüfung einer der drei Thesen gelten. Tabelle 1 überprüft Hypothese 1, Tabelle 2 überprüft Hypothese 2 und Tabelle 3 sowie Abbildung 2 überprüfen Hypothese 3. Da es sich bei allen abhängigen Variablen um metrische Daten handelt werden alle Hypothesen mittels einer einfachen und/oder multiplen linearen Regression überprüft.
Tabelle 1
Tabelle1: Einfluss auf die Differenz des Erststimmenergebnisses 2013 im Vergleich zu 2009 in Prozentpunkten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einträge sind nicht-standardisierte Regressionskoeffizienten. Standardfehler in Klammern.
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
Tabelle 1 dient der Überprüfung der ersten Hypothese (H1), im ersten Modell wurde einzig der Einfluss der prozentualen Abweichungsquote auf die Veränderung des Erststimmenergebnisses 2013 im Vergleich zu 2009 überprüft. Im zweiten Modell wurden via Einschlussverfahren die weiteren Kontrollvariablen (die Differenz des Zweitstimmenergebnisses der Partei des Abgeordneten in seinem Wahlkreis, die Parteizugehörigkeit und das Geschlecht des Abgeordneten) in die Regression mit aufgenommen. Anders als in der Hypothese 1 angenommen wird, zeigt Modell 1, dass die Abweichungsquote bei namentlichen Abstimmungen einen negativen Effekt von -0,084 auf die Stimmenveränderung bei der Bundestagswahl 2013 hat. Erhöht sich die Abweichungsquote eines Abgeordneten um eine Standardabweichung (entspricht 3,33 Prozentpunkten) nimmt sein Erststimmenergebnis bei der Bundestagswahl 2013 um -0,28 Prozentpunkte ab, im Vergleich zur Bundestagswahl 2009. Dieser Wert ist zum einen aber nur unterproportional klein, außerdem ist dieser Regressionskoeffizient nicht signifikant. In Modell 2, in dem das Zweitstimmenergebnis in dem Wahlkreis des Direktmandatares sowie seine Parteizugehörigkeit und Geschlecht berücksichtigt werden, wandelt sich der Wert des Effektes der Abweichungsquote in den positiven Bereich. Ein Regressionskoeffizient von 0,052 bedeutet eine Zunahme des Erststimmenergebnisses 2013 von 0,17 Prozentpunkten, wenn sich die Abweichungsquote eines Abgeordneten um eine Standardabweichung erhöht. Dieser Wert ist aber auch weiterhin unterproportional klein und vor allem nicht signifikant. Auch der Einfluss des Geschlechtes eines wiederkandidierenden Direktmandatares ist weder stark ausgeprägt (-0,187 Prozentpunkte für männliche Kandidaten) noch signifikant. Dies war so auch zu erwarten, hat zum einen keiner der 240 erneut kandidierenden Direktmandatare während der 17.Legislaturperiode das Geschlecht gewechselt, noch gibt es zum anderen einen Erklärungsansatz für einen möglichen starken Wechsel der Geschlechtspräferenz der Wähler für den Direktabgeordneten in ihrem Wahlkreis innerhalb der vier Jahre der beobachteten Legislaturperiode. Die Parteizugehörigkeit der Kandidaten hat in Modell 2 keinen signifikanten Einfluss auf den Zuwachs oder die Abnahme der Erststimmen. Das Zweitstimmenergebnis der Partei des erneut kandidierenden Direktmandatares in dessen Wahlkreis ist hingegen hoch signifikant (p-Wert= 0,000). Bei der Erhöhung um eine Standardabweichung des Zweitstimmenzuwachses in einem Wahlkreis (entspricht 4,48 Prozentpunkten) erhöht sich der Erststimmenzuwachs eines erneut kandidierenden Direktmandatares um 4,25 Prozentpunkte. Der Anstieg des korrigierten R-Quadrates in Modell 2 (0,704) im Vergleich zu Modell 1 (0,000) ist primär auf den Effekt des Zweitstimmenergebnisses zurückzuführen.
Tabelle 2
Tabelle 2: Einfluss auf individuelle Abweichungsquote (in Prozent)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einträge sind nicht-standardisierte Regressionskoeffizienten. Standardfehler in Klammern.
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
Tabelle 2 dient der Überprüfung der zweiten Hypothese (H2). Wie auch schon in Tabelle 1 wird der Einfluss verschiedener unabhängiger Variablen auf die abhängige Variable (in diesem Fall die individuelle Abweichungsquote der erneut kandidierenden Direktmandatre) in zwei Modellen (Modelle 3 und 4) überprüft. Modell 3 überprüft nur den Einfluss des Unterschiedes zum nächstfolgenden Erststimmenkandidaten bei der Bundestagswahl 2013 in Prozentpunkten. Wie in Hypothese 2 formuliert ist der Regressionskoeffizient mit -0,003 negativ. Bei der Zunahme des Unterschieds zum nächstfolgenden Erststimmenkandidaten um eine Standardeinheit (entspricht 12,26 Prozentpunkten) sinkt die individuelle Abweichungsquote eines erneut kandidierenden Direktmandatares um 0,03 Prozentpunkte. Dieser Wert ist unterproportional klein und nicht signifikant. Im vierten Modell wurden via Einschlussverfahren die weiteren Kontrollvariablen (die Differenz des Zweitstimmenergebnisses der Partei des Abgeordneten in seinem Wahlkreis, die Parteizugehörigkeit und das Geschlecht des Abgeordneten) in die Regression mit aufgenommen. Mit der Aufnahme der Kontrollvariablen wandelt sich der negative Regressionskoeffizient in einen positiven Wert von 0,012 und widerlegt damit die aufgestellte Hypothese 2. Bei einer Zunahme der Erststimmendifferenz zum nächsten konkurrierenden Kandidaten steigt demnach auch die individuelle Abweichungsquote, bei Zunahme um eine Standardabweichung der Erststimmendifferenz zum nächsten Kandidaten (entspricht 12,26 Prozentpunkten) steigt die Abweichungsquote um 0,15 Prozentpunkte. Dieser Regressionskoeffizient ist weiterhin unterproportional klein und nicht signifikant. Auch die weiteren Kontrollvariablen sind bis auf die Ausnahme der Parteizugehörigkeit „Grüne“ nicht signifikant. Der hochsignifikante Wert der Parteizugehörigkeit „Grüne“ (p-Wert= 0,000) lässt sich aber primär darüber erklären, dass nur ein einziger Direktmandatsträger die Grünen im Bundestag in der 17.Legislaturperiode vertreten hat.
Tabelle 3
Tabelle 3: Einfluss auf Abweichungsquote einer Abstimmung (in Prozent)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einträge sind nicht-standardisierte Regressionskoeffizienten. Standardfehler in Klammern.
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
Tabelle 3 dient der Überprüfung der dritten Hypothese (H3). In einem Modell (Modell 5) wird der Einfluss des Zeitpunkts der Abstimmung (in diesem Fall wird die Sitzungsnummer gewertet) auf die Abweichungsquote der Abstimmung in Prozentpunkten gemessen. Mit einem positiven Regressionskoeffizient von 0,04 wird die Hypothese 3 bestätigt. Demnach steigt mit fortschreitendem Ablauf der Legislaturperiode die Abweichungsquote der erneut kandidierenden Direktmandatare bei den namentlichen Abstimmungen. Erhöht sich die Sitzungsnummer der namentlichen Abstimmung um eine Standardabweichung (entspricht 75,9 Sitzungen) steigt die Abweichungsquote der Abstimmung um 3,03 Prozent. Mit einem p-Wert von 0,03 weist der Zeitpunkt der Abstimmung auf die gesamte Abweichungsquote einer Abstimmung ein niedriges Signifikanzniveau auf.
Abbildung 2: Streudiagramm Abweichungsquote bei namentlichen Abstimmungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
nach: eigene Darstellung
Zur grafischen Verdeutlichung wird in Abbildung 2 anhand eines Streudiagramms die Verteilung der namentlichen Abstimmungen mit ihren jeweiligen Abweichungsquoten visualisiert. Die Y-Achse des Streudiagramms stellt die Abweichungsquote der Abstimmungen dar. Die X-Achse des Streudiagramms stellt den zeitlichen Verlauf der 17. Legislaturperiode dar. Anders als in der durchgeführten Regression in Modell 5 ist in dieser grafischen Darstellung nicht die Sitzungsnummer, sondern der exakte Zeitpunkt der namentlichen Abstimmung die zeitliche Komponente. Zur weiteren Verdeutlichung wurde eine Interpolationslinie hinzugefügt. Zur Hilfe der statistischen Auswertung wurde eine Anpassungslinie hinzugefügt.
Die Anpassungslinie des Streudiagramms hat mit R²-Linear= 0,043 einen ähnlichen Wert wie der Regressionskoeffizient aus Modell 5 (0,04). Anhand der Grafik lässt sich feststellen, dass die Häufung der namentlichen Abstimmungen mit erhöhten Abweichungswerten mit der Dauer der Legislaturperiode steigt. Entgegen der Annahme aus Hypothese 3, zeigt das Diagramm, dass kurz vor dem Ende der Legislaturperiode also kurz vor der nächsten Bundestagswahl die Abweichungsquoten der Abstimmungen tendenziell eher sinken, also weder weiter steigen, noch sich zumindest auf einem hohen Niveau einpendeln.
7. Zusammenfassung und Ausblick
Die vorliegende Arbeit hat versucht, einen Zusammenhang zwischen dem Abstimmungsverhalten der direktgewählten Bundestagsabgeordneten und der Wahlentscheidung in den Wahlkreisen der Abgeordneten herzustellen. Es wurde in dieser Arbeit argumentiert, dass direktgewählte Bundestagsabgeordnete namentliche Abstimmungen nutzen, um individuellen Stimmengewinn zu erzielen. Sie versuchen sich einen elektoralen Vorteil zu verschaffen, in dem sie bei namentlichen Abstimmungen ihr individuelles Profil stärken. Sie stimmen gegen die eigene Fraktion, um das Interesse ihres eigenen Wahlkreises im Bundestag zu vertreten. Dementsprechend werden sie das Allgemeingut der innerfraktionellen Geschlossenheit dann aufgeben, wenn sie im Wahlkreis aus einer eigenen Abweichung einen Nutzen ziehen können. Es ist daher davon ausgegangen worden, dass hohe Abweichungsquoten der erneut kandidierenden Direktmandatare auch einen Zugewinn an Wählerstimmen für sie bedeuten würde (H1). Des Weiteren wurde argumentiert, dass in besonders engumkämpften Wahlkreisen die Abweichungsquote der Mandatsinhaber höher ist, da sie unter besonderem Zugzwang stehen, ihr Mandat gegenüber einem Konkurrenten verteidigen zu müssen, der (unteranderem) auch die Möglichkeit besitzt, ihr fraktionskonformes/nicht wahlkreiskonformes Abstimmungsverhalten im Rahmen von negative Campaigning in der Öffentlichkeit gegen sie zu verwenden (H2). Abschließend wurde argumentiert, dass erneut kandidierende Direktmandatare vermehrt gegen die Fraktionsgeschlossenheit stimmen, je näher die namentliche Abstimmung an der nächsten Bundestagswahl liegt, um ihr aktuelles Abstimmungsverhalten als Währung der individuellen Repräsentation im Wahlkampf zu nutzen.
Die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit widerlegen diese Annahmen fast durchweg für die 17. Legislaturperiode des Bundestages sowie für die Bundestagswahl 2013. Unter der Berücksichtigung verschiedener Kandidateneigenschaften lässt sich zwar ein positiver Zusammenhang zwischen der Abweichungsquote und dem Stimmenzuwachs eines erneut kandidierenden Direktmandatares feststellen. Dieser Wert liegt zum einen aber nur geringfügig über 0 (Der Mittelwert der erneut kandidierenden Direktmandatare von einer Abweichungsquote mit 1,03 Prozentpunkten würde, nach Modell 2, gegenüber einer null prozentigen Abweichungsquote einen Stimmenzuwachs 0,05 Prozentpunkten bedeuten) und zum anderen ist er statistisch nicht signifikant. Viel mehr bietet das Ergebnis des zweiten Modells Anlass zu einer konträren Überlegung: Wenn das Zweitstimmenergebnis der Partei des Direktkandidaten im Wahlkreis ein Prädikator für dessen Erststimmenerfolg ist und Dissens innerhalb einer Fraktion in der Öffentlichkeit als negativ wahrgenommen wird, also Stimmenverlust bedeutet, dann sollte der Direktmandatsträger kein Interesse daran haben, seiner Fraktion (und damit indirekt seiner Partei) durch Abweichung zu schaden. Scheint er doch von Zweitstimmengewinn der eigenen Partei zu profitieren und durch Zweitstimmenverlust der eigenen Partei auch Erststimmen zu verlieren. Ähnlich wie bei Hypothese 1 können auch die empirischen Ergebnisse aus Modell 3 und 4 Hypothese 2 nicht bestätigen. Vielmehr wird Hypothese 2 in Modell 4 widerlegt. Unter Bezugnahme weiterer Kandidateneigenschaften zeigt sich ein nicht signifikanter positiver Zusammenhang zwischen Kandidatenstimmendifferenz und Abweichungsquote. Erwartet wurde ein negativer Zusammenhang. Einzig Hypothese 3 hält der empirischen Überprüfung stand. Es lässt sich ein Anstieg der gesamten Abweichungsquote mit fortlaufender Dauer der 17. Legislaturperiode feststellen.
Es ist anzumerken, dass diese Ergebnisse der empirischen Analyse nicht allgemeingültig anzuwenden sind und selbstverständlich methodische Einschränkungen die Interpretation der Daten begrenzen. Wenn auch die zeitliche Veränderung überprüft wird, handelt es sich dennoch um einen Querschnittsdatensatz, der sich nur mit einem Ausschnitt der Gesamtheit befasst (namentlich die 17. Legislaturperiode des Bundestages sowie die Bundestagswahlen 2009 und 2013). Daher kann keine Aussage zur Kausalität der Ergebnisse getroffen werden. Der in dieser Arbeit gefundene statistisch signifikante Zusammenhang zwischen Abweichungsquote und zeitlicher Dauer der Legislaturperiode bedeutet nicht, dass der zeitliche Fortschritt der Legislaturperiode und die Nähe zur nächsten Bundestagswahl ursächlich für die Abweichungsquote sein müssen. Ebenso wäre es z.B. möglich, dass mit fortlaufender Dauer der Legislaturperiode zufällig über immer kontroversere Themen (zu denen eine immer stärkere Pluralität der Meinungen in den Fraktionen herrschte) im Bundestag abgestimmt wurde und die zunehmenden Abweichungsquoten auf individuellen Entscheidungen auf das viel zitierten freie Gewissen der Abgeordneten zurückzuführen sind. Ähnlich verhält es sich mit der Wahlentscheidung der Wähler sowie Abstimmungsentscheidungen der Bundestagsabgeordneten. Die empirischen Ergebnisse dieser Arbeiten legen zwar nahe, dass individuelles Abweichungsverhalten der Direktmandatare keinen Einfluss auf die Wahlentscheidung der Wähler hat und auch das Direktmandatare namentliche Abstimmungen nicht zur individuellen Repräsentation durch Abweichung nutzen, dennoch liegt es im Bereich des Möglichen, das genau dies durchaus der Fall sein kann. Um zu beantworten, zu welchem Grad Wähler Abweichungen honorieren oder ob und wann Abgeordnete kalkuliert abweichen, müssten weitere (deutlich datenintensivere) Forschungen betrieben werden. Zu empfehlen wären in diesem Fall die Beobachtung mehrerer Legislaturperioden sowie ganzer Abgeordnetenkarrieren, Forschungen mit dem Schwerpunkt Umfragedaten (über Wählerpräferenzen und Beweggründe der Abgeordneten) sowie Untersuchungen und Klassifizierungen bezüglich der Inhalte von namentlichen Abstimmungen.
Literatur
Baumann, M., Debus, M., & J. Müller. 2013. Das legislative Verhalten von Bundestagsabgeordneten zwischen persönlichen Charakteristika, Wahlkreisinteressen und Parteilinie: Eine Untersuchung am Beispiel der Auseinandersetzung um die Präimplantationsdiagnostik [Caught between personal characteristics, constituency interests and party line: Determinants of the legislative behaviour of Bundestag members in the debate on the regulation of pre-implantation genetic diagnosis]. Zeitschrift für Politikwissenschaft, 23 (2): 177-211.
Bawn, K. 1999. Voter Responses to Electoral Complexity: Ticket Splitting, Rational Voters and Representation in the Federal Republic of Germany. British Journal of Political Science, 29(3): 487–505.
Behrends, S. 2001. Neue politische Ökonomie: systematische Darstellung und kritische Beurteilung ihrer Entwicklungslinien. Vahlen.
Müller, W.& K. Strøm. 2003. Democratic Delegation and Accountability: Cross-national Patterns. In Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies, Hrsg. Bergman, T., Müller, W.& Strøm, K., 109-220. Oxford: Oxford University Press.
Bundeswahlleiter. 2009. Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2009.html. Zugegriffen: 01.10.2019.
Bundeswahlleiter. 2013. Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2013.html. Zugegriffen: 01.10.2019.
Campbell, A., Gurin, G., & Miller, W. 1971. The Voter Decides.
Canes-Wrone, B., Brady, DW. & JF. Cogan. 2002. Out of step, out of office: Electoral accountability and house members’ voting. The American Political Science Review 96(1): 127–140.
Carey, J. M. 2007. Competing Principals, Political Institutions, and Party Unity in Legislative Voting. American Journal of Political Science 51: 92-107.
Delius, M. F., Koß, M., & Stecker, C. 2013. „Ich erkenne also Fraktionsdisziplin grundsätzlich auch an...“–Innerfraktioneller Dissens in der SPD-Fraktion der Großen Koalition 2005 bis 2009. Zeitschrift für Parlamentsfragen: 546-566.
Die Welt. 2016. Abnicker oder Rebell – Wer ist was im Bundestag? . https://www.welt.de/politik/deutschland/article151296429/Abnicker-oder-Rebell-Wer-ist-was-im-Bundestag.html. Zugegriffen am 01.10.2019.
Diekmann, A. & Voss, T. 2004. Die Theorie rationalen Handelns. Stand und Perspektiven. In A. Diekmann und T. Voss, Hrsg., Rational-Choice-Theorie in den Sozialwissenschaften. Anwendungen und Probleme. München: Oldenbourg 2004: 13-29.
Dittberner, J. 2003. Freies Mandat und politische Geschlossenheit. Widerspruch oder Ergänzung zweier Prinzipien des Parlamentarismus? Zeitschrift für Parlamentsfragen, 34(3): 550-564.
Eilfort, M. 2003. Geschlossenheit und gute Figur. Ein Versuch über die Steuerung von Fraktionen. Zeitschrift für Parlamentsfragen 34(3): 565–582
Gilardi, F. & Braun, D. 2002. Delegation aus der Sicht der Prinzipal-Agent-Theorie. Politische Vierteljahresschrift, 43(1): 147–161.
Gschwend, T., & Zittel, T. 2011. Machen Wahlkreiskandidaten einen Unterschied? Die Persönlichkeitswahl als interaktiver Prozess. In Wählen in Deutschland; 378-399. Nomos Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG.
Hug, S. 2010. Selection Effects in Roll Call Votes. British Journal of Political Science, 40(1): 225-235.
Immerfall, S. 1993. Themen, Politiker, Parteien – Der deutsche Wiedervereinigungs-Wahlkampf 1990 im Spiegel der Printmedien. Communications, 18 (1): 103-114.
Isensee J. 2007. Fraktionsdisziplin und Amtsgewissen: Verfassungsrechtliche Garantie der Freiheit des Mandats im politischen Prozess. In Res publica semper reformanda, Hrsg. Patzelt W.J., Sebaldt M., Kranenpohl U., 254-267. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Kaack, H. 2013. Wahlkreisgeographie und Kandidatenauslese: regionale Stimmenverteilung, Chancen der Kandidaten und Ausleseverfahren, dargestellt am Beispiel der Bundestagswahl 1965 (Vol. 82). Springer-Verlag.
Kauder, B., & Potrafke, N. 2017. Gibt es Schelte für Bundestagsabgeordnete, die nicht mit ihrer eigenen Partei stimmen? Ifo-Schnelldienst, 70 (12): 26-29.
Kauder, B., & Potrafke, N. 2018. Warum stimmen Unionsabgeordnete für die Ehe für alle? Es ist die Konkurrenz im Wahlkreis!. ifo Schnelldienst, 71 (24): 26-27.
Könen, S. 2009. Wo sind die Rebellen hin? : Dissentierendes Abstimmungsverhalten in ost- und westdeutschen Landtagen (1. Aufl. ed.). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.
Kühnel, S., & Mays, A. 2009. Das Michigan-Modell des Wahlverhaltens und die subjektive Sicht der Wähler. Zur Korrespondenz der Effekte von Parteineigung, Kandidatenbewertungen und Urteilen zu politischen Sachthemen mit der subjektiven Begründung von Wahlentscheidungen. In Wähler in Deutschland, 313-328. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Leibholz, G. 1966. Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahrhundert. 3. erweiterte Auflage. Berlin: Walter de Gruyter.
Manow, P. 2012. Wahlkreis- oder Listenabgeordneter, Typus oder Episode? Eine Sequenzanalyse der Wege in den Bundestag. Politische Vierteljahresschrift, 53(1): 53–78.
Müller, W. C., & Strøm K. 1999. Policy, Office, or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Decisions. Cambridge: Cambridge University Press.
Neuhäuser, A., M. Mischler, G. D. Ruxton, & M. Neuhäuser. 2013. Gründe für von der Fraktionsdisziplin abweichendes Abstimmungsverhalten bei Bundestagsabgeordneten. AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv 7: 91–99.
Neunhoeffer, M., Gschwend, T., Munzert, S., & L. F. Stoetzer. 2018. Eine neuronales Netzwerk zur Vorhersage von Erststimmenergebnissen bei Bundestagswahlen.
Nordhaus, W. D. 1975. The Political Business Cycle. Review of Economic Studies 42: 169-190.
Plischke, T. 2014. Fällt die Wahlentscheidung immer später? Die Entwicklung des Zeitpunkts der Wahlentscheidung bei den Bundestagswahlen 1969 bis 2009. Politische Vierteljahresschrift 55 (1): 118-144.
Pyschny, A., & Hellmann, D. 2017. Wann ist „sicher “sicher? Kriterien zur Operationalisierung sicherer Wahlkreise im Vergleich. ZParl Zeitschrift für Parlamentsfragen 48 (2): 350-369.
Reinemann, C., Maurer, M., Zerback, T., & O. Jandura. 2013. Die Spätentscheider: Medieneinflüsse auf kurzfristige Wahlentscheidungen. Springer-Verlag.
Saalfeld, T. 1995. On dogs and whips: Recorded votes. In Parliaments and majority rule in Western Europe, Hrsg. Herbert Döring, 528–565. Frankfurt a. M.: Campus.
Saalfeld, T. 2005. Determinanten der Fraktionsdisziplin. Deutschland im internationalen Vergleich. In Mechanismen der Politik. Strategische Interaktion im deutschen Regierungssystem, Hrsg. Ganghof, S., 35-71. Frankfurt am Main (u.a.): Max Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.
Schuett-Wetschky, E. 1984. Grundtypen parlamentarischer Demokratie: Klassisch-altliberaler Typ und Gruppentyp. Unter besonderer Berücksichtigung der Kritik am" Fraktionszwang". Freiburg und München: Alber.
Schüttemeyer, S. & Sturm, R. 2005. Der Kandidat – das (fast) unbekannte Wesen, Befunde und Überlegungen zur Aufstellung der Bewerber zum Deutschen Bundestag, ZParl 36(3): 539 – 553.
Schweitzer, C.-C. 1979. Der Abgeordnete im parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik.
Sieberer, U. 2006. "Party unity in parliamentary democracies: A comparative analysis."The Journal of Legislative Studies 12(2): 150-178.
Sieberer, U. 2010. Behavioral consequences of mixed electoral systems: Deviating voting behavior of district and list MPs in the German Bundestag. Electoral Studies 29: 484-496.
Sieberer, U. 2015. Using MP statements to explain voting behaviour in the German Bundestag: An individual level test of the Competing Principals Theory. Party Politics 21(2): 284-294.
Stecker, C. 2011. Bedingungsfaktoren der Fraktionsgeschlossenheit. Eine vergleichende Analyse der deutschen Länderparlamente. Politische Vierteljahresschrift, 52(3): 424–447.
Stecker, C. 2011. Namentliche Abstimmungen als Währung individualisierter Repräsentation: Eine Vergleichende Analyse der deutschen Länderparlamente: Evidence from the German Länder. Zeitschrift Für Vergleichende Politikwissenschaft, 5(2): 303-328.
Stratmann T. 2006. Party-line voting and committee assignments in the German mixed-member system. In Democratic constitutional design and public policy. Analysis and evidence, Hrsg. Congleton RD. & Swedenborg B., 111–130. Cambridge: MIT Press.
von Beyme, K. 1997. Agendasetting und die Rolle der Medien. In Der Gesetzgeber, 73-91. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Wessels, B. 1999. Political consequences of Germany's mixed-member system: Personalization at the grass-roots?. FS III: 99-205.
Zeuner, B. 2013. Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 1965: Untersuchungen zur innerparteilichen Willensbildung und zur politischen Führungsauslese (Vol. 2). Springer-Verlag.
Zittel, T. & Gschwend, T. 2007. "Individualisierte Wahlkämpfe im Wahlkreis. Eine Analyse am Beispiel des Bundestagswahlkampfes von 2005."Politische Vierteljahresschrift 48(2): 293-321.
Appendix Tabelle 1
Appendix Tabelle1: Definition der Variablen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Appendix Tabelle 2
Appendix Tabelle 2: Zusammenfassung des Datensatzes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Aus Gründen sprachlicher Einfachheit werden im Folgenden nur männliche Bezeichnungen verwendet. Diese sind geschlechtsneutral zu verstehen.
2 Im Folgenden wird immer von Abstimmungen im Deutschen Bundestag ausgegangen. Wenn nicht explizit nötig, wird das Anhängsel „im Deutschen Bundestag“ ausgelassen.
3 https://www.berliner-zeitung.de/politik/ehe-fuer-alle-so-haben-die-abgeordneten-abgestimmt---die-namensliste-27888792 Zugegriffen am 01.10.2019.
4 https://www.bundestag.de/abstimmung Zugegriffen am 01.10.2019
5 https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/flugbl_wahlrecht_090913_0.pdf?file=1 Zugegriffen am: 01.10.2019
6 In der einschlägigen Literatur herrscht keine Einigkeit darüber, ab welchem Wert ein Wahlkreis als „sicher“ deklariert werden kann. Mit Blick auf die Bundestagswahlen sind folgende Werte geläufig: Erstimmenvorsprung von mindestens zehn Prozentpunkten (Zeuner 1970); Erststimmenvorsprung von mindestens 17 Prozentpunkten (Psychny & Hellmann 2017); Erststimmenvorsprung von mindestens 24 Prozentpunkten (Kaack 1969).
7 Zumindest Ähnlichkeit mit dem Ansatz dieser Hypothese, weist die Arbeit von Canes-Wrone et al. (2002) auf, die im Rahmen der Roll-Call Ideological Extremity Hypothesis aufzeigen, dass Mitglieder des U.S. Kongresses signifikant schlechtere Wiederwahl Aussichten haben, je vollkommener ihr Abstimmungsverhalten den ideologischen Leitbildern (Demokraten: liberal; Republikaner: konservativ) ihrer Partei folgt.
8 https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/A/abstimmungen-245316 Zugegriffen am: 01.10.2019
9 https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/N/nam_abst-245502 Zugegriffen am: 01.10.2019
10 Eine detailliertere beispielhafte Darstellung ist zu finden in Stecker 2011, S.311.
11 https://www.welt.de/politik/deutschland/article151296429/Abnicker-oder-Rebell-Wer-ist-was-im-Bundestag.html Zugegriffen am: 01.10.2019
12 Die Fraktion der FDP stellte in der 17. Legislaturperiode keinen direktgewählten Abgeordneten, die AFD war noch nicht im Bundestag vertreten.
13 Abstimmung am 29.06.2012 über das „ESM-Finanzierungsgesetz“. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/39553410_kw26_sp_fiskalvertrag-208902 Zugegriffen am: 01.10.2019
Details
- Titel
- Namentliche Abstimmungen im Bundestag. Ursachen und Folgen von fraktionsabweichendem Abstimmungsverhalten
- Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
- Note
- 1,85
- Autor
- Nils-Kristian Bars (Autor:in)
- Jahr
- 2019
- Seiten
- 40
- Katalognummer
- V510234
- ISBN (eBook)
- 9783346077899
- ISBN (Buch)
- 9783346077905
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Namentliche Abstimmungen Fraktionsgeschlossenheit Direktkandidat Deutscher Bundestag
- Preis (Book)
- US$ 17,99
- Arbeit zitieren
- Nils-Kristian Bars (Autor:in), 2019, Namentliche Abstimmungen im Bundestag. Ursachen und Folgen von fraktionsabweichendem Abstimmungsverhalten, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/510234
-
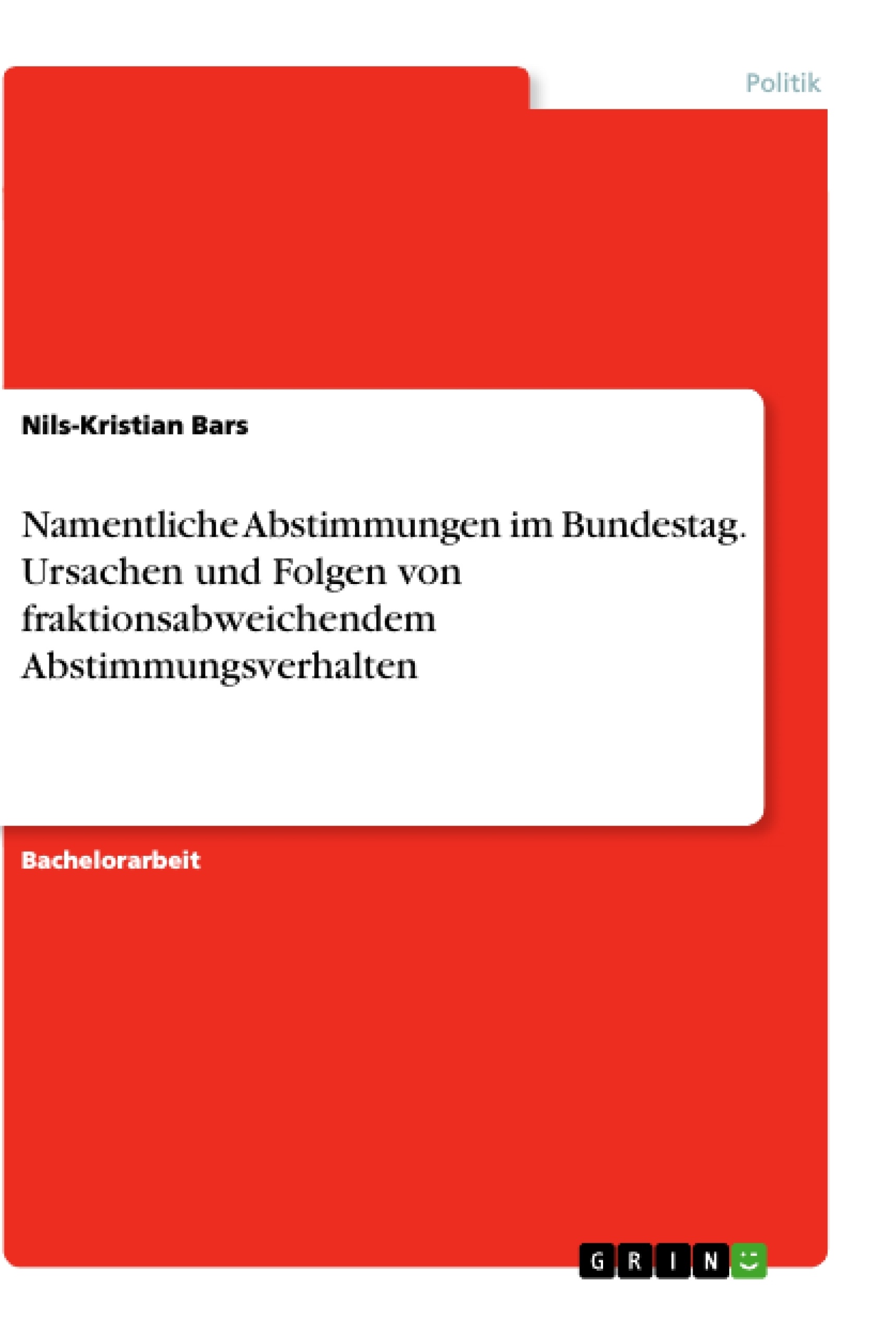
-
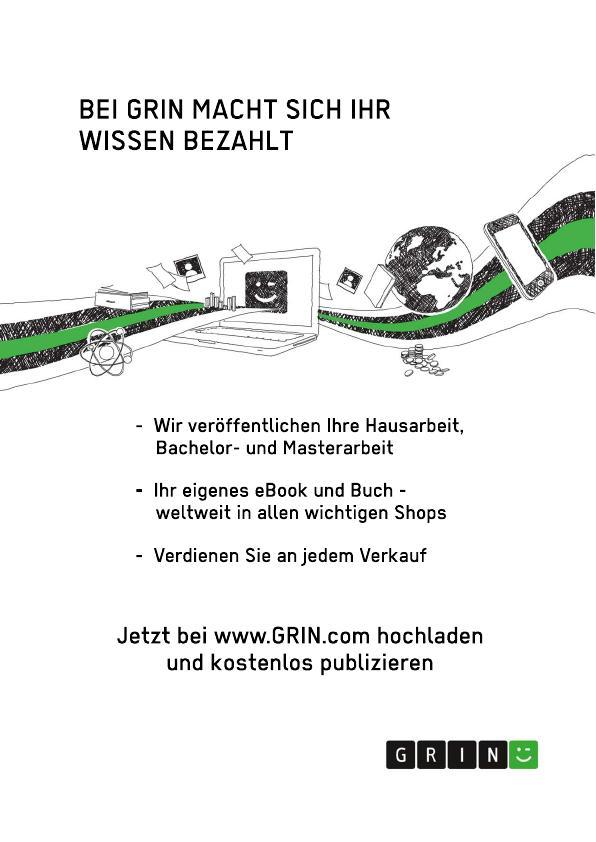
-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-








Kommentare