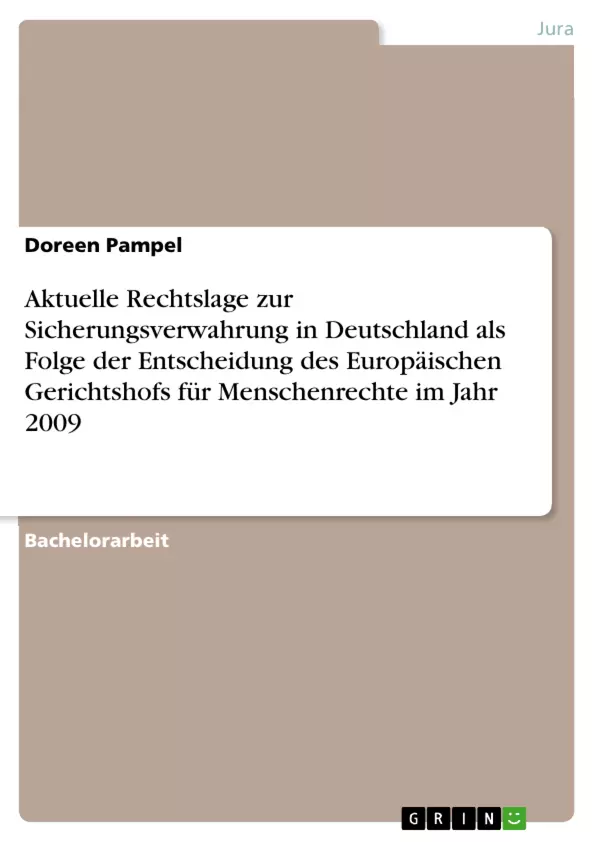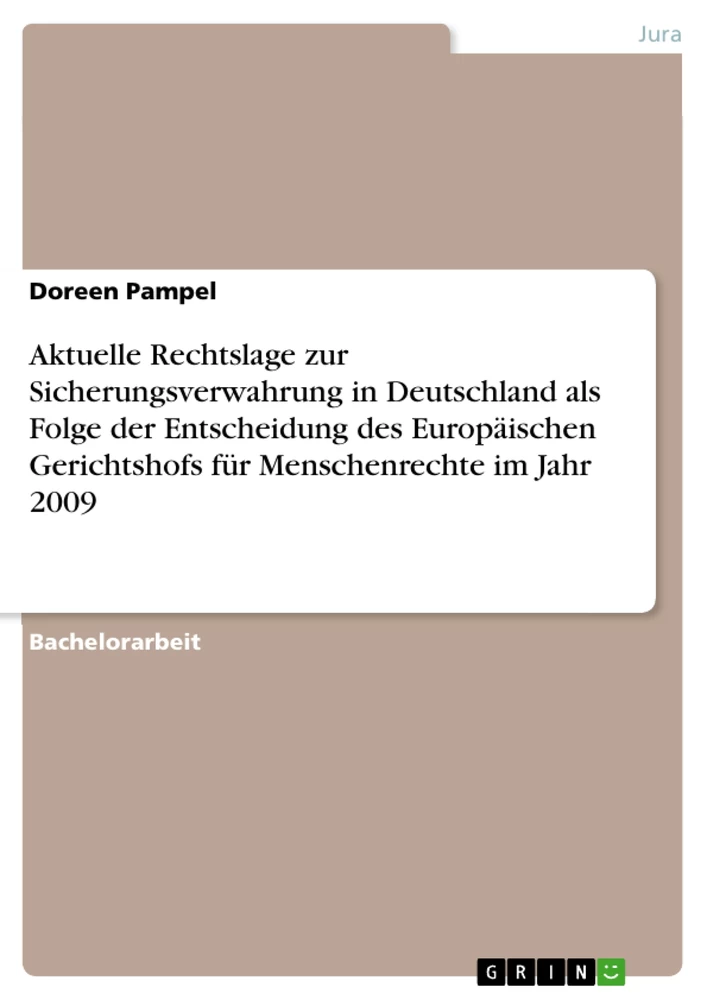
Aktuelle Rechtslage zur Sicherungsverwahrung in Deutschland als Folge der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Jahr 2009
Bachelorarbeit, 2017
47 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeines zur Sicherungsverwahrung
- 2.1 Definition
- 2.1.1 Unterbringung in der Sicherungsverwahrung gem. §66 StGB
- 2.1.2 Vorbehalt der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung gem. §66a StGB
- 2.1.3 Nachträgliche Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung gem. §66b StGB
- 2.1.4 Ausgestaltung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung und des vorhergehenden Strafvollzuges gem. §66c StGB
- 2.1.5 Überweisung in den Vollzug einer anderen Maßregel gem. §67a StGB
- 2.1.6 Späterer Beginn der Unterbringung gem. §67c StGB
- 2.1.7 Dauer der Unterbringung gem. §67d StGB
- 2.1.8 Überprüfung gem. §67e StGB
- 2.1.9 Widerruf der Aussetzung gem. § 67g StGB
- 2.2 Geschichtlicher Hintergrund
- 2.2.1 Historische Formen
- 2.2.2 1933 bis 1945 – Nationalsozialismus
- 2.2.3 1945 bis 1998
- 2.2.4 1998 bis 2008
- 2.2.5 Kurzzusammenfassung des geschichtlichen Überblicks
- 2.3 Urteil des EGMR bezüglich der nachträglichen Sicherungsverwahrung
- 2.3.1 Sachverhalt
- 2.3.2 Das in Rede stehende Verfahren
- 2.3.3 Vollzug der Sicherungsverwahrung beim Beschwerdeführer
- 2.3.4 Rechtliche Würdigung
- 2.3.5 Würdigung durch den EGMR
- 2.3.6 Urteil des EGMR
- 2.3.7 Ausgang des Falles über das Urteil hinaus
- 2.4 Konsequenzen des Urteils
- 2.4.1 Das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen
- 2.4.2 Erweiterungen im Recht der Führungsaufsicht
- 2.4.3 ThUG
- 2.4.4 Das Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsgebotes im Recht der Sicherungsverwahrung
- 2.4.5 Zusammenfassung
- 3. Praktisches Beispiel
- 4. Fazit
- Definition der Sicherungsverwahrung und ihrer rechtlichen Grundlagen
- Geschichtliche Entwicklung der Sicherungsverwahrung in Deutschland
- Analyse des EGMR-Urteils von 2009 und dessen Konsequenzen für die deutsche Rechtsprechung
- Praktische Anwendung der Sicherungsverwahrung anhand eines konkreten Beispiels
- Kritische Betrachtung der Sicherungsverwahrung und Diskussion von Verbesserungsmöglichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema der Sicherungsverwahrung in Deutschland. Ziel der Arbeit ist es, den Begriff der Sicherungsverwahrung anhand der aktuellen Gesetzeslage zu definieren und die geschichtliche Entwicklung dieser Maßregel zu beleuchten. Zudem wird das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) aus dem Jahr 2009 und dessen Konsequenzen analysiert. Abschließend wird anhand eines praktischen Beispiels das Konstrukt der Sicherungsverwahrung verständlicher gemacht und ein persönliches Fazit gezogen, welches die positiven und negativen Aspekte der Sicherungsverwahrung beleuchtet sowie Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Sicherungsverwahrung ein und definiert den Begriff anhand der aktuellen Gesetzeslage. Das zweite Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der Sicherungsverwahrung, beginnend mit historischen Formen und umfassend die Zeit des Nationalsozialismus, die Nachkriegszeit und die Entwicklung bis zum Jahr 2008. Kapitel drei befasst sich mit dem Urteil des EGMR bezüglich der nachträglichen Sicherungsverwahrung, wobei der Sachverhalt, das in Rede stehende Verfahren, der Vollzug der Sicherungsverwahrung beim Beschwerdeführer, die rechtliche Würdigung, die Würdigung durch den EGMR, das Urteil des EGMR und der Ausgang des Falles über das Urteil hinaus beleuchtet werden. Kapitel vier befasst sich mit den Konsequenzen des Urteils des EGMR, darunter das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen, Erweiterungen im Recht der Führungsaufsicht, das Gesetz zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewalttäter (ThUG) und das Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsgebotes im Recht der Sicherungsverwahrung. Kapitel fünf präsentiert ein praktisches Beispiel zur Veranschaulichung der Sicherungsverwahrung in der Praxis.
Schlüsselwörter
Sicherungsverwahrung, Strafrecht, Strafvollzug, EGMR, Menschenrechte, Rechtssicherheit, Gesetzeslage, Geschichte, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, Führungsaufsicht, ThUG, Abstandsgebot, Praxisbeispiel
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Sicherungsverwahrung in Deutschland?
Die Sicherungsverwahrung ist eine präventive Maßregel der Besserung und Sicherung, die dazu dient, die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern zu schützen, auch nach Verbüßung ihrer regulären Haftstrafe.
Welche Bedeutung hat das EGMR-Urteil von 2009 für die Sicherungsverwahrung?
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) urteilte, dass die nachträgliche Verlängerung der Sicherungsverwahrung gegen das Rückwirkungsverbot verstößt, was eine umfassende gesetzliche Neuregelung in Deutschland erforderte.
Was besagt das „Abstandsgebot“ im Kontext der Sicherungsverwahrung?
Das Abstandsgebot fordert, dass sich der Vollzug der Sicherungsverwahrung deutlich vom regulären Strafvollzug unterscheiden muss, insbesondere durch einen stärkeren Fokus auf Therapie und Betreuung.
Wann kann eine Sicherungsverwahrung nachträglich angeordnet werden?
Eine nachträgliche Anordnung ist nach § 66b StGB unter sehr strengen Voraussetzungen möglich, wenn sich erst während des Vollzugs der Haft eine besondere Gefährlichkeit des Täters herausstellt.
Wie sah die Sicherungsverwahrung im Nationalsozialismus aus?
Zwischen 1933 und 1945 wurde die Sicherungsverwahrung massiv ausgeweitet und oft zur willkürlichen Ausschaltung politischer Gegner oder „Gemeinschaftsfremder“ missbraucht.
Details
- Titel
- Aktuelle Rechtslage zur Sicherungsverwahrung in Deutschland als Folge der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Jahr 2009
- Hochschule
- Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut, ehem. Fachhochschule Landshut
- Note
- 1,3
- Autor
- Doreen Pampel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 47
- Katalognummer
- V1000096
- ISBN (eBook)
- 9783346379610
- ISBN (Buch)
- 9783346379627
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Sicherungsverwahrung EGMR Maßregel Führungsaufsicht ThUG elektronische Aufenthaltsüberwachung EAÜ
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Doreen Pampel (Autor:in), 2017, Aktuelle Rechtslage zur Sicherungsverwahrung in Deutschland als Folge der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Jahr 2009, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1000096
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-