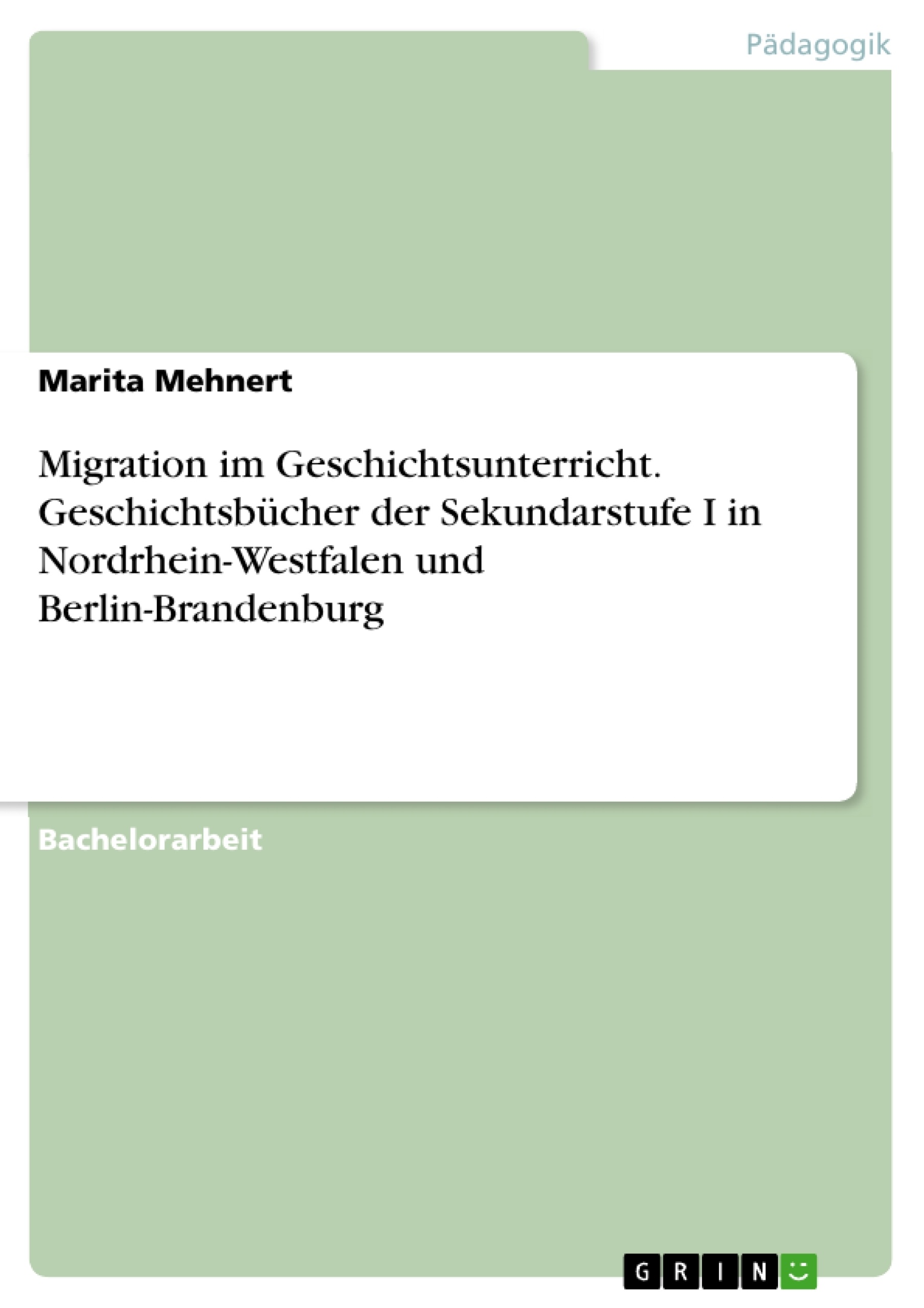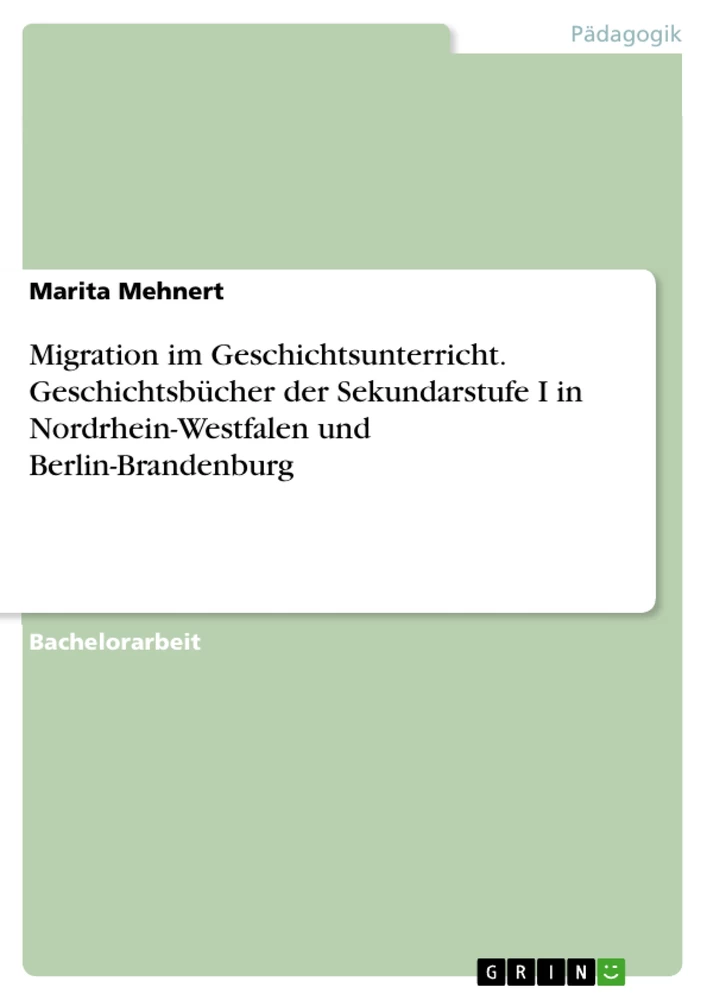
Migration im Geschichtsunterricht. Geschichtsbücher der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen und Berlin-Brandenburg
Bachelorarbeit, 2018
46 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Migration als „Normalfall“ der Geschichte
- Migration im Geschichtsunterricht
- Lehrpläne
- Didaktische Legitimation
- Entwicklung der Migrationsdarstellung in deutschen Lehrbüchern seit 1980
- Vergleichende Analyse der Schulbücher Zeitreise 7/8 und 9/10 in Berlin-Brandenburg sowie Zeitreise 2 und 3 in Nordrhein-Westfalen
- Methodische Vorgehensweise
- Migration und MigrantInnen im Darstellungsteil
- Migration und MigrantInnen im Arbeitsteil
- Ergebnisse
- Implikationen für den Unterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Darstellung von Migration in Geschichtslehrbüchern der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen und Berlin-Brandenburg. Im Fokus steht der Vergleich der Schulbuchreihen „Zeitreise“ in beiden Bundesländern, um herauszufinden, ob und inwiefern die unterschiedliche Gestaltung der Lehrpläne einen reflektierten Umgang mit Migration in den Schulbüchern fördert.
- Relevanz von Migration als „Normalfall“ der Geschichte
- Rolle von Migration in den Lehrplänen von Nordrhein-Westfalen und Berlin-Brandenburg
- Analyse der Migrationsdarstellung in den Schulbüchern „Zeitreise“
- Bedeutung der Migrationsdarstellung für den Geschichtsunterricht
- Implikationen für einen reflektierten Umgang mit Migration im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die Relevanz von Migration im Geschichtsunterricht, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft in Deutschland. Die unterschiedlichen Schwerpunkte der Lehrpläne in Nordrhein-Westfalen und Berlin-Brandenburg werden vorgestellt und die Bedeutung von Schulbüchern für die Vermittlung von Migrationsgeschichte wird hervorgehoben.
- Migration als „Normalfall“ der Geschichte: Dieses Kapitel beleuchtet Migration als ein zentrales Element der Menschheitsgeschichte und zeigt, wie der Begriff „Migration“ oft mit negativen Konnotationen verbunden ist. Die Wichtigkeit, Migration als ein komplexes Phänomen zu verstehen, das von individuellen, sozialen und politischen Faktoren beeinflusst wird, wird betont.
- Migration im Geschichtsunterricht: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Migration in den Lehrplänen der beiden Bundesländer und untersucht die didaktische Legitimation des Themas. Zudem wird die Entwicklung der Migrationsdarstellung in deutschen Lehrbüchern seit den 1980er Jahren beleuchtet.
- Vergleichende Analyse der Schulbücher Zeitreise 7/8 und 9/10 in Berlin-Brandenburg sowie Zeitreise 2 und 3 in Nordrhein-Westfalen: Dieses Kapitel präsentiert die methodische Vorgehensweise der Schulbuchanalyse und vergleicht die „Zeitreise“-Bände in Bezug auf den Umfang und die Qualität der Migrationsdarstellung. Dabei werden sowohl der Darstellungsteil als auch der Arbeitsteil der Bücher betrachtet.
Schlüsselwörter
Migration, Geschichtsunterricht, Lehrplan, Schulbuch, Zeitreise, Nordrhein-Westfalen, Berlin-Brandenburg, Migrationshintergrund, interkulturelle Bildung, Geschichtsdidaktik, Schulbuchanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht diese Bachelorarbeit zum Thema Migration?
Die Arbeit vergleicht Geschichtsschulbücher aus NRW und Berlin-Brandenburg hinsichtlich ihrer Darstellung von Migration und Migranten.
Warum ist Migration im Geschichtsunterricht heute so relevant?
Etwa jeder dritte Schüler in Deutschland hat einen Migrationshintergrund; eine lebensweltnahe Geschichtsvermittlung fördert die Identifikation mit dem Fach.
Welche Schulbuchreihe wurde für die Analyse ausgewählt?
Es wurde die Schulbuchreihe "Zeitreise" in den entsprechenden Bänden für die Sekundarstufe I beider Bundesländer analysiert.
Was ist der Unterschied zwischen den Lehrplänen von NRW und Berlin-Brandenburg?
Berlin-Brandenburg räumt der interkulturellen Bildung seit 2017 eine höhere Priorität ein, während NRW oft noch stärker europazentriert orientiert ist.
Was versteht man unter Migration als „Normalfall“ der Geschichte?
Es beschreibt die Sichtweise, dass Wanderungsbewegungen ein permanenter und zentraler Bestandteil der gesamten Menschheitsgeschichte sind.
Details
- Titel
- Migration im Geschichtsunterricht. Geschichtsbücher der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen und Berlin-Brandenburg
- Hochschule
- Universität Bielefeld
- Note
- 2,3
- Autor
- Marita Mehnert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V1000148
- ISBN (eBook)
- 9783346393104
- ISBN (Buch)
- 9783346393111
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- migration geschichtsunterricht geschichtsbücher sekundarstufe nordrhein-westfalen berlin-brandenburg
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Marita Mehnert (Autor:in), 2018, Migration im Geschichtsunterricht. Geschichtsbücher der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen und Berlin-Brandenburg, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1000148
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-