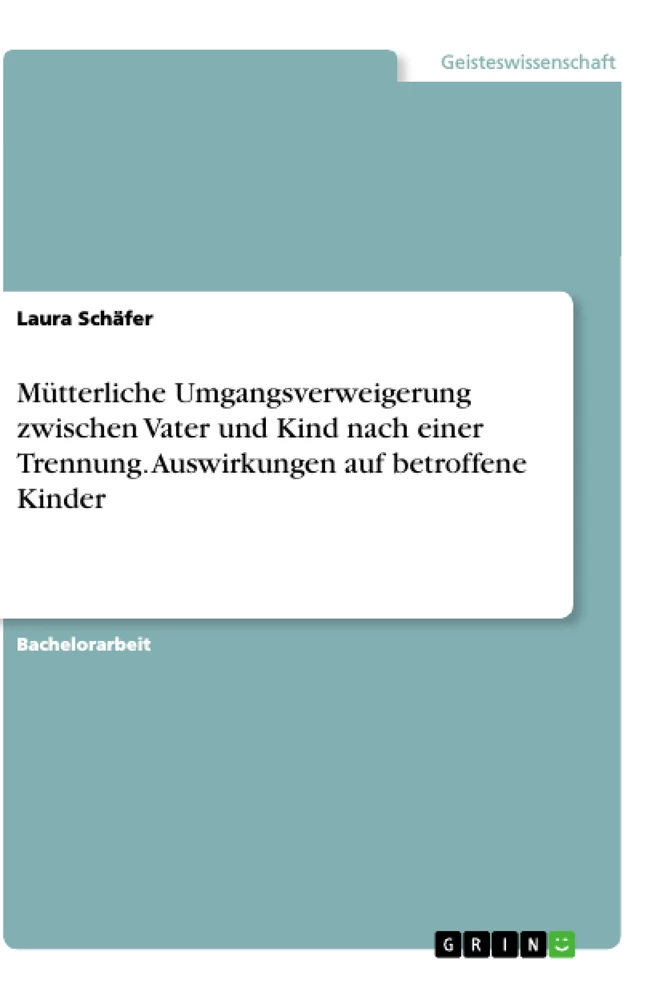
Mütterliche Umgangsverweigerung zwischen Vater und Kind nach einer Trennung. Auswirkungen auf betroffene Kinder
Bachelorarbeit, 2017
112 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Umgang bei Trennung und Scheidung
- 2.1 Bedeutung und Notwendigkeit des Umgangs
- 2.2 Kreis der Umgangsberechtigten
- 2.2.1 Rechtlicher Vater
- 2.2.2 Sozialer Vater
- 2.2.3 Biologischer Vater
- 3. Umgangsverweigerung
- 3.1 Gründe für ausbleibenden Umgang aus der Sicht der betreuenden Mutter
- 3.1.1 Kindorientierte Motive
- 3.1.2 Kindfremde Motive
- 3.2 Umsetzung der Umgangsvereitelung
- 3.3 Umgangsvereitelung und Kindeswohlgefährdung
- 3.3.1 Eingriffsschwelle
- 3.3.2 Interventionsmöglichkeiten
- 3.1 Gründe für ausbleibenden Umgang aus der Sicht der betreuenden Mutter
- 4. Folgen der Umgangsverweigerung für betroffene Kinder
- 4.1 Belastungen der Kinder
- 4.2 Direkte Folgen
- 4.3 Indirekte Folgen
- 5. Zusammenfassung der Hypothesen
- 6. Empirische Untersuchungen
- 6.1 Fragebogen
- 6.2 Auswahl der Fragebogenadressaten
- 6.3 Erhebungsort
- 6.4 Entwicklung des Fragebogens
- 6.5 Durchführung der Erhebung
- 6.6 Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen mütterlicher Umgangsverweigerung nach Trennung und Scheidung auf betroffene Kinder. Ziel ist es, die Folgen des Kontaktabbruchs zwischen Vater und Kind zu analysieren und die psychischen, physischen, seelischen und sozialen Auswirkungen auf die Kinder zu beleuchten. Die Arbeit stützt sich auf Literaturrecherche, theoretische Ausarbeitung und eine empirische Untersuchung mittels Fragebögen.
- Mütterliche Umgangsverweigerung und deren Motive
- Belastungen und Auswirkungen auf die Kinder (psychisch, physisch, sozial)
- Die Rolle des Kindeswohls und rechtliche Aspekte
- Die Vater-Kind-Beziehung im Kontext der Umgangsverweigerung
- Ergebnisse der empirischen Untersuchung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der mütterlichen Umgangsverweigerung nach Trennung und Scheidung ein und skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit. Sie betont die Bedeutung des Themas für das Kindeswohl und die Notwendigkeit einer umfassenden Untersuchung der Auswirkungen auf die betroffenen Kinder.
2. Umgang bei Trennung und Scheidung: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung und Notwendigkeit des Umgangs zwischen Kindern und beiden Elternteilen nach Trennung oder Scheidung. Es definiert den Kreis der Umgangsberechtigten, indem es zwischen rechtlichem, sozialem und biologischem Vater unterscheidet und die rechtlichen Implikationen der Umgangskontakte diskutiert. Die Notwendigkeit von Umgangskontakten für die gesunde Entwicklung des Kindes steht hier im Mittelpunkt.
3. Umgangsverweigerung: Dieses Kapitel analysiert die Gründe für mütterliche Umgangsverweigerung. Es differenziert zwischen kindorientierten Motiven (z.B. Schutz des Kindes vor Konflikten) und kindfremden Motiven (z.B. Rachegelüste, Bindungsintoleranz). Darüber hinaus wird die Umsetzung der Umgangsvereitelung und deren Beziehung zum Kindeswohlgefährdung untersucht. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Strategien, mit denen der Umgang verhindert wird, sowie die damit verbundenen ethischen und rechtlichen Fragen.
4. Folgen der Umgangsverweigerung für betroffene Kinder: Dieses Kapitel untersucht die vielfältigen Folgen der Umgangsverweigerung für die Kinder. Es werden sowohl die direkten (psychische, physische, seelische und soziale Auswirkungen) als auch indirekte Folgen (z.B. Bindungsstörungen, Beeinträchtigung der Vater-Kind-Beziehung) detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf der Belastung der Kinder durch Loyalitätskonflikte, Schuldgefühle und die fehlende Vaterrolle. Das Kapitel stellt die komplexen Zusammenhänge zwischen Umgangsverweigerung und der Kindesentwicklung dar.
Schlüsselwörter
Umgangsverweigerung, Umgangsvereitelung, Kindeswohl, Trennung, Scheidung, psychische Auswirkungen, physische Auswirkungen, soziale Auswirkungen, Vater-Kind-Beziehung, Bindungsstörung, empirische Studie, Fragebogen, quantitative Sozialforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Auswirkungen mütterlicher Umgangsverweigerung nach Trennung und Scheidung auf betroffene Kinder
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen mütterlicher Umgangsverweigerung nach Trennung und Scheidung auf die betroffenen Kinder. Sie analysiert die Folgen des Kontaktabbruchs zwischen Vater und Kind und beleuchtet die psychischen, physischen, seelischen und sozialen Auswirkungen auf die Kinder.
Welche Methoden wurden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine umfassende Literaturrecherche, eine theoretische Ausarbeitung und eine empirische Untersuchung mittels Fragebögen. Die empirische Untersuchung umfasst die Entwicklung eines Fragebogens, die Auswahl der Teilnehmer, die Durchführung der Erhebung und die Auswertung der Ergebnisse.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: mütterliche Umgangsverweigerung und deren Motive, Belastungen und Auswirkungen auf die Kinder (psychisch, physisch, sozial), die Rolle des Kindeswohls und rechtliche Aspekte, die Vater-Kind-Beziehung im Kontext der Umgangsverweigerung und die Ergebnisse der empirischen Untersuchung.
Wer sind die Umgangsberechtigten im Kontext von Trennung und Scheidung?
Das Kapitel 2 beleuchtet den Kreis der Umgangsberechtigten. Es differenziert zwischen rechtlichem Vater, sozialem Vater und biologischem Vater und diskutiert die damit verbundenen rechtlichen Implikationen.
Welche Motive liegen mütterlicher Umgangsverweigerung zugrunde?
Kapitel 3 analysiert die Gründe für mütterliche Umgangsverweigerung. Es unterscheidet zwischen kindorientierten Motiven (z.B. Schutz des Kindes vor Konflikten) und kindfremden Motiven (z.B. Rachegelüste, Bindungsintoleranz).
Wie wird Umgangsvereitelung umgesetzt und welche Folgen hat sie für das Kindeswohl?
Kapitel 3 beschreibt verschiedene Strategien der Umgangsvereitelung und untersucht deren Beziehung zum Kindeswohl. Es werden die Eingriffsschwelle und Interventionsmöglichkeiten diskutiert.
Welche Folgen hat Umgangsverweigerung für die betroffenen Kinder?
Kapitel 4 untersucht die direkten (psychische, physische, seelische und soziale Auswirkungen) und indirekten Folgen (z.B. Bindungsstörungen) der Umgangsverweigerung für die Kinder. Loyalitätskonflikte, Schuldgefühle und die fehlende Vaterrolle werden detailliert beschrieben.
Wie wurde die empirische Untersuchung durchgeführt?
Kapitel 6 beschreibt die Durchführung der empirischen Untersuchung. Es werden der Fragebogen, die Auswahl der Teilnehmer, der Erhebungsort, die Entwicklung des Fragebogens, die Durchführung der Erhebung und die Ergebnisse detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Umgangsverweigerung, Umgangsvereitelung, Kindeswohl, Trennung, Scheidung, psychische Auswirkungen, physische Auswirkungen, soziale Auswirkungen, Vater-Kind-Beziehung, Bindungsstörung, empirische Studie, Fragebogen, quantitative Sozialforschung.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Eine Zusammenfassung der Kapitel 1-4 befindet sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel".
Details
- Titel
- Mütterliche Umgangsverweigerung zwischen Vater und Kind nach einer Trennung. Auswirkungen auf betroffene Kinder
- Note
- 1,0
- Autor
- Laura Schäfer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 112
- Katalognummer
- V1000519
- ISBN (eBook)
- 9783346389268
- ISBN (Buch)
- 9783346389275
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- mütterliche umgangsverweigerung vater kind trennung auswirkungen kinder
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Laura Schäfer (Autor:in), 2017, Mütterliche Umgangsverweigerung zwischen Vater und Kind nach einer Trennung. Auswirkungen auf betroffene Kinder, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1000519
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









