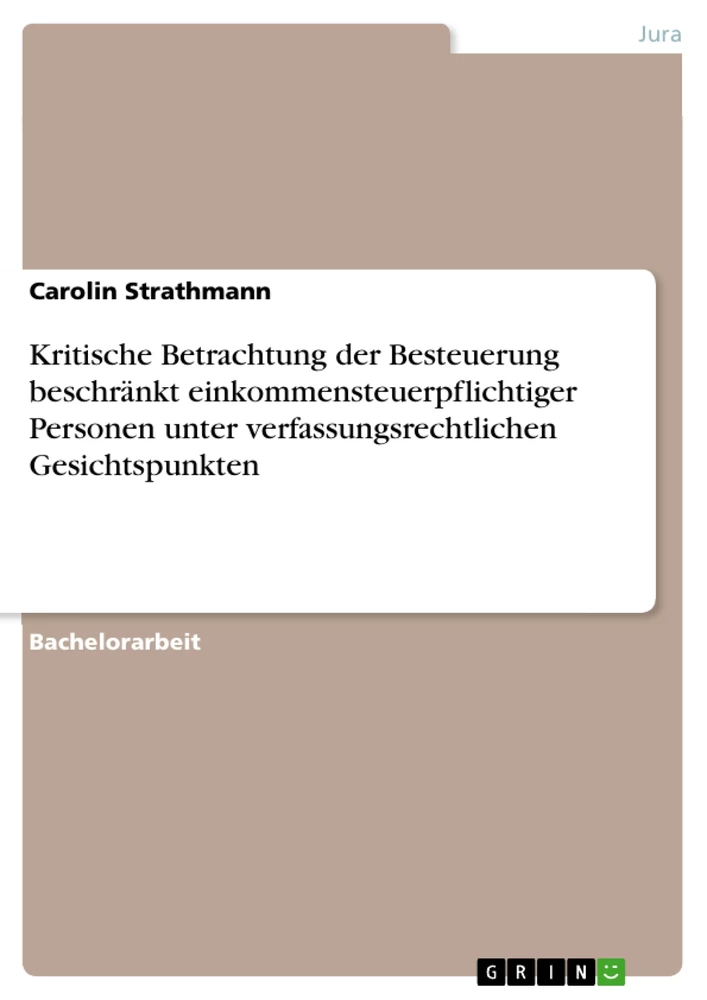
Kritische Betrachtung der Besteuerung beschränkt einkommensteuerpflichtiger Personen unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten
Bachelorarbeit, 2020
59 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Relevanz des Themas
- Zielsetzung der Arbeit
- Methodische Vorgehensweise
- Grundlagen der beschränkten Einkommensteuerpflicht
- Beschränkte Steuerpflicht
- Besteuerung
- Verfassungsrecht
- Kein Wohnsitz im Inland
- Kein gewöhnlicher Aufenthalt im Inland
- Inländische Einkünfte
- Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
- Einkünfte aus Gewerbebetrieb
- Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit
- Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
- Sonstige Einkünfte
- Besteuerungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger
- Steuerabzugsverfahren nach § 50a EStG
- Abgeltender Steuerabzug
- Bruttobesteuerung
- Nettobesteuerung
- Veranlagungsverfahren nach § 50 EStG
- Aufhebung der Abgeltungswirkung
- Ausgenommene Vorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
- Besonderheiten bei Arbeitnehmern
- Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer im Vergleich
- Anwendung bei unbeschränkt Steuerpflichtigen
- Anwendung bei beschränkt Steuerpflichtigen
- Kritische Betrachtung der Verfassungskonformität der Besteuerungsverfahren
- Im Hinblick auf das Veranlagungsverfahren
- Hinzurechnung des Grundfreibetrags
- Objektsteuerähnlicher Charakter
- Ausnahmen bei Arbeitnehmern
- Im Hinblick auf das Steuerabzugsverfahren
- Zweifelsfragen beim Steuerabzug
- Die unionsrechtliche Mitteilungsoption
- Privilegierung von EU-/EWR-Staatsangehörigen
- Schlussbetrachtung
- Zusammenfassende Würdigung
- Kritische Betrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Besteuerung von beschränkt Steuerpflichtigen in Deutschland. Das Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen der beschränkten Steuerpflicht im Einkommensteuergesetz (EStG) und deren Anwendung in der Praxis zu analysieren.
- Rechtliche Grundlagen der beschränkten Steuerpflicht im EStG
- Besteuerung von Inländern und Ausländern mit beschränkter Steuerpflicht
- Verfahren der Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger
- Verfassungskonformität der Besteuerungsverfahren
- Privilegierung von EU-/EWR-Staatsangehörigen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas und die Zielsetzung der Arbeit dar. Außerdem wird die methodische Vorgehensweise erläutert.
- Kapitel 2 befasst sich mit den Grundlagen der beschränkten Einkommensteuerpflicht im EStG. Hierbei werden die rechtlichen Voraussetzungen, die verschiedenen Einkunftsarten sowie die verfassungsrechtlichen Aspekte beleuchtet.
- Kapitel 3 behandelt die Besteuerungsverfahren von beschränkt Steuerpflichtigen. Es wird das Steuerabzugsverfahren nach § 50a EStG und das Veranlagungsverfahren nach § 50 EStG analysiert. Außerdem werden Besonderheiten bei Arbeitnehmern mit beschränkter Steuerpflicht erläutert.
- Kapitel 4 widmet sich der kritischen Betrachtung der Verfassungskonformität der Besteuerungsverfahren. Hierbei werden die Hinzurechnung des Grundfreibetrags, der objektsteuerähnliche Charakter des Veranlagungsverfahrens sowie Ausnahmen für Arbeitnehmer diskutiert.
- Kapitel 5 befasst sich mit der Privilegierung von EU-/EWR-Staatsangehörigen und bietet eine zusammenfassende Würdigung der Arbeit.
Schlüsselwörter
Beschränkte Steuerpflicht, Einkommensteuergesetz, Besteuerung, Verfassungsrecht, Steuerabzugsverfahren, Veranlagungsverfahren, Arbeitnehmer, EU-/EWR-Staatsangehörige.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der beschränkten Einkommensteuerpflicht?
Die beschränkte Einkommensteuerpflicht gemäß § 1 Abs. 4 EStG betrifft natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, aber inländische Einkünfte im Sinne des § 49 EStG erzielen.
Welche Einkunftsarten unterliegen der beschränkten Steuerpflicht?
Dazu gehören unter anderem Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger und nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen sowie Vermietung und Verpachtung, sofern sie einen Inlandsbezug aufweisen.
Was ist der Unterschied zwischen dem Veranlagungsverfahren und dem Steuerabzugsverfahren?
Das Veranlagungsverfahren nach § 50 EStG erfolgt durch Steuererklärung, während das Steuerabzugsverfahren nach § 50a EStG eine Quellensteuer darstellt, die oft abgeltende Wirkung hat und direkt vom Vergütungsschuldner einbehalten wird.
Warum wird die Hinzurechnung des Grundfreibetrags bei beschränkt Steuerpflichtigen kritisch gesehen?
Die Kritik richtet sich gegen die potenzielle Verfassungswidrigkeit, da beschränkt Steuerpflichtigen oft persönliche Begünstigungen wie der Grundfreibetrag versagt werden, was zu einer höheren Steuerlast im Vergleich zu unbeschränkt Steuerpflichtigen führen kann.
Welche Besonderheiten gelten für EU- und EWR-Staatsangehörige?
Aufgrund des Unionsrechts genießen Staatsangehörige aus EU- und EWR-Staaten unter bestimmten Voraussetzungen Privilegierungen, um Diskriminierungen innerhalb des Binnenmarktes zu vermeiden.
Was bedeutet der "objektsteuerähnliche Charakter" der Besteuerung?
Dies bezieht sich darauf, dass bei beschränkt Steuerpflichtigen primär das im Inland erzielte Objekt (die Einkunftsquelle) besteuert wird, ohne die persönlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen umfassend zu berücksichtigen.
Details
- Titel
- Kritische Betrachtung der Besteuerung beschränkt einkommensteuerpflichtiger Personen unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten
- Hochschule
- FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Dortmund früher Fachhochschule
- Note
- 1,3
- Autor
- Carolin Strathmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V1002038
- ISBN (eBook)
- 9783346380357
- ISBN (Buch)
- 9783346380364
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- kritische betrachtung besteuerung personen gesichtspunkten
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Carolin Strathmann (Autor:in), 2020, Kritische Betrachtung der Besteuerung beschränkt einkommensteuerpflichtiger Personen unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1002038
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









