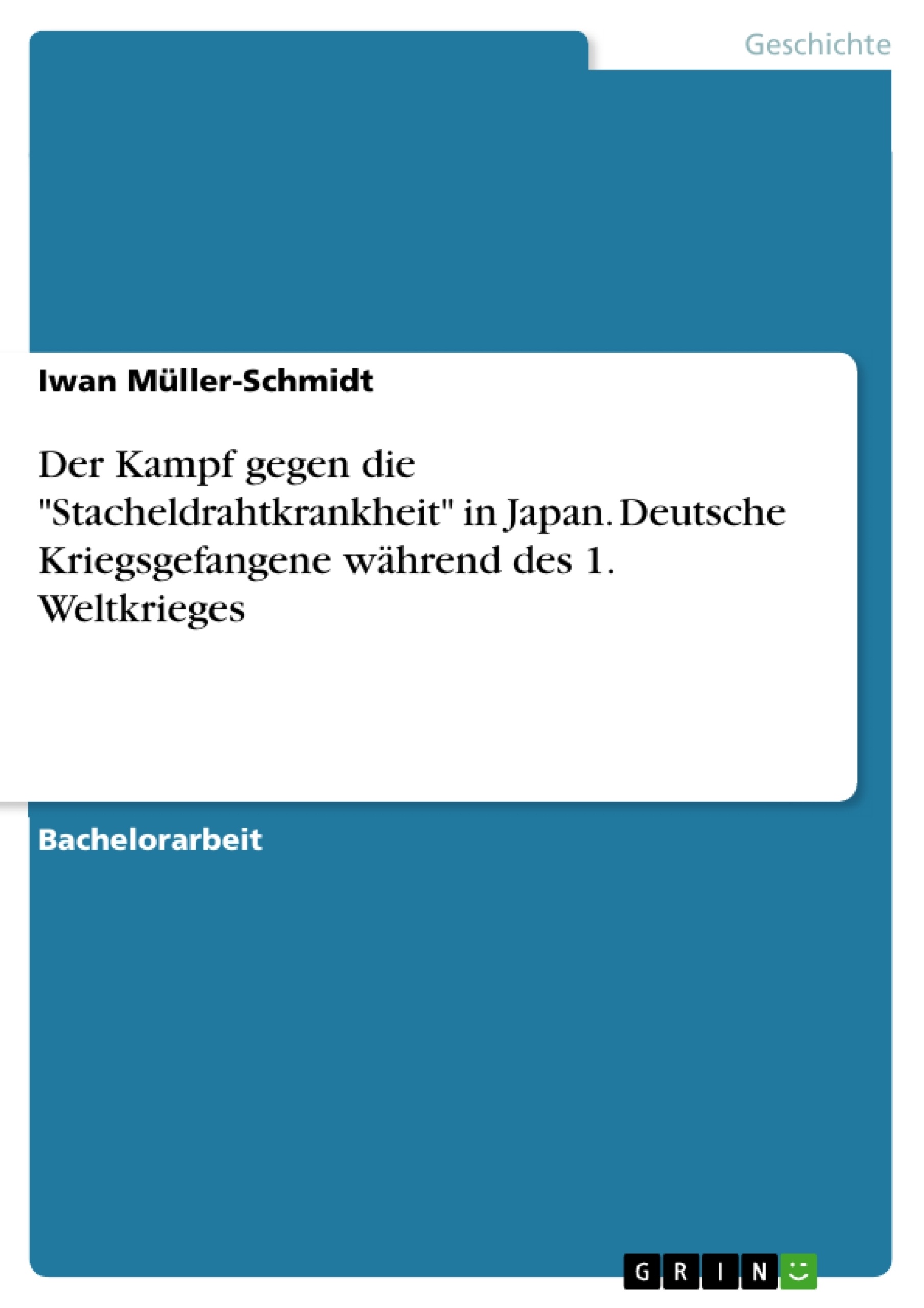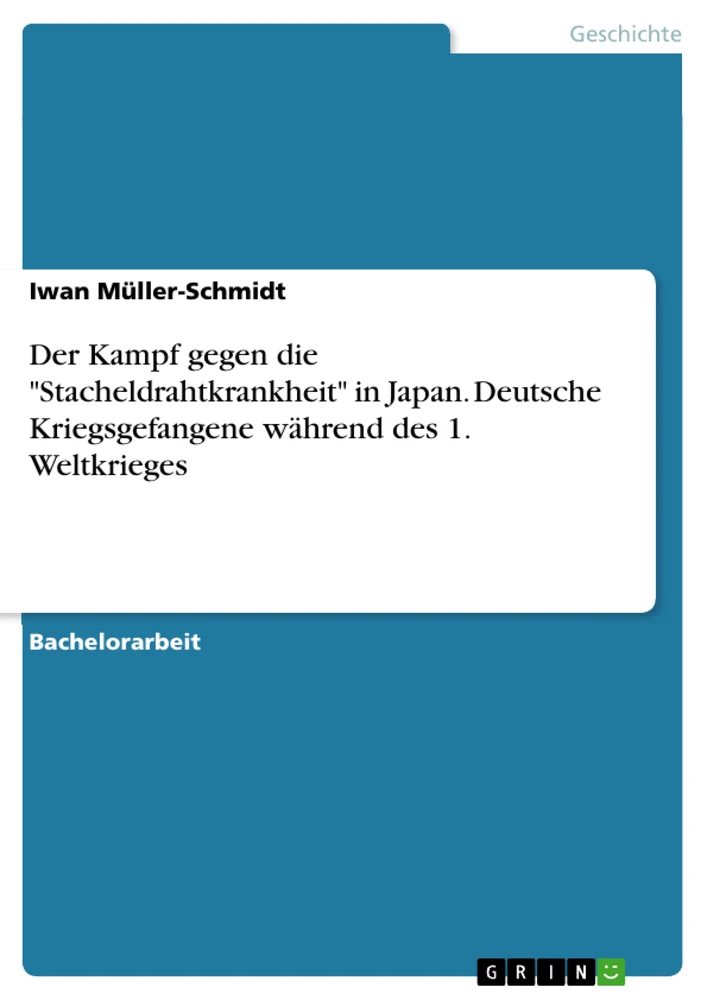
Der Kampf gegen die "Stacheldrahtkrankheit" in Japan. Deutsche Kriegsgefangene während des 1. Weltkrieges
Bachelorarbeit, 2020
72 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Die Gefangennahme der deutschen Garnison in Tsingtau
- 1.2 Verdammt zur Stacheldrahtkrankheit in japanischen Lagern?
- 1.3 Weitere Fragestellungen, Ziel, Eingrenzung und Methodik
- 2 Die Stacheldrahtkrankheit als weltweites Phänomen im 1. Weltkrieg
- 2.1 Psychische Reaktionsform oder Krankheit?
- 2.2 Grundlegung durch den Schweizer Mediziner Adolf Lukas Vischer
- 2.3 Weitere Erkenntnisse über die Stacheldrahtkrankheit
- 2.4 Der Kampf der deutschen Soldaten in Japan um Lebenselixiere
- 3 Die Kriegsgefangenschaft deutscher Soldaten in Japan als Sonderfall
- 3.1 Historische und politische Hintergründe
- 3.2 Gute Behandlung der Tsingtau-Soldaten: Gründe und Auswirkungen
- 3.2.1 Die Qualität der Behandlung deutscher Soldaten im Vergleich
- 3.2.2 Gründe für die gute Behandlung der deutschen Soldaten in Japan
- 3.2.3 Auswirkungen der guten Behandlung auf die Stacheldrahtkrankheit
- 4 Kampf gegen die Stacheldrahtkrankheit in Japan: Kommentierte Fälle
- 4.1 Mit dem Schicksal hadern? Bericht des Offiziers Freiherr v. Kuhn
- 4.2 Turner bleiben gesund: Bericht des Turnlehrers Engler
- 4.3 Der Offizier v. Kuhn und der Turnlehrer Engler als Gegentypen
- 4.4 Der Faktor „Zeit“ beim Kampf gegen die Stacheldrahtkrankheit
- 4.5 Strukturierung der Zeit durch sportliche und kulturelle Aktivitäten
- 4.6 Arbeit und ihre Auswirkungen auf die Psyche der Kriegsgefangenen
- 4.6.1 Verminderung der Bedrohung durch die Stacheldrahtkrankheit
- 4.6.2 Zwangsarbeit für deutsche Kriegsgefangene?
- 4.6.3 Anfälligkeit „arbeitsloser“ Offiziere für die Stacheldrahtkrankheit
- 4.6.3.1 Relevanz der Arbeit als Gegenmittel zur Monotonie des Alltags
- 4.6.3.2 Probleme mangelnder Gegenwarts- und Zukunftsbezogenheit
- 4.6.3.3 Ermöglichung von Arbeit als Bestandteil guter Behandlung
- 4.7 Radikale Lösungen des Problems der Stacheldrahtkrankheit
- 4.7.1 Flucht in die Freiheit
- 4.7.2 Vorzeitige und endgültige Entlassung
- 4.7.3 Tod und Selbstmord
- 4.8 Entfaltung von Männlichkeit nach „doppelter Entmannung“
- 4.8.1 Hegemoniale Maskulinität und Fragilität der Männlichkeit
- 4.8.2 Moralische Überlegenheit trotz angekratzter Männlichkeit?
- 4.8.3 Die Männlichkeit des in der Männerwelt eingeschlossenen Mannes
- 4.8.3.1 Dauerhaft fehlender Kontakt zur Damenwelt als Risikofaktor
- 4.8.3.2 Liebesbeziehungen zwischen deutschen Soldaten und Japanerinnen
- 4.8.3.3 Homosexualität unter deutschen Kriegsgefangenen in Japan?
- 4.9 Die Bedeutung von Spiel und Sport: Bericht Ernst v. Raussendorffs
- 4.10 Kompensation verlorener Männlichkeit durch Turnen und Sport
- 4.10.1 Verklammerung von Krieg, Männlichkeit und Sport
- 4.10.2 Turnen und Sport als Garant für Gesundheit und Männlichkeit
- 4.10.3 Die besondere Rolle des Fußballspiels
- 4.10.4 Sportbegegnungen mit der einheimischen Bevölkerung
- 4.11 Bedeutung des Theaters für das Wohlbefinden der Kriegsgefangenen
- 4.11.1 Theater hinter Stacheldraht als Bestandteil der Lagerkultur
- 4.11.2 Kompensatorische Rolle des „Theaters ohne Frau“?
- 4.11.3 Theateraufführungen als Medium der Begegnung mit Japanern
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erfahrungen deutscher Kriegsgefangener in Japan während des Ersten Weltkriegs (1914-1920) mit besonderem Fokus auf den Umgang mit der „Stacheldrahtkrankheit“. Ziel ist es, die spezifischen Bedingungen der Gefangenschaft in Japan zu analysieren und ihren Einfluss auf die psychische Gesundheit der Soldaten zu beleuchten. Dabei werden Vergleichsaspekte zu anderen Kriegsgefangenenlagern berücksichtigt.
- Die „Stacheldrahtkrankheit“ als psychische Reaktion auf die Kriegsgefangenschaft
- Die besonderen Bedingungen der Kriegsgefangenschaft in japanischen Lagern
- Der Einfluss von Arbeit, Sport und Kultur auf das psychische Wohlbefinden
- Die Rolle von Männlichkeit und deren Bewältigung in der Gefangenschaft
- Vergleichende Analyse der Behandlung deutscher Kriegsgefangener im internationalen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, indem es die Gefangennahme der deutschen Garnison in Tsingtau im Kontext des Deutsch-Japanischen Krieges beschreibt. Es thematisiert die unklaren Schicksale der deutschen Soldaten nach der Gefangennahme und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Umgang mit der „Stacheldrahtkrankheit“ in den japanischen Lagern. Die methodische Vorgehensweise und die Forschungsziele werden dargelegt. Der Bezug auf die japanische und internationale Forschung wird hergestellt und zeigt die Lücken in der bisherigen Forschung auf.
2 Die Stacheldrahtkrankheit als weltweites Phänomen im 1. Weltkrieg: Dieses Kapitel beleuchtet die „Stacheldrahtkrankheit“ als weitverbreitetes Phänomen in den Kriegsgefangenenlagern des Ersten Weltkriegs. Es untersucht die Definition der Krankheit als psychische Reaktion, ihren Ursprung und die Erkenntnisse der Forschung dazu. Der Fokus liegt auf der Arbeit des Schweizer Mediziners Adolf Lukas Vischer und seinen wegweisenden Arbeiten zur Thematik. Schließlich werden die Strategien der deutschen Soldaten in Japan im Kampf gegen die Krankheit vorgestellt.
3 Die Kriegsgefangenschaft deutscher Soldaten in Japan als Sonderfall: Dieses Kapitel analysiert die besondere Situation der deutschen Kriegsgefangenen in Japan. Es beleuchtet die historischen und politischen Hintergründe und vergleicht die Behandlung der deutschen Soldaten mit der in anderen Lagern. Die Gründe für die relativ gute Behandlung werden untersucht, sowie deren Auswirkungen auf die Prävalenz der „Stacheldrahtkrankheit“. Das Kapitel kontextualisiert die Lage der Kriegsgefangenen innerhalb des größeren Geschehens des Ersten Weltkriegs.
4 Kampf gegen die Stacheldrahtkrankheit in Japan: Kommentierte Fälle: Dieses Kapitel präsentiert Fallstudien, um den Umgang der deutschen Kriegsgefangenen mit der „Stacheldrahtkrankheit“ zu veranschaulichen. Anhand von konkreten Beispielen werden verschiedene Strategien der Bewältigung der Gefangenschaft analysiert, wie die Organisation von Sport, Theater und Arbeit, sowie der Umgang mit existentiellen Fragen wie Flucht, Entlassung und Tod. Es werden verschiedene Männertypen in ihrer Auseinandersetzung mit der Gefangenschaft und den Folgen der „Entmannung“ durch den Krieg und die Gefangenschaft im Detail untersucht.
Schlüsselwörter
Stacheldrahtkrankheit, Erster Weltkrieg, Kriegsgefangenschaft, Japan, Deutschland, Tsingtau, psychische Gesundheit, Männlichkeit, Sport, Theater, Arbeit, Fallstudien, Vergleichende Analyse, historischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Erfahrung deutscher Kriegsgefangener in Japan während des Ersten Weltkriegs und der Umgang mit der 'Stacheldrahtkrankheit'"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Erfahrungen deutscher Kriegsgefangener in Japan während des Ersten Weltkriegs (1914-1920), mit besonderem Fokus auf die "Stacheldrahtkrankheit". Sie analysiert die spezifischen Bedingungen der Gefangenschaft in Japan und deren Einfluss auf die psychische Gesundheit der Soldaten im Vergleich zu anderen Kriegsgefangenenlagern.
Was ist die "Stacheldrahtkrankheit"?
Die "Stacheldrahtkrankheit" wird in der Arbeit als weitverbreitetes psychisches Leiden in den Kriegsgefangenenlagern des Ersten Weltkriegs beschrieben. Sie wird als Reaktion auf die Gefangenschaft definiert und ihre Entstehung, sowie die Forschungsergebnisse dazu, werden im Detail behandelt. Die Arbeit bezieht sich insbesondere auf die Arbeiten des Schweizer Mediziners Adolf Lukas Vischer.
Welche Aspekte der Kriegsgefangenschaft in Japan werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die besonderen Bedingungen der Kriegsgefangenschaft in japanischen Lagern, einschließlich der historischen und politischen Hintergründe. Sie vergleicht die Behandlung der deutschen Soldaten mit der in anderen Lagern und untersucht die Gründe für die relativ gute Behandlung in Japan sowie deren Auswirkungen auf die "Stacheldrahtkrankheit".
Welche Rolle spielen Arbeit, Sport und Kultur in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Arbeit, Sport und Kultur auf das psychische Wohlbefinden der Kriegsgefangenen. Anhand von Fallstudien werden verschiedene Bewältigungsstrategien analysiert, darunter die Organisation von Sport, Theater und Arbeit sowie der Umgang mit existentiellen Fragen wie Flucht, Entlassung und Tod.
Welche Rolle spielt das Thema Männlichkeit in dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Rolle von Männlichkeit und deren Bewältigung in der Gefangenschaft. Sie untersucht verschiedene Männertypen in ihrer Auseinandersetzung mit der Gefangenschaft und den Folgen der "Entmannung" durch Krieg und Gefangenschaft. Aspekte wie die Bedeutung von Sport und Theater für die Aufrechterhaltung der Männlichkeit werden beleuchtet.
Welche Methoden werden in dieser Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse, um die Erfahrungen der deutschen Kriegsgefangenen in Japan mit denen in anderen Lagern zu vergleichen. Sie stützt sich auf Fallstudien, um den Umgang der Kriegsgefangenen mit der "Stacheldrahtkrankheit" zu veranschaulichen. Die Arbeit bezieht sich auf die japanische und internationale Forschung und zeigt Lücken in der bisherigen Forschung auf.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst fünf Kapitel: 1. Einleitung; 2. Die Stacheldrahtkrankheit als weltweites Phänomen; 3. Die Kriegsgefangenschaft in Japan als Sonderfall; 4. Kampf gegen die Stacheldrahtkrankheit: Kommentierte Fälle; 5. Fazit. Kapitel 4 analysiert detailliert verschiedene Fallstudien, die den Umgang mit der Krankheit und der Gefangenschaft veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stacheldrahtkrankheit, Erster Weltkrieg, Kriegsgefangenschaft, Japan, Deutschland, Tsingtau, psychische Gesundheit, Männlichkeit, Sport, Theater, Arbeit, Fallstudien, Vergleichende Analyse, historischer Kontext.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Inhaltsverzeichnis im HTML-Dokument bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel der Arbeit. Die Zusammenfassung der Kapitel liefert eine prägnante Übersicht über die Inhalte der einzelnen Abschnitte.
Details
- Titel
- Der Kampf gegen die "Stacheldrahtkrankheit" in Japan. Deutsche Kriegsgefangene während des 1. Weltkrieges
- Hochschule
- FernUniversität Hagen (Institut für Geschiche und Biographie)
- Veranstaltung
- Abschlussarbeit
- Note
- 1,3
- Autor
- Iwan Müller-Schmidt (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 72
- Katalognummer
- V1006179
- ISBN (eBook)
- 9783346393760
- ISBN (Buch)
- 9783346393777
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 25,99
- Arbeit zitieren
- Iwan Müller-Schmidt (Autor:in), 2020, Der Kampf gegen die "Stacheldrahtkrankheit" in Japan. Deutsche Kriegsgefangene während des 1. Weltkrieges, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1006179
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-