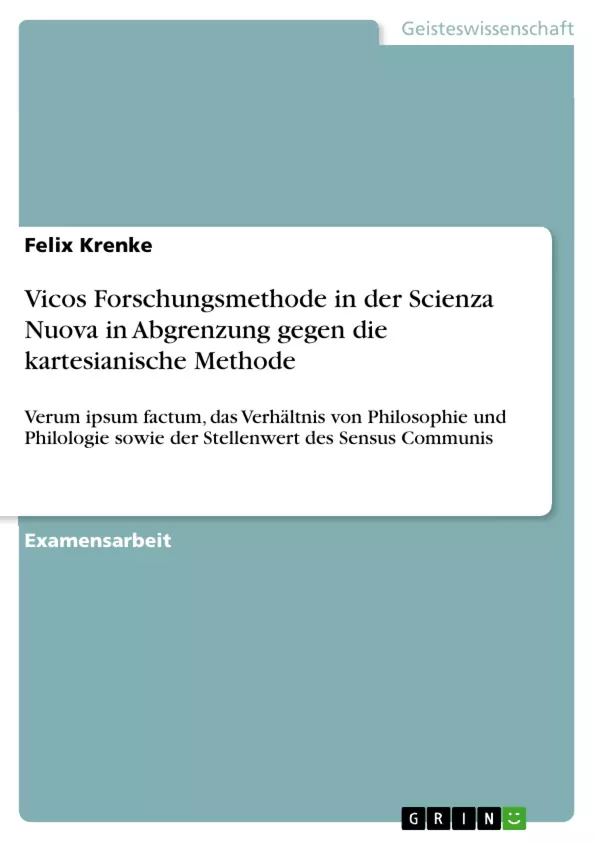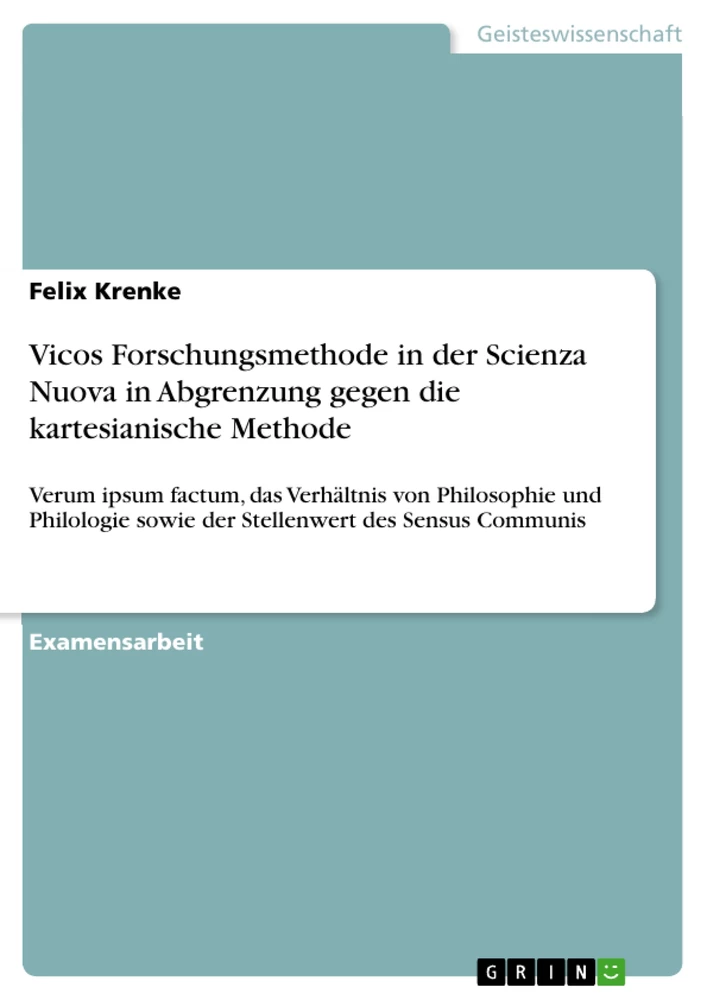
Vicos Forschungsmethode in der Scienza Nuova in Abgrenzung gegen die kartesianische Methode
Examensarbeit, 2019
18 Seiten, Note: 1,3
Philosophie - Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft, Logik, Sprache)
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Descartes
- Die kritische Methode
- Descartes' Wahrheitsbegriff
- Vico und die weltenschaffende Kreativität
- Poesie
- Topik versus Kritik
- Topica sensibile
- Philologie und Philosophie
- Verum ipsum factum
- Sensus Communis
- Poesie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der revolutionären Forschungsmethode von Giambattista Vico in seiner „Neuen Wissenschaft“ und stellt sie der kartesianischen Methode gegenüber. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung von Vicos Methode und der Abgrenzung zu Descartes' kritischem Ansatz, insbesondere im Hinblick auf Vicos Kernkonzepte: Topik, Verum ipsum factum und die Beziehung zwischen Philosophie und Philologie.
- Gegenüberstellung von Vicos und Descartes' Forschungsmethoden
- Analyse von Vicos Kernkonzepten: Topik, Verum ipsum factum
- Bedeutung des Verhältnisses von Philosophie und Philologie in Vicos Werk
- Vicos Kritik am kartesianischen Rationalismus und dessen Auswirkungen auf die Bildung
- Die Rolle der Fantasie und des Gedächtnisses in Vicos Geschichtsphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in Vicos „Neue Wissenschaft“ ein und stellt die Pintura als Schlüssel zum Verständnis des Werkes vor. Vicos Methode wird als Gegensatz zur kartesianischen Methode dargestellt, die den Stellenwert von Gedächtnis, Fantasie und Scharfsinn beim Erkenntnisgewinn betont. Die Arbeit soll die viccianische Methode anhand ausgewählter Passagen aus Vicos Frühwerken analysieren und den Anlass für seine philosophische Arbeit – die Ablehnung der kartesianischen Methode – aufzeigen.
- Descartes: Dieses Kapitel widmet sich Descartes' kritischer Methode und seinem Wahrheitsbegriff. Descartes' Suche nach unbedingtem, gesichertem Wissen führt ihn zur Abwertung der Wahrnehmung und der Betonung des Verstandes- und Vernunftdenkens. Er sieht in der Sinnlichkeit eine Quelle von Irreführung und setzt auf den Rückzug in die absolute Einsamkeit, um zu gesicherten Erkenntnissen zu gelangen. Descartes' Wahrheitsbegriff basiert auf der Gewissheit und Unbezweifelbarkeit und beinhaltet eine starke Skepsis gegenüber den traditionellen Erkenntniszugängen wie Sensus, Imaginatio und Intellectus/Ratio.
- Vico und die weltenschaffende Kreativität: Dieses Kapitel beleuchtet Vicos Konzept der Poesie als Ursprung der Kultur und der Erkenntnis. Vico stellt die Topik, eine Methode der Wahrscheinlichkeit, der kartesianischen Kritik gegenüber und betont die Bedeutung der „Topica sensibile“ – der Fähigkeit, sinnliche Eindrücke zu erfassen und zu interpretieren. Es wird außerdem das Verhältnis von Philosophie und Philologie sowie das Konzept des „Verum ipsum factum“ behandelt, welches besagt, dass die Wahrheit von der menschlichen Erfahrung und der Geschichte geschaffen wird. Vico kritisiert die kartesianische Methode als unfähig, die Komplexität der menschlichen Kultur und Geschichte zu erfassen und setzt auf die Einbeziehung von Erinnerung, Fantasie und Scharfsinn, um ein tieferes Verständnis der menschlichen Welt zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die folgenden Schlüsselbegriffe: Giambattista Vico, Neue Wissenschaft, Descartes, kartesianische Methode, kritische Methode, Topik, Verum ipsum factum, Philosophie, Philologie, Sensus Communis, Phantasie, Gedächtnis, Erkenntnis, Geschichte, Kultur, menschliche Erfahrung.
Details
- Titel
- Vicos Forschungsmethode in der Scienza Nuova in Abgrenzung gegen die kartesianische Methode
- Untertitel
- Verum ipsum factum, das Verhältnis von Philosophie und Philologie sowie der Stellenwert des Sensus Communis
- Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Philosophy)
- Veranstaltung
- Giambattista Vico
- Note
- 1,3
- Autor
- Felix Krenke (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 18
- Katalognummer
- V1007982
- ISBN (eBook)
- 9783346395641
- ISBN (Buch)
- 9783346395658
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- vicos forschungsmethode scienza nuova abgrenzung methode verum verhältnis philosophie philologie stellenwert sensus communis
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 14,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Felix Krenke (Autor:in), 2019, Vicos Forschungsmethode in der Scienza Nuova in Abgrenzung gegen die kartesianische Methode, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1007982
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-