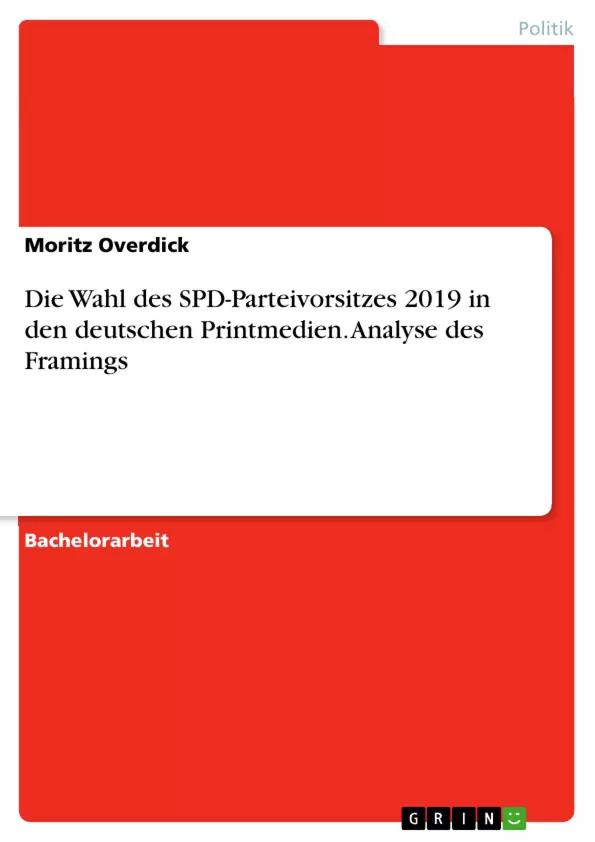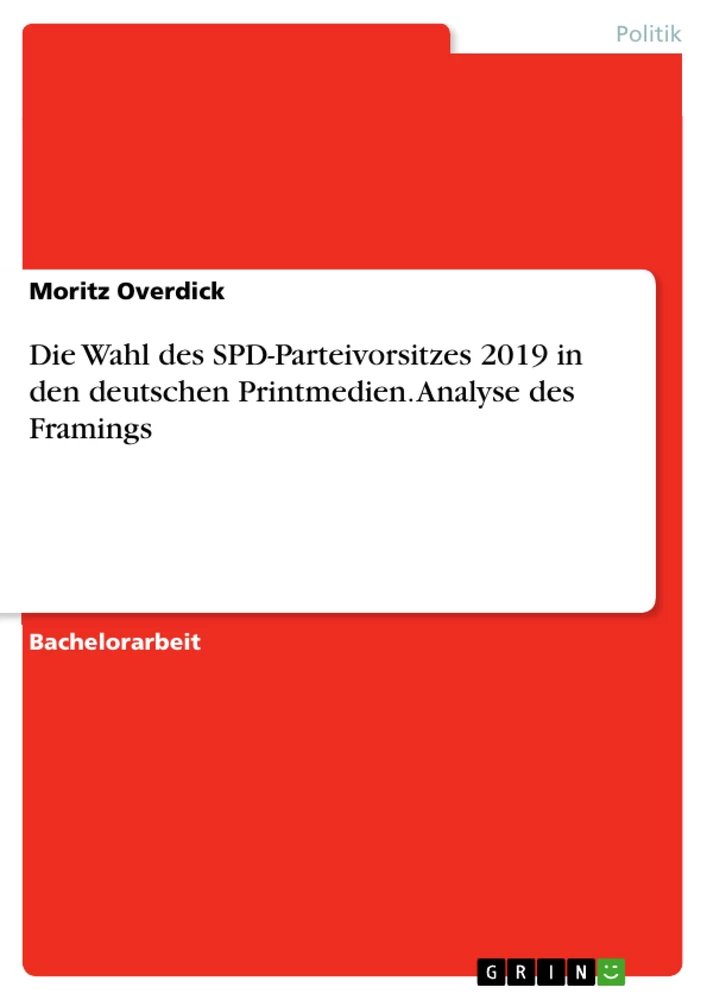
Die Wahl des SPD-Parteivorsitzes 2019 in den deutschen Printmedien. Analyse des Framings
Bachelorarbeit, 2020
48 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlage
- 2.1 Die Krise der SPD
- 2.2 Grundannahmen von Framing und Frames
- 2.3 Medienframes
- 3 Forschungsstand
- 4 Definition der Frames und Herleitung der Hypothesen
- 5 Methodisches Vorgehen
- 5.1 Automatisierte Textanalyse mit R-Studio
- 5.2 Datenakquise über NexisUni
- 5.3 Erstellen der Datenbasis in R-Studio
- 5.4 Frequenzanalyse als erster Analyseschritt
- 5.5 Berechnung der Kookkurrenzen zur Analyse der Medien-Frames
- 6 Durchführung der Frequenzanalyse
- 6.1 Absolute Publikationen von Artikeln in taz und Welt
- 6.2 Meistgenannte Wörter in taz, die Tageszeitung und Die Welt
- 7 Berechnung der Kookkurrenzen
- 7.1 Kookkurrenzanalyse SPD-Frame
- 7.2 Kookkurrenzanalyse mit dem Parteivorsitz-Frame
- 7.3 Kookkurrenzanalyse mit dem Regionalkonferenz-Frame
- 8 Diskussion der Ergebnisse
- 9 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht, wie die Wahl des SPD-Parteivorsitzes im Jahr 2019 von drei deutschen Printmedien - taz, die Tageszeitung und Die Welt - dargestellt wurde. Mittels einer computerbasierten Inhaltsanalyse wird das Framing dieser Medien in Bezug auf die Diskussion um den SPD-Parteivorsitz analysiert. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Zeitspanne vom 24.06.2019 bis 31.12.2019.
- Analyse des Medienframings in Bezug auf die Wahl des SPD-Parteivorsitzes
- Untersuchung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Berichterstattung der drei ausgewählten Medien
- Einordnung der Wahl in den Kontext der Krise der SPD
- Anwendung des Framing-Ansatzes zur Interpretation der Medienberichterstattung
- Verwendung von computergestützten Methoden zur Analyse von Textdaten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert den Kontext der Wahl des SPD-Parteivorsitzes 2019. Es werden die Hintergründe der Krise der SPD und die Besonderheiten der Wahl beschrieben, die sie von anderen Vorsitzwahlen der Vergangenheit abhebt. Die Forschungsfrage wird formuliert, die sich auf die Analyse des Medienframings der Wahl konzentriert.
Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit dargelegt. Es werden die Ursachen der Krise der SPD beleuchtet und verschiedene Ansätze zur Erklärung der Krise dargestellt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Partei in den letzten 50 Jahren. Anschließend werden die Grundannahmen von Framing und Frames sowie deren Anwendung im Bereich der Medienforschung erläutert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem aktuellen Forschungsstand zum Thema Medienframing und der Krise der SPD. Es werden relevante wissenschaftliche Publikationen und Studien vorgestellt, die die Grundlage für die Analyse der Wahl des SPD-Parteivorsitzes bilden. Der Fokus liegt dabei auf Studien, die sich mit Medienframing und der Berichterstattung über politische Ereignisse befassen.
Im vierten Kapitel werden die Frames, die für die Analyse der Wahl des SPD-Parteivorsitzes relevant sind, definiert und die daraus abgeleiteten Hypothesen vorgestellt. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Analyse der Medienberichterstattung im Hinblick auf die wichtigsten Themen und Narrative, die in den Medien im Zusammenhang mit der Wahl des SPD-Parteivorsitzes auftauchen.
Das fünfte Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit. Es werden die computergestützten Methoden erläutert, die für die Analyse der Medienberichterstattung eingesetzt werden. Insbesondere wird die automatisierte Textanalyse mit dem Programm R-Studio beschrieben, die für die Extraktion relevanter Informationen aus den Textdaten verwendet wird.
Das sechste Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Frequenzanalyse, die im Rahmen der automatisierten Textanalyse durchgeführt wurde. Es werden die Ergebnisse der Analyse der absoluten Publikationen von Artikeln in den drei ausgewählten Medien dargestellt, sowie die meistgenannten Wörter in den Texten der Medien.
Das siebte Kapitel befasst sich mit der Berechnung der Kookkurrenzen, die Aufschluss über die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Begriffen in den Medientexten geben. Es werden die Ergebnisse der Kookkurrenzanalyse für verschiedene Frames, wie beispielsweise den SPD-Frame, den Parteivorsitz-Frame und den Regionalkonferenz-Frame, präsentiert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit den Themen Medienframing, SPD-Krise, Wahl des Parteivorsitzes, computergestützte Inhaltsanalyse, Printmedien, taz, die Tageszeitung, Die Welt, Framing-Ansatz.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Besondere an der SPD-Vorsitzendenwahl 2019?
Es wurde ein neues Format mit Kandidatenteams und einer Mitgliederbefragung (Basisdemokratie) eingeführt, was eine Abkehr von bisherigen Verfahren darstellte.
Was untersucht die Framing-Analyse in dieser Arbeit?
Sie analysiert, aus welchen Blickwinkeln (Frames) die Zeitungen taz und Die Welt über die Wahl berichteten und welche Narrative sie dabei verwendeten.
Welche Medien wurden für die Untersuchung ausgewählt?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Printmedien „taz, die Tageszeitung“ und „Die Welt“ im Zeitraum Juni bis Dezember 2019.
Was ist der „Parteivorsitz-Frame“?
Dieser Frame umfasst die mediale Darstellung der Kandidaten, ihrer Teams und des Prozesses der Postenbesetzung innerhalb der SPD-Krise.
Wie wurde die Inhaltsanalyse methodisch durchgeführt?
Es wurde eine computerbasierte automatisierte Textanalyse mit R-Studio durchgeführt, die Frequenzen und Kookkurrenzen von Begriffen berechnete.
Details
- Titel
- Die Wahl des SPD-Parteivorsitzes 2019 in den deutschen Printmedien. Analyse des Framings
- Hochschule
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
- Note
- 1,7
- Autor
- Moritz Overdick (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V1008168
- ISBN (eBook)
- 9783346395689
- ISBN (Buch)
- 9783346395696
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- wahl spd-parteivorsitzes printmedien SPD Framing
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Moritz Overdick (Autor:in), 2020, Die Wahl des SPD-Parteivorsitzes 2019 in den deutschen Printmedien. Analyse des Framings, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1008168
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-