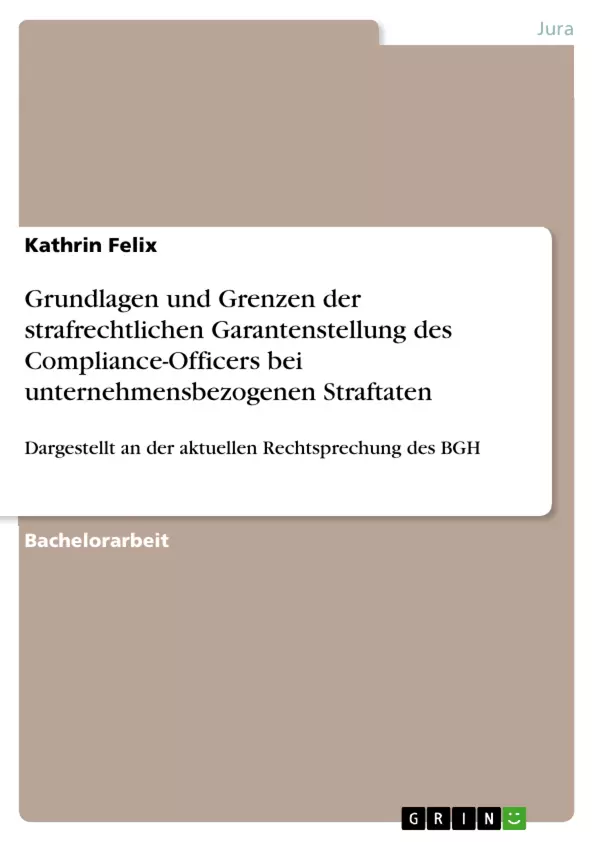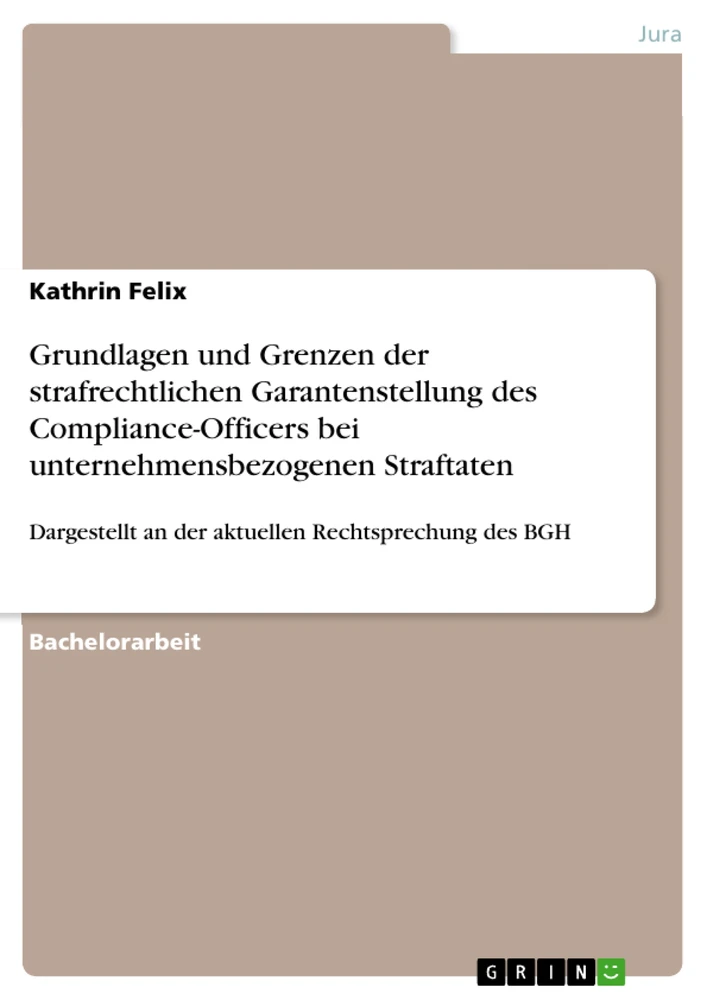
Grundlagen und Grenzen der strafrechtlichen Garantenstellung des Compliance-Officers bei unternehmensbezogenen Straftaten
Bachelorarbeit, 2021
54 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- A. Einleitung
- Problemdarstellung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- B. Compliance im Unternehmen
- Compliance-Begriff
- Compliance-Organisation
- Grundlagen
- Besonderheiten bei der Ausgestaltung
- Bestandteile
- Rechtliche Grundlagen
- Regulierte Unternehmen
- Unregulierte Unternehmen
- Tätigkeiten des Compliance-Officers
- C. Garantenstellung des Compliance-Officers
- Unechtes Unterlassungsdelikt
- Formen der Garantenstellung
- Ingerenz
- Herrschaft über Untergebene
- Herrschaft über Gefahrenquellen
- Freiwillige Übernahme Obhutspflichten
- Geschäftsherrenhaftung
- Grenzen
- Darstellung der Rechtsprechung
- Meinungsstände
- Autoritätsargument
- Gefahrenargument
- Mindermeinung
- Schlussfolgerung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
- Rechtsprechungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die strafrechtliche Garantenstellung des Compliance-Officers bei unternehmensbezogenen Straftaten. Sie analysiert, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang der Compliance-Officer aufgrund seiner Funktion zur Abwendung von Straftaten verpflichtet ist und welche rechtlichen Grenzen sich dabei ergeben.
- Compliance-Begriff und Compliance-Organisation
- Rechtliche Grundlagen der Compliance im Unternehmen
- Formen der Garantenstellung und deren Grenzen
- Aktuelle Rechtsprechung des BGH zur Garantenstellung des Compliance-Officers
- Relevanz der Garantenstellung des Compliance-Officers im Kontext von Unternehmensstrafrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problematik der strafrechtlichen Garantenstellung des Compliance-Officers. Sie erläutert den Compliance-Begriff und die Organisation von Compliance-Systemen in Unternehmen. Anschließend werden die rechtlichen Grundlagen der Compliance sowie die Tätigkeiten des Compliance-Officers dargestellt.
Kapitel C beschäftigt sich mit der Garantenstellung des Compliance-Officers. Es werden verschiedene Formen der Garantenstellung, wie Ingerenz, Herrschaft über Untergebene und die Übernahme von Obhutspflichten, untersucht. Darüber hinaus werden die Grenzen der Garantenstellung, insbesondere im Kontext der Geschäftsherrenhaftung, analysiert. Im Fokus steht dabei die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.
Schlüsselwörter
Compliance-Officer, Garantenstellung, Unternehmensstrafrecht, Unechtes Unterlassungsdelikt, Geschäftsherrenhaftung, BGH-Rechtsprechung, Compliance-Organisation, Compliance-Management, Compliance-Systeme, Rechtliche Grundlagen, Regulierung, Pflichten, Verantwortlichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Welche strafrechtliche Verantwortung trägt ein Compliance-Officer?
Ein Compliance-Officer kann eine sogenannte Garantenstellung innehaben, die ihn verpflichtet, unternehmensbezogene Straftaten aktiv zu verhindern. Unterlässt er dies, droht eine Haftung wegen unechten Unterlassens.
Was ist ein unechtes Unterlassungsdelikt im Compliance-Kontext?
Dies liegt vor, wenn eine Person eine rechtliche Pflicht (Garantenpflicht) hat, den Erfolg einer Straftat abzuwenden, dies aber nicht tut, obwohl es ihr möglich gewesen wäre.
Welche Formen der Garantenstellung gibt es?
Die Arbeit unterscheidet Formen wie Ingerenz (Vorverhalten), Herrschaft über Gefahrenquellen, freiwillige Übernahme von Obhutspflichten und die Geschäftsherrenhaftung.
Wo liegen die Grenzen der Haftung eines Compliance-Officers?
Die Grenzen werden durch die konkrete Ausgestaltung der Compliance-Organisation, die Befugnisse des Officers und die aktuelle Rechtsprechung des BGH (z.B. zur Geschäftsherrenhaftung) bestimmt.
Welchen Einfluss haben Skandale wie Wirecard auf das Compliance-Recht?
Solche Fälle rücken Wirtschaftskriminalität in den Fokus und führen zu einer Verschärfung der Anforderungen an Compliance-Management-Systeme und die Überwachungspflichten der Geschäftsführung.
Details
- Titel
- Grundlagen und Grenzen der strafrechtlichen Garantenstellung des Compliance-Officers bei unternehmensbezogenen Straftaten
- Untertitel
- Dargestellt an der aktuellen Rechtsprechung des BGH
- Hochschule
- FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt früher Fachhochschule
- Note
- 1,3
- Autor
- Kathrin Felix (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V1009913
- ISBN (eBook)
- 9783346399021
- ISBN (Buch)
- 9783346399038
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Compliance-Officer Garantenstellung unternehmensbezogene Straftaten
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Kathrin Felix (Autor:in), 2021, Grundlagen und Grenzen der strafrechtlichen Garantenstellung des Compliance-Officers bei unternehmensbezogenen Straftaten, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1009913
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-