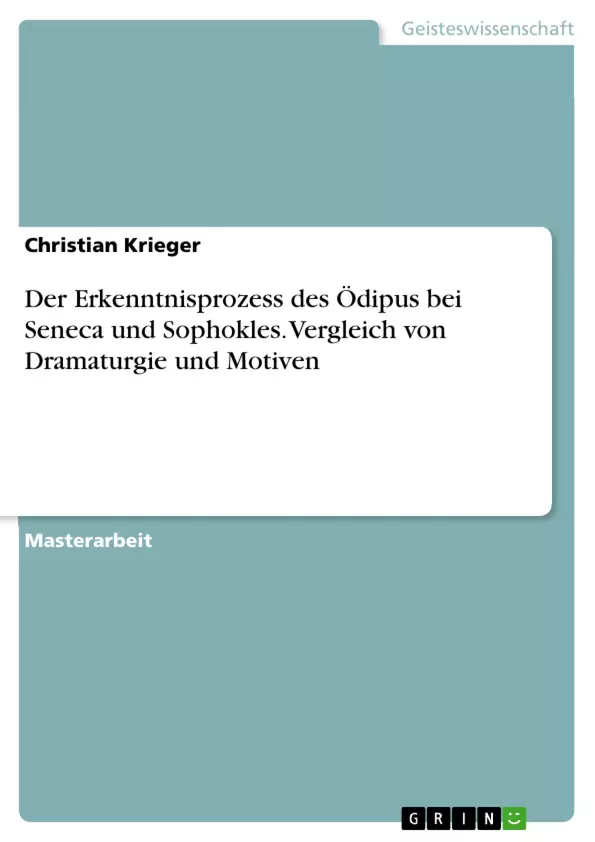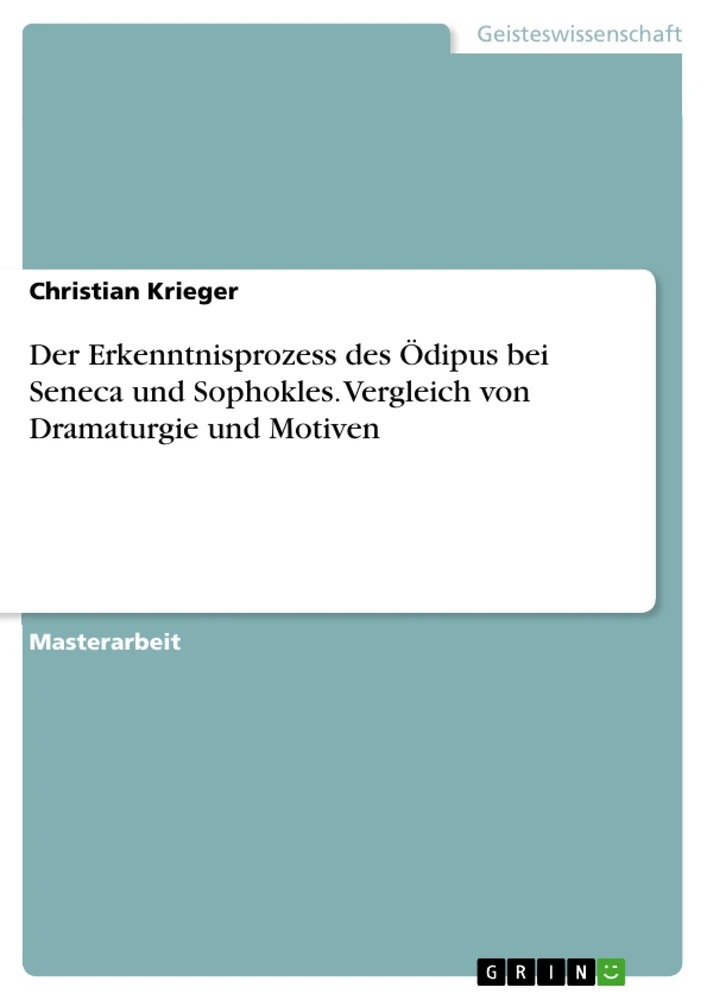
Der Erkenntnisprozess des Ödipus bei Seneca und Sophokles. Vergleich von Dramaturgie und Motiven
Masterarbeit, 2019
56 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Dramaturgie und Motive des ersten Dramenteils
- 2.1 Der Prolog
- 2.1.1 Der Prolog bei Seneca
- 2.1.2 Der Prolog bei Sophokles
- 2.2 Der Orakelspruch
- 2.2.1 Der Orakelspruch bei Seneca
- 2.2.2 Der Orakelspruch bei Sophokles
- 2.3 Die Fluchrede
- 2.3.1 Die Fluchrede bei Seneca
- 2.3.2 Die Fluchrede bei Sophokles
- 2.4 Die Tatortbeschreibung und der Auftritt des Sehers
- 2.4.1 Die Tatortbeschreibung und der Auftritt des Sehers bei Seneca
- 2.4.2 Der Auftritt des Sehers bei Sophokles
- 2.5 Das Streitgespräch mit Kreon in beiden Fassungen
- 2.1 Der Prolog
- 3. Der Weg zum Höhepunkt der Anagnorisis und die Peripetie
- 3.1 Merkmale einer guten Tragödie nach Aristoteles
- 3.2 Die Jokasteszene
- 3.3 Die Boten- und Hirtenszene
- 3.4 Peripetie und Anagnorisis bei Seneca und Sophokles
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Tragödien Ödipus von Sophokles und Seneca, um den Erkenntnisprozess des Ödipus in beiden Fassungen zu analysieren. Das Hauptziel ist es, strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Komposition von Peripetie und Anagnorisis herauszuarbeiten und die jeweilige Gestaltung des Erkenntnisprozesses zu bewerten. Die Rolle der Charakterzeichnung des Ödipus und die Entwicklung der Dramaturgie durch verschiedene Motive werden ebenfalls untersucht.
- Strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der griechischen und römischen Fassung des Ödipus.
- Entwicklung der Dramaturgie durch verschiedene Motive in beiden Tragödien.
- Konstruktion der Peripetie und Anagnorisis bei Seneca und Sophokles.
- Rolle der Charakterzeichnung des Ödipus im Erkenntnisprozess.
- Vergleich der beiden Fassungen anhand aristotelischer Kriterien der Tragödie.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Sagenstoff um Ödipus, seine Rezeption in der Literaturgeschichte und die besondere Bedeutung der Tragödien von Sophokles und Seneca. Sie beleuchtet die historische und literarische Bedeutung beider Werke und die unterschiedlichen Wertschätzungen der Seneca-Fassung im Laufe der Zeit. Der Fokus wird auf den Vergleich der beiden Tragödien im Hinblick auf Peripetie und Anagnorisis gelegt, wobei die relevanten Forschungsfragen und die methodische Vorgehensweise der Arbeit erläutert werden. Die Einleitung betont die Bedeutung der textkritischen Editionen und der heranzuziehenden Sekundärliteratur.
2. Dramaturgie und Motive des ersten Dramenteils: Dieser Abschnitt analysiert die Dramaturgie des ersten Teils beider Tragödien bis zur Jokasteszene. Der Vergleich konzentriert sich auf die Analyse von Prolog, Orakelspruch, Fluchrede und der Tatortbeschreibung sowie dem Auftritt des Sehers. Es werden die jeweils verwendeten Motive und ihre sprachliche Gestaltung untersucht, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Handlung und des Erkenntnisprozesses aufzuzeigen. Die Analyse fokussiert sich auf die unterschiedliche Gewichtung von Vatermord und Inzest in beiden Werken.
3. Der Weg zum Höhepunkt der Anagnorisis und die Peripetie: Dieser Kapitelteil untersucht den Weg zum Höhepunkt der Anagnorisis und die Peripetie in beiden Tragödien. Die Analyse umfasst die Jokasteszene, die Boten- und Hirtenszene, und gipfelt in einem direkten Vergleich der Peripetie und Anagnorisis bei Seneca und Sophokles. Der Abschnitt analysiert, wie die Autoren den Umschwung der Handlung vom Glück ins Unglück und die Wiedererkennung gestalten und welche Rolle die Charakterzeichnung des Ödipus dabei spielt. Hier wird der Bezug zu Aristoteles' Kriterien der Tragödie hergestellt.
Schlüsselwörter
Ödipus, Seneca, Sophokles, Tragödie, Anagnorisis, Peripetie, Erkenntnisprozess, Dramaturgie, Motive, Vergleichende Literaturwissenschaft, Antike, Aristoteles.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vergleich der Ödipus-Tragödien von Sophokles und Seneca
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Ödipus-Tragödien von Sophokles und Seneca, um den Erkenntnisprozess des Ödipus in beiden Fassungen zu analysieren. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Komposition von Peripetie und Anagnorisis und der Bewertung der jeweiligen Gestaltung des Erkenntnisprozesses. Die Rolle der Charakterzeichnung des Ödipus und die Entwicklung der Dramaturgie durch verschiedene Motive werden ebenfalls untersucht.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit untersucht strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der griechischen und römischen Fassung des Ödipus, die Entwicklung der Dramaturgie durch verschiedene Motive, die Konstruktion der Peripetie und Anagnorisis bei Seneca und Sophokles, die Rolle der Charakterzeichnung des Ödipus im Erkenntnisprozess und vergleicht beide Fassungen anhand aristotelischer Kriterien der Tragödie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Abschnitt zur Dramaturgie und den Motiven des ersten Dramenteils, einen Abschnitt zum Weg zum Höhepunkt der Anagnorisis und der Peripetie und ein Fazit. Der erste Teil analysiert den Prolog, den Orakelspruch, die Fluchrede, die Tatortbeschreibung und den Auftritt des Sehers in beiden Fassungen. Der zweite Teil konzentriert sich auf die Jokasteszene, die Boten- und Hirtenszene und den Vergleich der Peripetie und Anagnorisis bei Seneca und Sophokles. Die Einleitung beschreibt den Sagenstoff, die Rezeption und die methodische Vorgehensweise. Die Schlüsselwörter umfassen Ödipus, Seneca, Sophokles, Tragödie, Anagnorisis, Peripetie, Erkenntnisprozess, Dramaturgie, Motive, Vergleichende Literaturwissenschaft, Antike und Aristoteles.
Welche Aspekte der Dramaturgie werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf den Prolog, den Orakelspruch, die Fluchrede, die Tatortbeschreibung und den Auftritt des Sehers im ersten Teil der Tragödien. Im zweiten Teil werden die Jokasteszene, die Boten- und Hirtenszene, die Peripetie und die Anagnorisis analysiert und verglichen. Die unterschiedliche Gewichtung von Vatermord und Inzest in beiden Werken wird ebenfalls untersucht.
Welche Rolle spielt Aristoteles?
Die Arbeit bezieht sich auf Aristoteles' Kriterien der Tragödie, um die Gestaltung der Peripetie und Anagnorisis in beiden Fassungen zu bewerten und die jeweiligen Stärken und Schwächen zu beurteilen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf textkritischen Editionen der Ödipus-Tragödien von Sophokles und Seneca sowie auf relevanter Sekundärliteratur. Die genaue Quellenangabe erfolgt im Literaturverzeichnis (nicht in diesem FAQ enthalten).
Details
- Titel
- Der Erkenntnisprozess des Ödipus bei Seneca und Sophokles. Vergleich von Dramaturgie und Motiven
- Hochschule
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
- Note
- 1,3
- Autor
- Christian Krieger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 56
- Katalognummer
- V1033457
- ISBN (eBook)
- 9783346443625
- ISBN (Buch)
- 9783346443632
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- erkenntnisprozess ödipus seneca sophokles vergleich dramaturgie motiven
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Christian Krieger (Autor:in), 2019, Der Erkenntnisprozess des Ödipus bei Seneca und Sophokles. Vergleich von Dramaturgie und Motiven, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1033457
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-