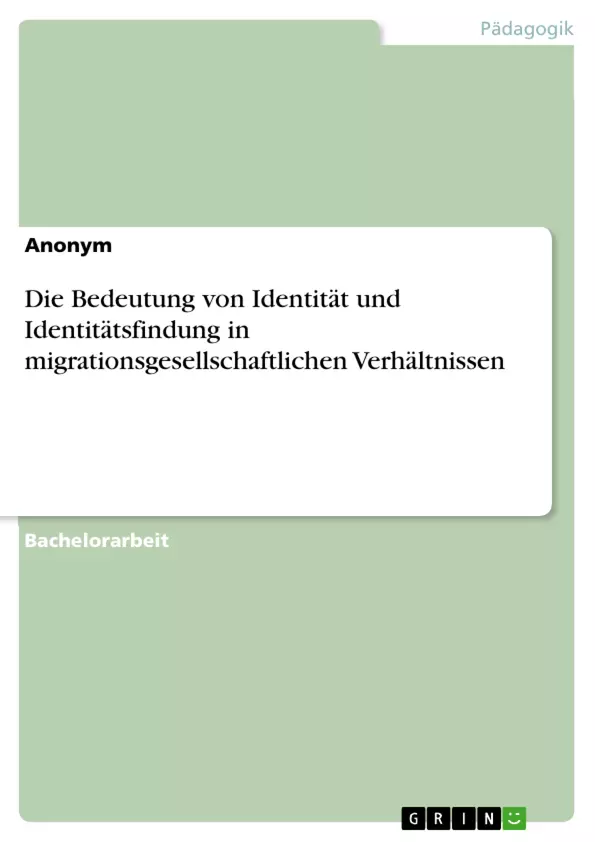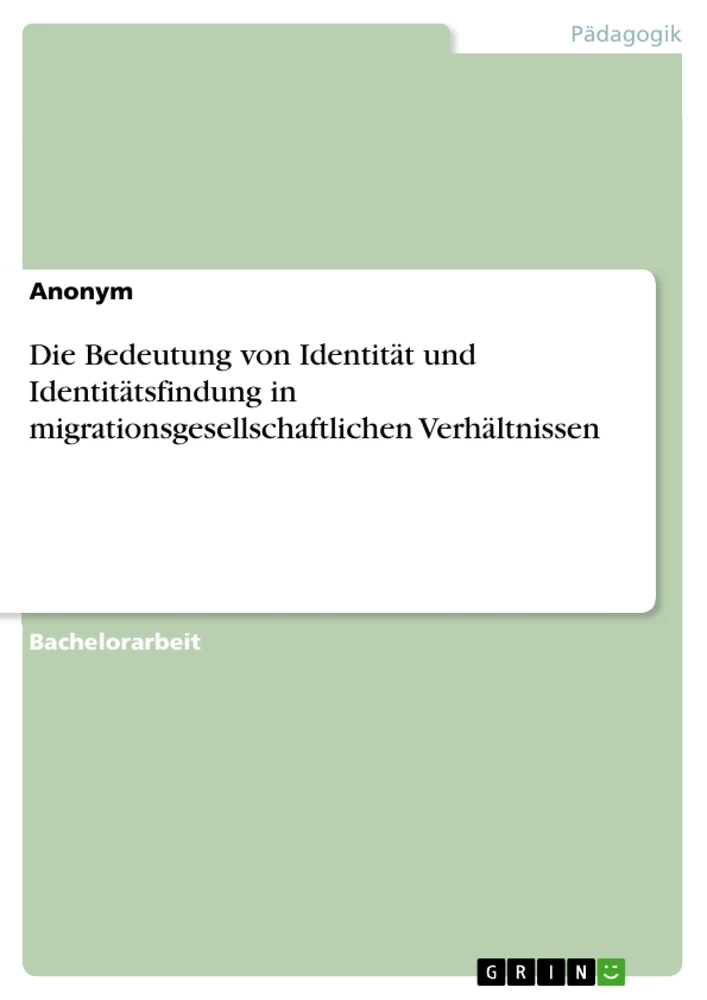
Die Bedeutung von Identität und Identitätsfindung in migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen
Bachelorarbeit, 2019
39 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Identität
- 2.1 Begriffsklärung
- 2.2 Identitätstheorien und -modelle
- 2.2.1 Erik H. Erikson
- 2.2.2 George H. Mead
- 2.2.3 Heiner Keupp et al.
- 2.3 Kulturelle Identität
- 2.3.1 Bikulturelle Identität
- 2.3.2 Kritische Würdigung des Kulturverständnisses
- 3. Migration
- 3.1 Begriffsklärung
- 3.2 Festlegung von Migrationsanderen
- 3.3 Kritische Würdigung des eingeschränkten Migrationsbegriffes
- 3.4 Auswirkungen des Kulturverständnisses im Kontext von Migration
- 4. Die Suche nach Identität in migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen
- 4.1 Die Frage nach Zugehörigkeit
- 4.2 Identitätsentwicklung unter den Herausforderungen von Akkulturationsprozessen
- 4.2.1 Begriffsklärung Akkulturation
- 4.2.2 Das Akkulturationsmodell von Berry
- 4.3 Identitätskonstruktion in hybriden Lebensentwürfen
- 5. Fazit und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Identität und Identitätsfindung in migrationsgesellschaftlichen Kontexten. Ziel ist es aufzuzeigen, wie komplex Identitätskonstruktionen, insbesondere in der postmodernen Gesellschaft, sind und welche Faktoren – sowohl intern als auch extern – den lebenslangen Prozess der Identitätsentwicklung beeinflussen. Besonders wird der Fokus auf die Faktoren gelegt, die das Zugehörigkeitsgefühl von Menschen in migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen prägen.
- Wandel des Identitätsverständnisses im Kontext von Globalisierung und Migration
- Definition und kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff „Migration“ und „Migrationsandere“
- Bedeutung des Kulturverständnisses für die Identitätsfindung von Migrant*innen
- Identitätsentwicklung und Akkulturationsprozesse
- Identitätskonstruktion in hybriden Lebensentwürfen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Identitätsfindung in migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen ein und stellt die zentrale Frage nach der Komplexität von Identitätskonstruktionen in der heutigen Zeit. Sie problematisiert vereinfachte Gegenüberstellungen wie Rückkehr zu den "Wurzeln" versus Assimilation und betont die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise. Die öffentliche Debatte um Integration und Zugehörigkeit, oft geprägt von hegemonialen Diskursen, wird als Ausgangspunkt für die Untersuchung genannt.
2. Identität: Dieses Kapitel analysiert den Begriff der Identität, beginnend mit seiner etymologischen Wurzel und der Kritik an einem statischen Identitätsverständnis. Es werden verschiedene soziologische Perspektiven auf Identität vorgestellt und die Bedeutung sozialer Lebenslagen und kultureller Lebensentwürfe für die Identitätsbildung hervorgehoben. Die Kapitel erläutert, wie äußere Einflüsse wie gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche und Globalisierungsprozesse die Identitätsfindung beeinflussen und den Umgang mit Eigenem und Fremdem neu definieren. Die traditionelle Definition von Identität mit Gleichsein und Kontinuität wird im Kontext der modernen Gesellschaft kritisch hinterfragt, und die Identität wird als Differenzierungs- und Vermittlungsbegriff verstanden. Der Vergleich mit anderen als wichtiger Bestandteil der Identitätsfindung wird deutlich gemacht.
3. Migration: Das Kapitel befasst sich mit der Definition von Migration und der damit verbundenen Problematik der Kategorisierung von „Migrationsanderen“. Es unterzieht den oft eingeschränkten Migrationsbegriff einer kritischen Analyse und beleuchtet die Auswirkungen des Kulturverständnisses im Kontext von Migration. Es wird deutlich, dass die Frage nach der Zugehörigkeit eng mit der Definition von Migration verknüpft ist und dass statische Identitäten in einer globalisierten und pluralisierten Welt an Bedeutung verlieren. Die paradoxe Forderung an „Migrationsandere“, gleichzeitig „anders“ und „nicht-anders“ zu sein, wird diskutiert.
4. Die Suche nach Identität in migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen: Dieses Kapitel untersucht die Herausforderungen der Identitätsfindung in migrationsgesellschaftlichen Kontexten. Es befasst sich mit der Frage nach Zugehörigkeit und der Identitätsentwicklung unter dem Einfluss von Akkulturationsprozessen. Das Akkulturationsmodell von Berry wird vorgestellt und die Konstruktion von Identität in hybriden Lebensentwürfen wird analysiert. Der Fokus liegt auf den komplexen Prozessen der Identitätsfindung und den Schwierigkeiten, die sich aus der Mehrfachzugehörigkeit ergeben können.
Schlüsselwörter
Identität, Identitätsfindung, Migrationsgesellschaft, Akkulturation, Zugehörigkeit, Kulturverständnis, Integration, hybride Identitäten, Identitätskonstruktionen, postmoderne Gesellschaft, Migrationsbegriff, Migrationsandere.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Identitätsfindung in Migrationsgesellschaften
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über ein akademisches Werk zur Identitätsfindung in Migrationsgesellschaften. Es beinhaltet ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Komplexität von Identitätskonstruktionen in der postmodernen Gesellschaft und den Herausforderungen der Zugehörigkeit für Menschen in migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen.
Welche Kapitel umfasst das Werk?
Das Werk gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Identität (inkl. Begriffsklärung, Identitätstheorien, kulturelle Identität und bikulturelle Identität), 3. Migration (inkl. Begriffsklärung und kritischer Auseinandersetzung mit dem Migrationsbegriff), 4. Die Suche nach Identität in migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen (inkl. Akkulturation und hybriden Lebensentwürfen) und 5. Fazit und Diskussion.
Welche Zielsetzung verfolgt das Werk?
Das Werk untersucht die Bedeutung von Identität und Identitätsfindung in migrationsgesellschaftlichen Kontexten. Es möchte die Komplexität von Identitätskonstruktionen aufzeigen und die Faktoren (intern und extern) analysieren, welche die lebenslange Identitätsentwicklung beeinflussen, insbesondere das Zugehörigkeitsgefühl von Menschen in migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Zu den zentralen Themen gehören der Wandel des Identitätsverständnisses im Kontext von Globalisierung und Migration, die Definition und kritische Auseinandersetzung mit den Begriffen „Migration“ und „Migrationsandere“, die Bedeutung des Kulturverständnisses für die Identitätsfindung von Migrant*innen, Identitätsentwicklung und Akkulturationsprozesse sowie die Identitätskonstruktion in hybriden Lebensentwürfen.
Welche Theorien und Modelle werden im Werk behandelt?
Das Werk bezieht sich auf verschiedene soziologische Perspektiven auf Identität und behandelt unter anderem die Identitätstheorien und -modelle von Erik H. Erikson, George H. Mead und Heiner Keupp et al. Es wird auch das Akkulturationsmodell von Berry vorgestellt.
Was versteht das Werk unter „hybriden Lebensentwürfen“?
Der Begriff „hybride Lebensentwürfe“ bezieht sich auf die komplexen Identitätskonstruktionen von Menschen in migrationsgesellschaftlichen Kontexten, die verschiedene kulturelle und soziale Einflüsse in ihre Identitätsfindung integrieren. Es geht um die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus der Mehrfachzugehörigkeit ergeben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Werk?
Die Schlüsselwörter des Werkes sind: Identität, Identitätsfindung, Migrationsgesellschaft, Akkulturation, Zugehörigkeit, Kulturverständnis, Integration, hybride Identitäten, Identitätskonstruktionen, postmoderne Gesellschaft, Migrationsbegriff, Migrationsandere.
Worum geht es in Kapitel 2 (Identität)?
Kapitel 2 analysiert den Begriff der Identität, seine etymologische Wurzel und die Kritik an einem statischen Identitätsverständnis. Es werden verschiedene soziologische Perspektiven vorgestellt und der Einfluss sozialer Lebenslagen und kultureller Lebensentwürfe auf die Identitätsbildung hervorgehoben. Äußere Einflüsse wie gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche und Globalisierungsprozesse werden im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Identitätsfindung diskutiert.
Worum geht es in Kapitel 3 (Migration)?
Kapitel 3 befasst sich mit der Definition von Migration und der Problematik der Kategorisierung von „Migrationsanderen“. Es unterzieht den oft eingeschränkten Migrationsbegriff einer kritischen Analyse und beleuchtet die Auswirkungen des Kulturverständnisses im Kontext von Migration. Die enge Verknüpfung zwischen der Frage nach Zugehörigkeit und der Definition von Migration wird thematisiert.
Worum geht es in Kapitel 4 (Die Suche nach Identität in migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen)?
Kapitel 4 untersucht die Herausforderungen der Identitätsfindung in migrationsgesellschaftlichen Kontexten, die Frage nach Zugehörigkeit und die Identitätsentwicklung unter dem Einfluss von Akkulturationsprozessen. Das Akkulturationsmodell von Berry wird vorgestellt, und die Konstruktion von Identität in hybriden Lebensentwürfen wird analysiert.
Details
- Titel
- Die Bedeutung von Identität und Identitätsfindung in migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen
- Hochschule
- Universität Duisburg-Essen
- Veranstaltung
- Bildungswissenschaften
- Note
- 1,0
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 39
- Katalognummer
- V1033852
- ISBN (eBook)
- 9783346441485
- ISBN (Buch)
- 9783346441492
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Nominierung für den Diversity-Preis der Universität Duisburg-Essen
- Schlagworte
- bedeutung identität identitätsfindung verhältnissen Bikulturelle Identitäten natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit Mehrfachverortungen transnationale Bezugsräume Othering Postmigration Akkulturation hybride Identitätaten
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Die Bedeutung von Identität und Identitätsfindung in migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1033852
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-