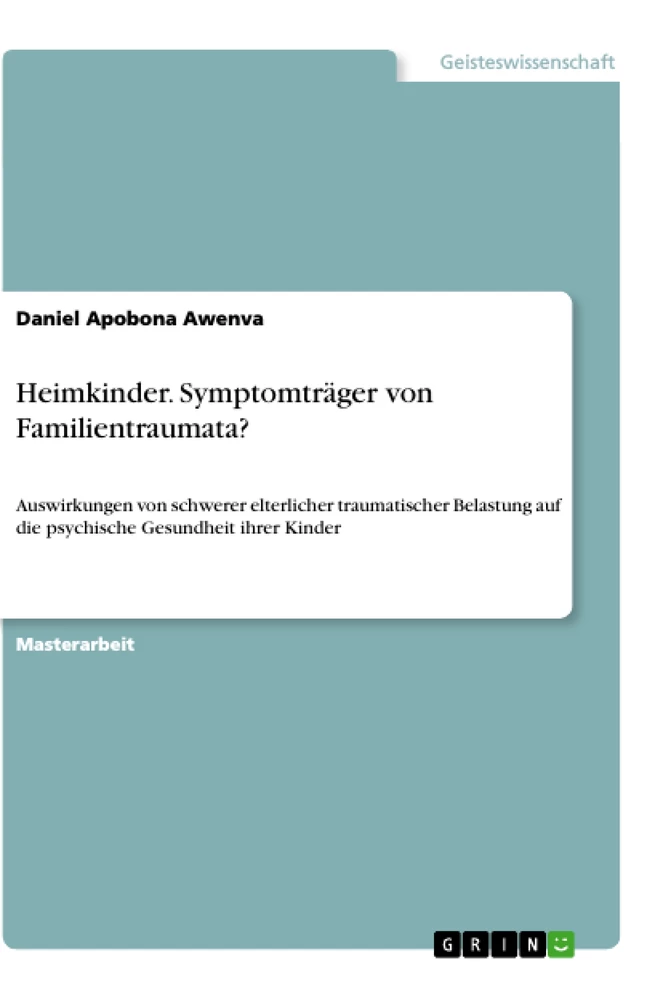
Heimkinder. Symptomträger von Familientraumata?
Masterarbeit, 2020
86 Seiten, Note: 1,00
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Persönliche Motivation
1.2 Forschungsfragen
2. Trauma: Allgemeine Definition
2.1 Kinderspezifische Definition
2.2 Kumulatives Trauma
2.3 Das Konzept des sequenziellen Trauma nach Keilson
2.4 Transgenerationale Weitergabe bzw. Wiederherstellung von Traumata
2.4.1 Folgen von Extremtraumata für die zweite und die folgenden Generationen
2.4.2 Auswirkungen schwerer Traumatisierungen der Bindungspersonen auf den Umgang mit ihren Kindern
2.5 Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe
3. Folgen psychischer Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen in der Entwicklung
3.1 Psychisches Trauma
3.2 Psychopathologie
3.3 Bindung
3.4 Kognitive Verzerrungen
3.5 Regulation von Affekten, Aggression und delinquentes Verhalten
4. Stationäre Jugendhilfe des evangelischen Johannesstifts Diakonie
4.1 Jugendhilfe des Evangelischen Johannesstifts Diakonie
4.2 Jugendsuchthilfe -und Jugendhilfeeinrichtung – NEUStart
4.3 Zielgruppe
4.4 Das Globalziel
4.5 Die Arbeitsweise von NEUStart
4.6 Das Mehr-Stufenmodell (transparente Regeln, Grenzen und Konsequenzen)
4.7 Die vier Säulen der Arbeit
4.7.1 Tägliches Arbeitstraining und sozialpädagogische Betreuung
4.7.2 Pädagogische Betreuung
4.7.3 Schulische Förderung
4.7.4 Psychologischer Fachdienst
5. Methodik
5.1 Das Studiendesign
5.2 Stichprobenrekrutierung
5.2.1 Kriterien für die Rekrutierung der Stichprobe
5.2.2 Kriterien für Selektion der Stichproben
5.2.3 Ausschlusskriterien: Gründe für die Nichtteilnahme
5.3 Datenaufbereitung und statistisches Verfahren
5.3.1 Biographische Daten
5.3.2 Erfassung traumatischer Lebensereignisse und der posttraumatischen Symptombelastung: Das Essener Trauma-Inventar (ETI) und das Essener Trauma-Inventar für Kinder (ETI-KJ)
6. Ergebnisse der Befragung anhand des Essener Trauma-Inventars
6.1 Ermittlung des Traumatisierungsgrades der Jugendlichen
6.1.1 Betrachtung der Symptomatik der Jugendlichen
6.1.2 Psychosoziale Einschränkungen der Jugendlichen
6.1.3 Somatisierung
6.2 Traumatisierung der Eltern
6.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der traumatischen Erfahrungen der Eltern und Kinder
6.4 Interpretation: Transgenerationale Weitergabe der Traumatisierung der Eltern an die Kinder oder Wiederherstellung von Traumata
7. Zusammenfassung und Diskussion
7.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
7.2 Schwächen der Studie und Kritik an der Methodik
7.3 Kritik am Befragungsbogen ETI und ETI-KJ
8. Schlussfolgerung
8.1 Schlussfolgerung für die Jugendhilfe/Jugendsuchthilfe Einrichtung (NEUStart)
8.2 Schlussbetrachtung
Literatur
Onlinequellen
1. Einleitung
„Mama! Mama! Mama!“ schreit Benni aus vollem Hals von einem Hügel und versucht ein Echo zu erzeugen. Ihre Mutter ist aber nicht da und kann sie nicht hören – das ist der wohl schmerzlichste Moment des Films „Systemsprenger“.
Dieser mit vielen Preisen ausgezeichnete Spielfilm der Regisseurin Nora Fingscheidts zeigt eindrucksvoll die Folgen von schwerer traumatischer Belastung eines Kindes und hat damit die Schwierigkeiten von traumatisierten Heimkindern und Jugendlichen sowie einseitiger Hilfemaßnahmen eindrucksvoll ins öffentliche Bewusstsein gebracht. Dadurch dass der Film ein wichtiges, bis dahin jedoch wenig erforschtes Thema aufnahm, löste er eine öffentliche Debatte im psychosozialen Arbeitsbereich aus.
Im Mittelpunkt von „Systemsprenger“ steht die neunjährige Benni – ein aggressives, unkontrollierbares und unberechenbares Kind. Ein Kind, das auf bestimmte Situationen sehr aggressiv reagiert und dabei sich selbst, aber auch sein familiäres, soziales und pädagogisches Umfeld gefährdet. Egal, wo Benni hinkommt, sie fliegt sofort wieder aus jeder Einrichtung. Keine Pflegefamilie, kein Heim, keine Einrichtung oder Wohngruppe behält sie längerfristig aufgrund ihres massiven Auffälligkeitsverhaltens. Sie wurde immer wieder von der Sonderschule suspendiert, und wurde immer wieder in die Psychiatrie eingewiesen, in der sie mit Psychopharmaka ruhiggestellt wurde. Die wilde Neunjährige ist das, was man im Jugendamt einen „Systemsprenger“ nennt (https://www.systemsprenger-film.de). Im Film wurde deutlich, dass alle Versuche und Teilnahmen an einzelpädagogischen Maßnahmen wie zum Beispiel Anti-Aggression-Training bei Benni fehlschlugen. Als sogenannter „Systemsprenger“ stürzte sie die ganze Jugendhilfe in Rat- und Hilflosigkeit und fällt durch alle Raster der deutschen Kinder- und Jugendhilfen. Dieses eindrückliche Filmbeispiel ist Auftakt und Einleitung für die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel Heimkinder: Symptomträger von Familientraumata? Auswirkungen von schwerer elterlicher traumatischer Belastung auf die psychische Gesundheit ihrer Kinder.
Im Film wird zudem deutlich, dass hinter Bennis Aggressionen extreme Traurigkeit, Einsamkeit und das Gefühl von Verlassenheit stecken. Bennis Wut ist die Wut der Verzweiflung. Eigentlich sehnt sie sich nach Liebe und Geborgenheit und danach wieder bei ihrer Mutter zu wohnen. Die Kindesmutter (Lisa Hagmeister), die Überforderung und Gebrochenheit im Film eindrücklich verkörpert, ist von ihrer Tochter aber so überfordert, dass sie sie weggeben muss. Sie hat sogar Angst vor ihrer eigenen Tochter. Die Vorgeschichte der Mutter, einer zarten, blonden Frau, die ihr Kind zwar liebt, sich jedoch von ihr distanziert und häufig falsch reagiert, wird im Film nur am Rande erzählt. Nichtsdestotrotz wird die psychische Belastung der Mutter deutlich. Augenscheinlich ist sie sogar selbst traumatisiert. Auch sie ist sozial und finanziell eingeschränkt. Das Verhältnis zu all ihren Kindern ist zerrüttet und sie weist mangelnde Erziehungskompetenz auf. In einer Szene wird gezeigt, dass ihre zwei Kinder nicht genug zu essen bekommen. Zudem hat ihre zweite Tochter eine geistige Beeinträchtigung, da sie kaum spricht und von der Mutter immer noch im Kinderwagen herumgefahren wird, obwohl sie vom Alter her, leicht selbst laufen können müsste.
Bennis Schicksal steht exemplarisch für das Schicksal vieler Heimkinder. Das eingangs erwähnte Beispiel eines traumatisierten Kindes steht stellvertretend für unzählige Heimkinder in der Bundesrepublik Deutschland, die von der deutschen Kinder- und Jugendhilfe betreutet werden. Die Probleme sind meist nicht Zufall, sondern rühren aus einem sehr komplexen familiären Problem und aus frühkindlichen traumatischen Erfahrungen. Genau um diese Probleme und psychischen Schwierigkeiten geht es in vorliegender Arbeit – nämlich um unverarbeitete Familientraumata, die an die nächste Generation weitergegeben werden.
1.1 Persönliche Motivation
Der Anlass für das Entstehen dieser Arbeit basiert auf meinen bisherigen Beobachtungen und gesammelten Erfahrungen in meiner Tätigkeit als psychologische Fachkraft in der Jugendhilfe Berlin-Bandenburg. Bei meiner Arbeit im stationären Kontext bin ich täglich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr mit ihrer Herkunftsfamilie zusammenleben dürfen und/oder können und deshalb in einer stationären Einrichtung untergebracht werden müssen. Die Gestaltung des Alltags und der gesamte Hilfeverlauf sind nicht nur mit den Jugendlichen eine Herausforderung, sondern zu einem großen Teil auch mit deren Eltern, die teilweise eine noch größere Herausforderung darstellen. Schwierige Verhaltensweisen, welche die Beziehungen aufs Äußerste testen und die alltägliche Betreuung schwierig gestaltet, prägen nicht nur die Jugendlichen sondern auch deren Eltern. So kann es vorkommen, dass einige Verhaltensweisen für die Kinder und ihre Eltern völlig normale Reaktionen darstellen, aufgrund ihrer leider nicht so normalen Lebenserfahrungen, aber für die Fachpersonen extrem herausfordernde Verhaltensweisen sind, die im Alltag so kaum tragbar sind. Fremdplatzierte Kinder kommen oft aus sehr schwierigen Familiensituationen, in denen die Eltern selbst unter anderem unter traumatischen Erfahrungen zu leiden scheinen, die sie selbst noch nicht in ihre Lebensgeschichte integrieren konnten.
In den anamnetischen Erhebungen nach der Aufnahme in unserer Einrichtung lässt sich häufig feststellen, dass die von den Jugendlichen berichteten traumatischen Erlebnisse und ihre Folgen bereits in der Herkunftsfamilie vorliegen. So lässt sich häufig feststellen, dass nicht nur die Jugendlichen sexuelle Missbrauchserfahrungen gemacht haben, sondern auch schon ihre Eltern dies erlebt haben. Es scheint mir, dass Eltern, die aufgrund eigener unverarbeiteter Traumata, diese unbewusst an ihre Kinder durch ihre Erziehungsmaßnahmen und Verhaltensweisen weitergeben oder diese in Situationen bringen, sodass die Kinder auch traumatische Ereignisse erleben.
Häufig erhalte ich während den Elterngesprächen eine Bestätigung von einem Elternteil für meine Annahme: „Ich kenne das Gefühl. Ich habe das auch selbst erlebt“ – so ein Elternteil. Wie Michael Hipp (2014) bereits in seinem Beitrag: Trauma, Traumafolgestörungen und ihr Einfluss auf die Erziehungskompetenz erklärt, sind in der Vorgeschichte der Eltern und/oder der Herkunftsfamilie Vernachlässigung, emotionale, körperliche und sexuelle Misshandlung, Verlusterfahrungen oder Trennungen häufig vorhanden. Hipp ist der Auffassung, dass aufgrund der Schädigung des Stressbewältigungssystems durch das Trauma die betroffenen Eltern kognitiv, emotional und sprachlich nicht dafür geeignet sind, ihren Anteil der Interventionsmaßnahme zu erfüllen (Hipp, 2014). Dementsprechend gehe ich davon aus, dass ein großer Teil der Eltern, die ihre Kind(er) in eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung geben unter den entsprechenden Folgestörungen der Traumatisierung leiden. Diese Traumata werden nicht eins zu eins an ihre Kinder weiteregegeben, aber ich vermute, dass die elterliche Traumatisierung durch ihre Verhaltensweisen und ihren Erziehungsstil bei den Kindern ihrerseits Bindungstraumata auslösen können. Im Speziellen meine ich traumatische Ereignisse, die durch Bindungspersonen verursacht werden. Dies kann neben körperlicher Gewalt, sexuelle und emotionale Misshandlung auch den frühen Tod eines Elternteils beinhalten. Traumatisierend können auch andauernde Unterversorgung von körperlichen, emotionalen und sozialen Bedürfnissen, verbunden mit Zurückweisung und kontinuierlicher Abwertung wirken. Bindungstraumatische Beziehungsmuster der Eltern in ihrer eigenen Kindheit führen hier zu feindseligen oder hilflosen Beziehungsmodellen, die den Umgang mit den eigenen Kindern prägen.
Mein Interessensschwerpunkt in vorliegender Arbeit liegt dabei auf transgenerationalen Prozessen. Wird das problematische Verhalten der Eltern, wenn dies durch Trauma geprägt ist, tagtäglich an die Kinder weitergegeben? Mich interessiert auch welche Wirkung die traumatische Lebensgeschichte der Eltern auf die psychische Entwicklung ihrer Kinder haben kann. Das große und komplexe Themengebiet der transgenerationalen Weitergabe traumatischer Erfahrungen (wie zum Beispiel Kriegstraumata) kann im Rahmen dieser Arbeit leider nicht umfassend untersucht und behandelt werden. Hier geht es konkret um traumatische Erfahrungen, die durch die Erziehungsmaßnahmen der Eltern auf ihre Kinder übertragen werden. Was ich als transgenerationale Wiederherstellung von Trauma bezeichnen möchte.
Im ersten Teil der Arbeit werden die Begrifflichkeiten wie Trauma, frühkindliches Trauma, sequenzielles Trauma definiert und die theoretische Forschungsgrundlage aufbereitet. Dabei wird ein umfassender Überblick über die wichtigsten Konzepte und Theorien gegeben. Das Hauptaugenmerk wird auf die transgenerationale Weitergabe von Trauma und dessen Wirkung auf Kinder und Jugendliche gelegt. Danach werde ich mich mit dem derzeitigen Forschungstand zum Thema Traumatisierung in der Jugendhilfe auseinandersetzen. Da hier, besonders im Bundesgebiet, Studien über den Zusammenhang der elterlichen traumatischen Belastung und der psychischen Gesundheit ihrer fremdplatzierten Kinder noch fehlen, soll diese Masterarbeit dazu einen wichtigen Beitrag leisten, um ein größeres Verständnis über die transgenrationale Weitergabe von Trauma aufzuzeigen. Ergänzend dazu wird die stationäre Einrichtung, in der ich die Befragung durchgeführt habe (NEUStart), vorgestellt.
Im zweiten Teil der Arbeit wird dann basierend auf meinen Annahmen eine eigene empirische Befragung durchgeführt. Diese bildet den Kern und Hauptteil meiner Arbeit. Hierzu wurde der von Tagey und seiner Gruppe entwickelte Selbstbeurteilungsfragebogen: Essener Trauma – Inventar (ETI) für die Befragung der Eltern und das Essener Trauma – Inventar für Kinder und Jugendlichen (ETI-KJ) für die Jugendlichen benutzt. Nach der Operationalisierung und Erläuterung der Methodik widme ich mich der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse. Diese werden in Gänze ausgeführt und eigene Schlussfolgerungen gezogen. Zudem werde ich darauf eingehen, was nicht hinreichend beantwortet werden kann.
Zum Schluss der Masterarbeit steht die Beantwortung der eingangs gestellten Forschungsfragen. Zudem werde ich mich in der Diskussion kritisch mit dem angewendeten Verfahren und den Ergebnissen auseinandersetzen. Danach wird ein Resümee gezogen und eine Bewertung der Hauptargumente geliefert. Ich bin davon überzeugt, dass durch meine Analyse neue Interpretationsmuster und Erklärungsangebote hervortreten und ich somit die Forschung im Bereich der stationären Jugendhilfe ergänzen kann.
1.2 Forschungsfragen
Vor diesem Hintergrund leiten sich folgende Forschungsfragen ab, die der Arbeit zu Grunde liegen:
1. Sind traumatische Ereignisse die Ursache für das auffällige Verhalten der Kinder und Jugendlichen in der stationären Einrichtung (NEUStart)?
2. Haben die Eltern oder ein Elternteil eine traumatische Erfahrung gehabt und ist diese die Ursache für deren psychische Belastung?
3. Gibt es einen Zusammenhang (Ähnlichkeiten und/oder Unterschiede) zwischen traumatischer Belastung der Eltern und der Kinder?
4. Liegen Traumatisierungen sowohl bei den Eltern und deren Kinder vor?
5. Inwiefern gibt es einen Zusammenhang zwischen der Art des traumatischen Erlebnisses der Eltern und der Kinder (Wiederherstellung)?
2. Trauma: Allgemeine Definition
Der Begriff Trauma stammt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Er lässt sich bildhaft als eine seelische Verletzung verstehen, zu der es bei einer Überforderung der psychischen Schutzmechanismen durch ein einschneidendes Erlebnis kommt. Die Folge traumatisierender Erlebnisse auf das Selbst, auf die Identität, die Ich-Organisation und die gesamte Entwicklung kann mit Hilfe von unterschiedlichen Konzepten dargestellt werden. Somit lässt sich der Begriff Trauma bzw. Traumatisierung unterschiedlich definieren.
Im Sinne der Psychoanalyse ist der Begriff Trauma bereits auf Freuds frühere Theorien zurückzuführen. In seiner frühen Arbeit nutzt er den Begriff unterschiedlich und teilweise widersprüchlich. In seinem Werk über den psychischen Mechanismus der hysterischen Phänomene versucht er dem Trauma eine konkrete Bedingung zuzuschreiben, die gegeben sein muss, damit ein Individuum von einem Trauma betroffen ist:
[...] es muss schwer sein, d.h. von der Art, dass die Vorstellung einer Lebensgefahr, der Bedrohung der Existenz damit verbunden ist; es darf aber nicht schwer sein in dem Sinne, dass die psychische Tätigkeit dabei aufhört. Es darf also z.B. nicht mit einer Gehirnerschütterung, mit einer wirklich schweren Verletzung einhergehen. Ferner muss dieses Trauma eine besondere Beziehung zu einem Körperteil haben (Freud, S. 1893, 1990, S. 71 - 72).
Mathias Hirsch benennt Trauma als „eine Kurzformel für ein sehr komplexes Prozessgeschehen“ (Hirsch, 2011, S.10). In seinem Verständnis entsteht ein Trauma, wenn ein überwältigendes Ereignis den psychischen Apparat überrollt und den Reizschutz des Ichs durchbricht, sodass die Gewalterfahrung nicht integriert werden kann. Das Erlebnis muss eine solche Intensität haben, dass es die psychischen Verarbeitungsmöglichkeiten des Betreffenden überschreitet und das Individuum zwingt Notmaßnahmen zu ergreifen (Mertens, 2014). Zu den wichtigsten Abwehrmechanismen gehören Dissoziation und Internalisierung der Gewalt, was Ferenczi als Bewältigungsversuche des Individuums beschrieben hat: „Introjektion und Identifizierung mit dem Aggressor“ (Ferenczi, S., 1993). Mathias Hirsch beschreibt das traumatische Ereignis als „einen Prozess, in dem einer Gewalteinwirkung (traumatisches Ereignis) die direkte Abwehrreaktion des Opfers in der Gewaltsituation folgt und sich schließlich Langzeitfolgen einstellen“ (Hirsch, 2011, S. 10). Die Langzeitfolgen des Traumas äußern sich in den bekannten Symptomen einer Traumatisierung: dissoziative Zustände, Intrusionen, unbeeinflussbares Wiederherstellen der traumatischen Situation und Angststörungen.
Eine sehr detaillierte, offene Definition findet sich in der deutschen Leitlinie der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie (Flatten et al. 2001):
Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine mögliche Folgereaktion eines oder mehrerer traumatischer Ereignisse (wie z. B. Erleben von körperlicher und sexualisierter Gewalt, auch in der Kindheit [sogenannter sexueller Missbrauch], Vergewaltigung, gewalttätige Angriffe auf die eigene Person, Entführung, Geiselnahme, Terroranschlag, Krieg, Kriegsgefangenschaft, politische Haft, Folterung, Gefangenschaft in einem Konzentrationslager, Natur- oder durch Menschen verursachte Katastrophen, Unfälle oder die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit), die an der eigenen Person, aber auch an fremden Personen erlebt werden können. In vielen Fällen kommt es zum Gefühl von Hilflosigkeit und durch das traumatische Erleben zu einer Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses (Flattern et al. 2001).
In den medizinischen Klassifikationssystemen (ICD-10 und DSM-IV), die maßgeblich sind für die fachgerechte Beurteilung psychischer Beschwerden, ist der Begriff jedoch wesentlich enger definiert und schließt alle Ereignisse mit ein, die einerseits „mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß“ (ICD-10) einhergehen oder die den „tatsächlichen oder drohenden Tod, tatsächliche oder drohende ernsthafte Körperverletzung oder eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit von einem Selbst oder Anderen“ (DSM-IV) einschließen und andererseits „bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würden“ (ICD-10) beziehungsweise mit „starker Angst, Hilflosigkeit oder Grauen“ (ICD-10) erlebt werden.
Die klinische Kinder- und Jugendpsychologie ist sehr häufig unmittelbar mit den Folgen von Vernachlässigung, Kindesmisshandlung und Missbrauch betroffen. Neue epidemiologische Studien weisen darauf hin, dass eine traumatische Belastung bei Kindern und Jugendlichen nicht unmittelbar zur PTBS führen, sondern mit anderen zahlreichenden Störungen verbunden sein können (Streeck-Fischer, 2009). Im Klassifikationssystem werden unter anderem auf die Folgen von Traumatisierung in der Entwicklung hingewiesen, was aber nach Annegret Streeck-Fischer zu kurz kommt (2009). Besonders betroffen sind Heimkinder, bei denen häufig eine komplexe Traumatisierung als Folge von Beziehungstraumata im Vordergrund steht. Traumatische Ereignisse können die Ursache von vielen verschiedenen psychischen und psychosozialen Problemen sein (Ackman et al. 1998). Bei Jugendlichen in der Adoleszenz sind dies oftmals Alkohol- und Drogenmissbrauch, Essstörungen, dissoziative, affektive, somatoforme, immunologische und sexuelle Störungen (Streeck-Fischer, 2009).
Eine der einflussreichsten Definition ist die von Leonore Terr. Sie unterschiedet psychische Traumatisierung in Trauma Typ I und Trauma Typ II (Terr, 1991). Indem sie einmalige Ereignisse wie Naturkatastrophen, Unfälle, technische Katastrophen als Schocktrauma bzw. Trauma Typ I bezeichnet, ordnet sie wiederholte körperliche und/oder sexuelle Gewalt, Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung oder Geiselhaft dem Typ II oder komplexen Trauma zu, was Hirsch als familiäres Beziehungstraumata bezeichnet (Hirsch, 1993). Die psychopathologischen Auswirkung von Typ-I-Traumatisierung sind oft klassische Symptome einer posttraumatischen Belastung, während die Folgen von sequenziellen Traumatisierungen insbesondere interpersoneller Art, bei Kindern häufig eine Störung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung und zahlreiche psychopathologische Symptome zur Folge haben können (Schmid et al. 2020). Terr beschreibt die mögliche Symptomatik von chronischer Traumatisierung, unter welcher die Patienten leiden, als Dissoziationsneigung, mangelnde Selbstwirksamkeitserwartungen, Probleme mit der Emotionsregulation und Somatisierung (Terr, 1991). Dies hat bereits zu dem Vorschlag einer eigenen Definition von komplexen Traumata im Sinne einer Entwicklungstraumastörung geführt (van der Kolk 2005; van der Kolk 2009). Sie sind der Auffassung, dass die Entwicklungsverläufe von vielen sequenziellen traumatisierenden Patienten fast regelhaft verlaufen: Der Patient leidet bereits als Säugling unter Regulationsstörungen, im Vorschulalter zeigen sich Bindungsstörungen mit/oder ohne Enthemmung, im Schulalter vermutlich hyperkinetische Störungen des Sozialverhaltens oder eine kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen in der Adoleszenz. Die daraus resultierenden Persönlichkeitsstörungen treten nicht selten in Kombination mit Substanzmissbrauch, selbstverletzendem Verhalten und affektiven Störungen auf, sodass sich im Sinne einer Entwicklungsheterophorie dieselben grundlegenden Defizite (z.B. in der Emotionsregulation, Selbstwirksamkeitserwartung, Dissoziationsneigung, Bindung) in unterschiedlichen Entwicklungs- und Altersstufen ganz unterschiedlich auswirken und dort alterstypische psychopathologische Symptome zur Folge haben (De Dellis, 2001).
Entwicklungsheterotopie von Traumafolgen (Schmid, Fegert & Petermann, 2010 S.49).
Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der psychotherapeutischen Behandlung traumatisierter Personen erachtet auch Kernberg die Unterteilung von Traumata in chronische familiäre Traumata, die zu andauernden Persönlichkeitsveränderungen führen und akute, einmalige Extremtraumatisierungen in jedem Lebensalter, die eine posttraumatische Belastungsstörung nach sich ziehen, als dringend geboten (Kernberg, 1999).
2.1 Kinderspezifische Definition
Da sich diese Arbeit maßgeblich mit der Traumatisierung von Jugendlichen beschäftigt, die bereits in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht haben, ist es an dieser Stelle relevant einen einzelnen Punkt zu der Besonderheit von Traumatisierungen in der Kindheit anzuführen. Weiter unten, unter Punkt 3.0 und fortfolgend, wird sich eingehend mit den Folgen von Traumata beschäftigt, die natürlich höchst gravierend die Bindung, Kognition und Regulation von Affekten beeinflussen, wenn diese in der frühen Kindheit erfolgten.
Die Vorstellung, wie sich Traumatisierung im Säuglingsalter und dem frühen Kindsalter entwickelt und wie sie in Erscheinung tritt, sind so alt wie die Psychoanalyse selbst. Bereits Sigmund Freud benennt in seinen frühen Theorien den Zusammenhang zwischen traumatischer Belastung, kindlichem Triebleben, Fantasien und unbewussten Konflikten und neurotischen Störungen.
Dass Kinder auch traumatische Störungen entwickeln können, wurde allerdings erst nach dem Vietnamkrieg systematisch erkannt und untersucht. Davor, bereits in den 1940er Jahren, untersucht Rene Spitz die Folgen von chronischer und seelischer Vernachlässigung von Säuglingen und Kleinkindern. Spitz beobachtet damals Säuglinge und Kleinkinder, die ohne Familie und in Findelhäusern und Säuglingsanstalten betreut wurden. Die beobachtbaren körperlichen und psychischen Schäden bezeichnet er als „Hospitalismus“ (Spitz, 1966). Damit beschreibt er Säuglinge, die noch nicht hochgradig erkrankt oder sogar gesund eingeliefert worden sind, danach jedoch lediglich die allernötigsten Überlebensbedürfnisse erfüllt bekamen. Dabei fehlten jegliche Emotionalität und mütterliche Fürsorge. Darüber hinaus bestand ein Mangel an äußeren Reizen für jedes einzelne Kind. Dadurch entstanden soziale, sensorische und emotionale Defizite bei den Kindern. Demnach „verhungerten“ die Säuglinge psychisch und körperlich und reagierten zunächst mit Schreien und andauerndem Weinen, um auf ihre Not aufmerksam zu machen. Wenn dies nicht half, reagierten sie mit sozialem Rückzug und Apathie. Es kam zu einem Entwicklungsstillstand, der teilweise bis zum frühzeitigen Tod führte.
Ein größerer Beitrag zu kindlichen Traumatisierungen in der Unterscheidung zwischen Schock-Trauma und dem Einfluss von Dauerbelastung in der frühen Kindheit stammt von dem US-amerikanischen Psychoanalytiker Ernst Kris (1956). Mit seinem Konzept der Dauerbelastung, die er „Strain“ nennt, ermöglicht er die Unterscheidung zwischen dem lang andauernden pathogenen Einfluss in der frühen Kindheit vom Schock-Trauma. Nach Kris kommen Ursachen für traumatische Entwicklungsstörungen von außen. So stellen diese eine Überstimulation der physischen und sexuellen Einwirkung als auch Mangelversorgung und Deprivation dar. Sandler (1967) ergänzt dieses Konzept der Dauerbelastung und verknüpft das äußere Trauma mit inneren Faktoren. Seiner Auffassung nach beeinflussen sich diese Faktoren in einem Wechselspiel. Er deutet das durch das Trauma beeinträchtigte Ich als entweder zur Anpassung und sogar Ich-Reifung fähig oder als in der Entwicklung oder Störung der Psyche beeinträchtig. Sandler geht davon aus, dass die äußeren Faktoren unwesentlicher sind und nicht unbedingt innerhalb einer Beziehung stattfinden. Laut Sandler sind zudem auch innere überwältigende körperlich-psychische Reizüberflutungen, deren Bewältigung von einer ausreichenden guten mütterlichen Umgebung abhängig sind, von Bedeutung. Andere frühe Konzepte wie „silent trauma“ (Hoffer, 1952, S.,38), „maternal barrier“ (Boyer, 1965) und „falsches Selbst“ (Winnicott, 1965,) verbinden vorrangegangenen inneren und äußeren Stress und die Funktion der guten mütterlichen Umgebung als entscheidenden Faktor von frühkindlichem Traumata. Detailliert beschreibt Boyer (1965) die Funktion der Mutter als Reizschranke sowohl gegen innere als auch gegen äußere Reize, was er „maternal barrier“ nennt. Mangelnde „maternal barrier“ könnte zu einer Beeinträchtigung in der Entwicklung des Ichs und einer Störung der Differenzierung von Ich und Es führen. Traumatisch ist, wenn die gute mütterliche Umgebung in ihrer Funktion komplett versagt. Als Reaktion wird das Kind gezwungen ein falsches Selbst zu bilden und dies vom wahren Selbst abzuspalten (Winnicott, 1965). Das falsche Selbst ist ein defensiver Anteil, der als Reaktion auf eine stark fordernde mütterliche Umgebung entwickelt wird.
Winnicott fand zudem heraus, dass schon Babys und Kleinkinder mitbekommen, was erwünscht und unerwünscht ist. Sind die Forderungen zu stark, die Bedürfnisse und Wünsche nicht erfüllt, so hören sie auf, ihren inneren Impulsen zu folgen, da sie spüren, dass diese unerwünscht sind – und bauen im Laufe ihrer Entwicklung immer mehr ein falsches Selbst auf, in einer Art einer Rollenumkehr, die die Forderungen der Umgebung erfüllt.
2.2 Kumulatives Trauma
Der Begriff der kumulativen Traumatisierung nach Masud Khan (1963) umfasst:
Eine Abfolge von traumatischen Ereignissen oder Umständen, die jedes für sich subliminal (unterschwellig) bleiben können, in ihrer zeitlichen Abfolge und Häufung jedoch die resultierenden Kräfte des Ich so sehr schwächen, dass insgesamt eine oft sogar schwer traumatische Verlaufsgestalt entsteht (Fischer und Riedesser 1998, S. 124).
Khan führt das kumulative Trauma auf die frühe, präverbale Beziehung zwischen Mutter und Kind zurück. Laut Khan liegt der pathogene Moment zum Großteil in einem traumatischen Durchbrechen des Reizschutzes, den die Mutter in diesem Zeitraum gewährleisten muss. Bezugnehmend auf Winnicott (1956) beschreibt Khan (1963) die Mutter in ihrer Funktion (mütterlichen Umgebung) als Reizschutz, der das Kind vor inneren und äußeren Reizen schützt. Im Falle eines Versagens dieser Funktion, indem die Mutter nicht genügend die anaklitischen Bedürfnisse des Kindes erfüllt, entsteht eine wiederholte Reizüberflutung (kumulatives Trauma) bei Kleinkindern. Mathias Hirsch (2004) beschreibt diesen Prozess in seinem Buch: Psychoanalytische Traumatologie – Das Trauma in der Familie. So „geht es nicht darum, ob es eine gute oder schlechte Mutter ist, sondern um eine bestimmte Form des Wechselspiels zwischen Mutter und Säugling, bei dem es allerdings zu einem Versagen der Umweltfürsorge kommen kann, wenn die persönlichen Bedürfnisse, Defizite und Konflikte der Mutter sich störend auf diese Rolle auswirken“ (Hirsch M. 2004, S., 25). Säuglinge, die wiederholt diese Reizüberflutung erleben müssen, werden nicht mehr in der Lage sein, diese aus eigener Kraft (Mittel des kindlichen Ichs) zu kompensieren. Sie passen sich an die Situation durch frühreife und selektive Entwicklung von Ich-Funktionen an, um die Unlust abzuwehren. Hirsch (2004) fand heraus, dass der Säugling in diesem Zustand besonders auf den Zustand der Mutter reagiert, was wiederrum die Frühreifung der Ich-Funktionen verstärken wird. Khan ist der Auffassung, dass jede einzelne Reizüberflutung, die noch kein einzelnes Trauma bildet, durch Summation doch zu einem kumulativen Trauma führen kann.
Einen weiteren Beitrag zum Konzept des kumulativen Traumas geht aus den Untersuchungen des britischen Kinderpsychiaters und Begründers der Bindungstheorie John Bowlby hervor. Bowlby (1960; 1973) forschte maßgeblich über Verlust- und Trennungserfahrungen im sehr frühen Alter und fand heraus, dass ein geglücktes Bindungsverhalten eine große Rolle als Schutz vor Trennung und Verlust spielt. Eine einfühlsame Betreuung im frühen Alter nimmt einen hohen Stellenwert ein und gilt als Basis für psychische Gesundheit und prägt die über den ganzen Lebenszyklus hinweg anhaltende Bedeutung der sicheren Bindungen. Kraftvoll vertritt Bowlby die Ansicht, dass es die realen Nöte des Lebens sind wie emotionale Deprivation, körperlicher und sexueller Missbrauch, Verwirrung, Vernachlässigung, ungelöste Trauer, Zurückweisung die psychische Störungen auslösen, keineswegs angeblich innerpsychische Zustände wie den Todestrieb (Bowlby 2014).
Aus der Objektbeziehungstheorie entwickelt Müller-Pozzi (1984, 1985) sein Konzept des infantilen Entwicklungstraumas. Dabei rückt er den bereits von Ferenczi (1933) benannten Anteil der Introjektion wieder in den Mittelpunkt. Eine ähnliche Überlegung formuliert Andre Green (1983) mit seinem Konzept der toten Mutter. Damit meint er eine mütterliche Persönlichkeit, die sich aufgrund ihres depressiven Gemüts in eine quasi starre, seelenlose und tote Figur verwandelt. Das Kleinkind gerät dadurch in eine seelische Katastrophe, die zu einem völligen Sinnverlust führt. Das Kind identifiziert sich mit der quasi toten Mutter beziehungsweise der Introjektion der toten Mutter und dadurch entsteht eine innere Leere, die durch Hass, frühzeitige erotische Erregung und einer Überwertigkeit des Intellekts erfüllt wird.
Große Aufmerksamkeit bekommt im aktuellen psychoanalytischen Diskurs das Mentalisierungskonzept von der Arbeitsgruppe um Peter Fonagy (Fonagy 2000; 2002; Fonagy u. Target 1995; Fonagy et al.1993). Der Begriff ist ein Produkt aus der Summe verschiedener Gesichtspunkte aus der Objektbeziehungstheorie, Bindungstheorie, Säuglingsforschung und anderer psychoanalytischer Modelle und Konzepte von früher Mikrotraumatisierung. Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht die Betonung der zwischenmenschlichen Interaktion für die Symbolbildung. Hauptsächlich geht es also um die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit, die untrennbar ist von der Affektspiegelungstheorie (inklusive Affektmarkierung und Affektregulierung). Fonagy und seine Mitarbeiter verstehen Traumatisierung als mangelnde Fähigkeit der interpersonellen Interpretation und ungenügenden Mentalisation. Sie gehen von einem „attachment trauma“ (Fonagy 2003 S.441) aus, das praktisch allen Borderline-Persönlichkeitsstörungen zugrunde liegt. Das Konzept trägt nicht nur zum besseren Verständnis der frühen Entwicklung des Kindes bei, sondern es gewinnt auch zunehmend in der Forschung sowie in der Psychotherapie von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Bedeutung.
2.3 Das Konzept des sequenziellen Trauma nach Keilson
Einen weiteren Aspekt der Traumatisierung beleuchtet das Konzept der Sequenziellen Traumatisierung von Hans Keilson. Sein Konzept geht hervor aus einer nach dem zweiten Weltkrieg in den Niederlanden durchgeführten und 1979 erstmals publizierten Studie zur Erfassung des Schicksals jüdischer niederländischer Kriegswaisen. Seine Studie über das Schicksal jüdischer Kriegswaisen gilt als grundlegende Veränderung im Traumadiskurs. Keilsons Ziel war es die traumatische Wirkung des Krieges auf die „jüdischen Kriegswaisen in den Niederlanden“ in unterschiedlichen Lebensaltern zu erforschen (Keilson, 2003 S. 2). Strenggenommen waren die Kinder jedoch keine Opfer des Krieges, sondern des Völkermords durch die Nazi-Deutschen. Für die Studie untersuchte er eine Gruppe von 204 Kindern und Jugendlichen. Alle Kinder hatten ihre Eltern und einen großen Teil ihrer Familien verloren und überlebten die Verfolgung versteckt in fremden zumeist christlichen Familien. Ein sehr kleiner Teil der Gruppe überlebte die Haft in Konzentrationslagern. Aus dieser Untersuchung ging seine innovative und kreative Leistung – das Konzept der sequenziellen Traumatisierung – hervor (Keilson 2005, S. 427): Als ein erstes Trauma dieser Kinder definiert Keilson die Trennung von der Mutter. Das Lebensalter der Kinder spielt hierbei keine Rolle. Das zweite Trauma stellt die ständige Verfolgung und das heißt auch für ein Kind ständige Todesbedrohung dar. Die dritte Sequenz ist in den Schäden zu sehen, die die Kinder nach dem Krieg durch die Trennung von den Pflegefamilien und die folgende mangelhafte Betreuung in den Institutionen erlitten. Keilson ist weit davon entfernt, den Umgang mit den Kindern durch Organisationen und Behörden nach Beendigung der Verfolgung zu idealisieren. Die verschiedenen Traumaformen bedingen einander, sie bauen aufeinander auf und potenzieren sich unter Umständen.
Die größten Herausforderungen der Untersuchung waren dabei die vielfältigen traumatischen Ansatzpunkte in den jeweiligen Altersgruppen herauszustellen, ihrem kumulativen Charakter aufzuzeigen und die Wirkung der massiven, über eine längere Zeitspanne andauernden, wiederholten schweren traumatischen Erfahrungen in ihrer biografischen Repräsentanz darzustellen. So beschreibt der Begriff Traumatisierung nicht nur Extremsituationen, sondern kann potenziell auf jeden Menschen in jedem Lebensalter einwirken: in der Kindheit, der Adoleszenz und im Erwachsenenalter.
Demzufolge kann es eine sequenzielle Traumatisierung auch im Familienleben geben. Das unwillkommene Kind (Ferenczi, 1929) ist dafür prädestiniert. Sehr häufig werden zudem Kinder und Jugendliche, die in der stationären Jugendhilfe untergebracht sind, Opfer familiären Missbrauchs und familiärer Misshandlung. Im Wiederholungszwang findet das Kind immer wieder Situationen, in denen die ursprüngliche traumatische Situation wiederhergestellt wird. Keilson versteht die Traumatisierungen der sich entwickelnden Kinder nicht als Einbrüche der bedrohenden Außenwelt der Erwachsenen als Erschütterungs- und Zermürbungsvorgänge, sondern als traumatisch gestörte Entwicklungs- und Adaptionsvorgänge der Kinder als Prozesse des Regulierens und Steuerns. Hier wird zudem deutlich, dass er auch die Extremtraumatisierung als Entwicklungstrauma begreift. Ein komplexes Beziehungstrauma vollzeiht sich immer im Kontext von Beziehungen. Becker (2003, 25) fasst den Verdienst von Keilsons Studie folgendermaßen in Worte: „Damit ist Trauma vom Einschnitt zum Prozess geworden. Bei Keilson findet Trauma also in Sequenzen statt, wobei der zentrale Inhalt dieser Sequenzen die sozialpolitische Realität ist, d. h. hier die Verfolgung. Ganz zentral wird deutlich, dass das Trauma eben nicht mit der Befreiung endet, sondern nur in eine neue Sequenz übergeht (Becker, 2003, S. 25).
2.4 Transgenerationale Weitergabe bzw. Wiederherstellung von Traumata
Traumata können, egal welcher Natur sie sind, – sequenziell, kumulativ, äußere oder innere Traumata – an die nächste Generation weitergegeben werden. Traumatische Erfahrungen wie Krieg, Folter und aber auch im engeren sozialen Kontext der Familie oder der sozialer Gemeinschaften wie Misshandlungen, Missbrauch, Tötungsdelikte oder schwere Vernachlässigung und Deprivationen wirken in den Betroffenen und deren Nachkommen nach. Auch nicht in das eigene Seelenleben integrierte elterliche Traumatisierungen führen häufig zu problematischen Mustern in der Eltern-Kind-Beziehung und können die kindliche Entwicklung früh beeinträchtigen. In der Psychoanalyse bezeichnet der Begriff der Übertragung nicht nur ein unbewusstes Geschehen zwischen Therapeut/in und Klient/in im therapeutischen Prozess, sondern ist zudem eine der menschlichen Beziehungen generell begleitendes Phänomen, das sich auch in den Beziehungen zwischen Generationen findet und diese im positiven und negativen Sinn entscheidend beeinflussen kann.
Als transgenerationale Weitergabe wird das Phänomen bezeichnet, bei welchem unverarbeitete Traumata, Scham- und Schuldgefühle, Verhaltensweisen und Vorstellungen von Elterngenerationen an die Generation der Kinder und Enkel – der Nachfolgegeneration – weitergegen werden. Dementsprechend handelt es sich um die Folgen für das Leben der Nachfolgegeneration aufgrund der nicht zu bewältigenden Ereignisse im Leben der Vorgeneration (Unfried, 2013a). Hier sind weniger die biologischen Kriterien für die Zugehörigkeit zu einer Generation ausschlaggebend als bestimmte Erfahrungen und Einstellungen, die prägend und verhaltensbestimmend für die Vorgeneration sind. Die Übertragung des Traumas kann nach heutigem Erkenntnisstand auf unterschiedlichen Wegen geschehen: primär, sekundär, direkt oder indirekt sowie mit unterschiedlichen Auswirkungen und Reaktionen auf die Betroffenen. Kogan (1990) bezeichnet die Art und Weise des Prozessverlaufs als transgenerationale Transmission.
Systematische Erkenntnisse über transgenerationale Prozesse wurden erst formuliert, als die Nachkommen von Überlebenden des Holocaust sowie auch Nachkommen der Täterinnen und Täter des Zweiten Weltkriegs sich in Psychoanalysen oder tiefenpsychologisch fundierte Therapien begaben.
In den USA waren es auf Täterseite vor allem die Kinder der Vietnamveteranen, die aufgrund von Depressionen, unerklärlichen Schuldgefühlen oder Suizidgedanken und anderen Problemen therapeutische Hilfe suchten.
In den sechziger Jahren kamen zu den Erkenntnissen über die Folgen von Traumatisierungen bei den Betroffenen und den Einsichten aus Psychotherapien mit deren Nachkommen zunehmend die Erkenntnisse aus der Bindungs- und Kleinkindforschung hinzu. Diese Erkenntnisse zeigten auf welchen Wegen sich schon in frühesten Interaktionen zwischen Eltern und Kindern Elemente des unverarbeiteten elterlichen Traumas oder von verleugneter Schuld manifestieren können. So konnten vor allem die Arbeiten zur Säuglingsforschung in den USA belegen, dass es bereits sehr früh zu einer intensiven affektbasierten Kommunikation zwischen dem Säugling und seinen relevanten Bezugspersonen kommt. Der Säugling passt sich somit den emotionalen Mitteilungen seiner Bezugspersonen in seinen eigenen Rhythmen und Affektlagen an und, insofern diese von hoher Konstanz sind, adaptiert und habitualisiert sie (Sander LW. 2009; Stern DN. 1992). Dies konnte am Beispiel chronisch depressiver Mütter und ihren Säuglingen und Kleinkindern nachgewiesen werden (Bratzelton TB., Cramer BG. 1991).
Die transgenerationale Weitergabe von Trauma ist ein hoch komplexer psychologischer Prozess. Zur Erklärung dessen wurden mehrere sich teilweise integrierende und ergänzende, aber auch widersprechende theoretische Konzepte entwickelt. In einem Punkt besteht jedoch Einigkeit: Bei der Trauma-Übertragung auf die nachfolgende Generationen handelt es sich nicht um einen Determinismus (https://www.bundestag.de). In dieser Arbeit werde ich mich auf den psychoanalytischen Ansatz des Identifikationsprozesses konzentrieren. Dabei beginne ich mit einigen grundlegenden Bemerkungen zum Konzept der Identifikation: Identifikation ist ein zentraler Mechanismus, der die Generationen miteinander verknüpft. Durch diesen Identifikationsprozess modifiziert das Subjekt auf bewusstem oder unbewusstem Wege seine Motive und Verhaltensmuster ebenso wie seine Selbstrepräsentanzen und erlebt sie als ähnlich oder gleich mit denen des Objektes. Es ist wichtig, hier zu betonen, dass der Vorgang der Identifikation eine aktive Handlung des Subjektes ist, das sich auf diesem Wege dem geliebten Objekt, von dem es abhängig ist, annähert.
Vor diesem Hintergrund möchte ich nun den transgenerationalen Prozess der Weitergabe von Trauma beschreiben. Die Identifizierung findet nicht mit der Person oder Eigenschaften von Vater oder Mutter alleine statt, sondern auch mit deren Lebensgeschichte, insbesondre dem Teil, der vor der Lebenszeit der Kinder liegt.
Hilfreich für das Verständnis dieses Prozesses ist das Ergebnis von Rosemarie Barwinski. Sie ist die Leiterin des Schweizer Instituts für Psychotraumatologie (SIPT) in Winterthur. Romarie Barwinski (2013) und ihr Team sind aufgrund ihrer Studien zu dem Ergebnis gekommen, dass unter einer transgenerationalen Weitergabe von Traumata immer ein Beziehungstrauma zu verstehen ist. Laut Barwinski findet eine Weitergabe von traumatischen Erfahrungen auf der Ebene des Unausgesprochenen in der Beziehungsgestaltung statt. Meistens als Geheimnis und mit einer Verwischung der Grenzen zwischen Phantasie und Realität (Barwinski, 2013). Infolge dessen kann die Symbolisierungsfähigkeit bei einer Extremtraumatisierung zerstört werden. In diesem Zusammenhang ist Moré (2013) zu der Auffassung gelangt, dass dies für die zweite Generation „in Form einer Erstarrung der Phantasien, eines zeitlosen Konkretismus der Vorstellungen sowie eines fehlenden Zukunftsraums für Veränderungen“ (Moré, 2013, S.17) ersichtlich wird. Dementsprechend wird das Phänomen der transgenerationalen Traumatisierung so lange voranschreiten, bis über das Trauma offen gesprochen werden kann (Barwinski, 2013, S.109).
Ein weiteres Erklärungsmodell präsentiert der amerikanische Psychoanalytiker Phyllis Greenacre (1967). Er beschreibt „schwere Traumata, entweder als akutes Geschehen oder als chronische Zustände, bei nahen Angehörigen des Kindes, insbesondere der Mutter, können direkt so erfahren werden, als seien sie ihm selbst geschehen, wenn es sich in einem Stadium oder Zustand befindet, in den projektive introjektive Mechanismen vorherrschen“ (Greenacre, 1967, S.151). Prägend in diesem Zusammenhang ist dieser Aspekt aus dem Buch von Mathias Hirsch: Trauma als Begriff des „transgenerationale[n] Introjekt[s]“ (Hirsch, 2011, S. 49). Hirsch betont die kaum merkliche Implantation der traumatischen Erfahrung (wie einen Fremdköper) der Eltern im Kind. Aufgrund der psychoanalytischen Untersuchung der Kinder von Holocaust-Überlebenden spricht Judith Kestenberg von „Transposition“ (1989). Damit meint sie eine unbewusste identifikatorische Teilhabe an der vergangenen traumatischen Lebenszeit der Eltern. Dieser Identifiaktionstypus wird von Hydee Faimberg (1987) als Ineinanderrückung oder „Telescoping“ der Generationen bezeichnet. Sie sieht ein tyrannisches Eindringen einer Geschichte, und zwar einer fremden Geschichte, in das Subjekt (das Kind) (Faimberg 1987, S. 121). Laut Hirsch (2011) findet hier zudem das implantative Eindringen auch „eine Aneignung der Lebendigkeit des Kindes statt“. Hirsch erklärt: „Die traumatisierten (also narzisstisch bedürftigen) Eltern nehmen sich vom Kind, was ihnen nützt, und sind gekränkt und wütend, wenn es sich entfernt“ (Hirsch 2011, S. 49). Dieser Gedanke lässt sich zudem auf den von Ferenczi geprägten Begriff „Annexion“ der kindlichen Lebendigkeit zurückführen (Frenczi, 1985, S. 124f).
Besonders intensiv beobachtet wurde die transgenerationale Trauma-Weitergabe bei Überlebenden des Holocausts und deren Nachkommen (Bayern 2, 2015; Freyberger, Harald J., 2015; Kellermann, Natan P. F., 2011). Ergebnisse von Studien zeigen jedoch keine eindeutigen Ergebnisse für eine erhöhte psychische Erkrankungsrate bei Nachkommen von Holocaust-Überlebenden im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Deren Kinder hatten eher sogar eine Tendenz, besonders gut zu funktionieren (Kellermann 2008, S. 65). Allerdings zeigten klinische Studien eine erhöhte Vulnerabilität, insbesondere eine größere Anfälligkeit für Angststörungen, psychische Erkrankungen und Stress (Glaesmer H.,Reichmann-Radulesu A., Brähler E., Kuwert P., Muhtz C. 2011, S. 337). Für Nachkommen von Täterfamilien in Deutschland sind solche bevölkerungsbezogenen Studien schwerer realisierbar, da sich transgenerationale Übertragungen von Schuldverstrickungen mit den Übertragungen von Kriegstraumatisierungen, Fluchterfahrungen und Vergewaltigungen überschneiden und durchsetzen (Kellermann, 2011; Moré, 2013).1
2.4.1 Folgen von Extremtraumata für die zweite und die folgenden Generationen
Die Folge von Extremtraumata für die zweite und die folgende Generation der Überlebenden des nationalsozialistischen Regimes und des zweiten Weltkrieges sind mehrfach beschrieben worden (Grubrich-Simitis 1979; Kogan 1990; Bergamann M.S. 1995). Nachdem Udo Baer und Gabriele Frick-Baer in ihrer therapeutischen Arbeit immer wieder auf Klienten trafen, welche ganz offensichtlich an den Symptomen eines Posttraumatischen Stresssyndroms litten, jedoch keinen Anhaltspunkt dazu in deren Biografien boten, begannen sie sich mit der Thematik der transgenerationalen Weitergabe auseinanderzusetzen. Um dem nachzugehen, starteten sie ein eigenes Forschungsprojekt. In diesem führten sie narrative Interviews mit Söhnen und Töchtern traumatisierter Menschen (Baer & Frick-Baer, 2014). In den Forschungsberichten werden die Symptome des Posttraumatischen Stresssyndroms berücksichtigt und folgende vier Hauptsymptome werden veranschaulicht: Flashbacks, Erregung, Vermeidungsverhalten sowie emotionale Abflachung und Ängstlichkeit ( ebd. S.101). Die beobachteten Symptome zeigten sich in verschiedenen Aspekten als transgenerational weitergegebene Traumata bei den Betroffenen. So fanden Baer und Frick-Baer bei den Betroffenen unter anderem das Auftreten eines geringen Selbstbewusstseins, Selbstzweifel, ein Leben geprägt von Unstimmigkeiten, Scham- und Schuldgefühlen sowie Aggressivität, Konfliktscheue und noch Vieles mehr. Auffällig bei deren Fallgeschichten ist die große Bandbreite an Symptomen, welche verdeutlichen, wie schwer eine Vereinheitlichung der Reaktion eines Menschen auf ein bestimmtes Erlebnis ist (Baer & Frick-Baer, 2014).
Im Rahmen der Bindungstraumata sind die Kinder gezwungen die nicht mitgeteilten Geschichten der Eltern zu erfahren und die ungeliebten Emotionen der Eltern zu empfinden. Laut Grubrich-Simitis hört der Drang zu verstehen, wer sie wirklich sind, nicht auf (Grubrich-Simitis, 1979). Die Kinder werden sehr empathisch für die Bedürfnisse ihrer Eltern, sodass eine Art Rollenumkehr stattfindet. Sie sollen „ für die Eltern die Brücke der natürlichen Folge das psychische Leben schenken; sie sollen die verlorenen idealisierten Liebesobjekte ersetzen, gleichsam in deren abgebrochene Biographien schlüpfen und dort zu leben anfangen, wo diese zu leben aufhören mussten“ (Grubrich-Simitis 1979, S. 1006, 1008). Häufig wird in der dunklen Vergangenheit der Eltern qualvoll gegrübelt. Um die Leere mit Inhalt zu füllen, wird versucht, Symbole zu finden. Dies wird von Kogan (1990) als ein Verschmelzungsvorgang bezeichnet. In seiner Auffassung versetzen die Kinder sich in die Eltern hinein und versuchen in der Phantasie das Trauma der Eltern wiederzuerleben. Dadurch wird – so Kogan – die Projektion von Trauer und die Aggression der Eltern auf die Kinder erleichtert. Grubrich-Simits (1979) konnte beweisen, dass die Folgen dieser Vorgänge (Identifikation mit der Abspaltung der Affekte oder Introjektion der Affekte und automatisierten Ich-Bereich der Eltern) auf die zweite Generation (Kinder) genauso dramatisch sind, wie die der erste Generation (Eltern).
In der Psychoanalyse sind diese Vorgänge und deren Folgen nicht neu. Freud prägte in diesem Zuge den Begriff „ Infektion des Traumas“. Er stellte fest, dass Kinder, die sexuell missbraucht worden waren, ihre Geschwister auch missbrauchten. Aufgrund dieser Beobachtungen schreibt Freud: „Der Grund zur Neurose würde demnach im Kinderalter immer vonseiten Erwachsener gelegt, später an Hysterie zu erkranken“ (Freud, 1896c, S.445). In diesem Sinne entstehe eine familiäre Häufung in der „doch nur eine Pseudo-Heredität vorliegt und in Wirklichkeit eine Übertragung, eine Infektion in der Kindheit stattgefunden hat“ (ebd).
Noch präziser formuliert dies Mathias Hirsch. Laut Hirsch sei sexueller Missbrauch ansteckend und der sogenannte Erreger werde mittels Identifikation mit dem Aggressor, mit dem Täter und seiner Tat übertragen. Er stellt der Infektion mit dem Inzestuösen oder anders den traumatischen „ Virus“ in eine Art Familientradition traumatischer Einwirkungen, der immer weitergegeben wird. Es kommt häufig vor, dass „die Eltern von Opfern sexuellen Missbrauchs selbst Opfer von sexuellen Übergriffen gewesen, die die Entwicklung ihrer Fähigkeit, reife sexuelle Beziehungen aufbauen und ihre Kinder später genügend gut zu schützen, geschwächt haben kann“ (Hirsch, 2011, S. 51).
2.4.2 Auswirkungen schwerer Traumatisierungen der Bindungspersonen auf den Umgang mit ihren Kindern
Allen Autorinnen und Autoren, welche sich mit der Thematik der transgenerationalen Traumatisierung auseinandergesetzt haben, ist bewusst, „dass schwer traumatisierte Eltern entgegen ihrer bewussten Wünsche und Bestrebungen gerade in der hoch bedeutsamen Beziehung zu ihren Kindern die eigene Beschädigung unvermeidlich weitergeben“ (Quindeau & Rauwald, 2013, S.66). In diesem Sinne führt die Traumatisierung eines Elternteils dazu, dass dieser häufig nicht dazu in der Lage ist, seinen elterlichen Aufgaben nachzukommen und die Kinder vor den eigenen negativen Erfahrungen zu schützen (Quindeau & Rauwald, 2013, S.66). Es gilt dabei vier sich gegenseitig verstärkende problematische Ebenen zu benennen, welche die Funktionsfähigkeit als Elternteil durch unverarbeitete Traumatisierung beeinträchtigt:
- die Schädigung des Stressbewältigungssystems, welches zu Fehlalarmierungen des Bedrohungszentrums führt und dementsprechend Notfallreflexe auslöst
- Mentalisierungsdefizite, welche die Selbstreflexionsfähigkeit, Feinfühligkeit sowie Responsivität einschränken
- die Entwicklung von desorganisierten Bindungsmustern
- die Identitätsfragmentierung, welche dauerhaft das Ich-Bewusstsein durch traumaassoziierte Persönlichkeitsanteile bedroht (Hipp, 2014, S.28)
Die Folgen einer unverarbeiteten Traumatisierung beeinflussen demnach den Umgang des Elternteils mit seinem Kind in sehr hohem Maße. Die Kinder können unter anderem selbst zum Auslösereiz für eine Alarmierung des Bedrohungssystems werden, da der enge Kontakt zu ihnen mit dem eigenen Trauma in Verbindung gebracht wird. Als Folge darauf kann der Elternteil mit Kontaktvermeidung reagieren, was zum Beispiel in der Reduktion des Haut- und Blickkontaktes sowie in der mimischen Spiegelung und der Ansprache ersichtlich wird. Ein Frühwarnzeichen in diesem Sinne ist unter anderem die Weigerung der Mutter das Neugeborene zu stillen. Denn dabei kann die Mutter den Abstand zum Kind nicht kontrollieren und gefährdet deren Abgrenzung zur eigenen Traumaerfahrung. Für den Säugling und die Mutter bedeutet dies eine mangelnde Ausschüttung von Bindungshormonen, was die Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung behindert (ebd., S.28f).
Eine weitere Möglichkeit des Vermeidungsverhaltens ist die Flucht in Ersatzhandlungen, was ich als Selbsthilfemaßnahmen begreife, wie zum Beispiel den Konsum von Drogen und Alkohol, um die Realitätswahrnehmung zu verändern. In der Folge entsteht eine Gleichgültigkeit gegenüber den kindlichen Bedürfnissen, womit eine schwere Verwahrlosung einhergehen kann. Zudem wird durch die Senkung der Impulskontrollfähigkeit das Risiko von gewalttätigen oder sexuellen Übergriffen in der Eltern-Kind-Beziehung erhöht. Auch eine Flucht in die virtuelle Welt des Internets kann suchtartige Dimensionen annehmen. Hierbei kann der Elternteil durch eine zweite Identität seiner elterlichen Fürsorgepflicht entfliehen. Eventuell erfährt dieser dort Verständnis von anderen, lebt im Schein einer perfekten Phantasiewelt und muss seine Angst, Ohnmacht und Scham nicht mehr wahrnehmen. Die Kinder werden hierbei zu lästigen Eindringlingen, welche ein Symbol für den dysfunktionalen Alltag sind und drohen die heile Märchenwelt zu zerstören (Hipp, 2014, S.30f.).
Hipp beschreibt weiterhin, dass Kinder von Eltern mit unverarbeiteten Traumatisierungen, Bindungspersonen ausgesetzt sind, welche abwesend oder emotional nicht verfügbar sind. Die Bedrohungserwartung des Elternteils überträgt sich sehr früh auf das Kind, wodurch unter anderem das hyperaktive Panik-Bindungs-Parasympathikussystem das Explorationsverhalten des Kindes blockiert. Folglich werden altersentsprechende Entwicklungen und Lernerfahrungen verhindert (ebd., S.32).
2.5 Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe
Trauma und Traumafolgestörung sind laut aktueller epidemiologischer Untersuchungen bereits unter Kindern und Jugendlichen in der Allgemeinbevölkerung weit verbreitet (Landolt, Schnyder, Maier Schoenbucher u. Mohler-Kuo, 2013). Noch gravierender ist die Situation unter fremdenplatzierten Kindern und Jugendlichen. Um die aktuellen Forschungsergebnisse hierzu, die in den letzten Jahren im Bereich der Heim- und Pflegkinder erschienen, auf den Punkt zu bringen, schreibt Tarren – Sweeney: „Children and youth residing away from their parents in court-ordered care represent one of the most vulnerable and disadvantaged groups in Western society” (Tarren-Sweeney, 2008, S.345.)
Bisherigen Studien über das Ausmaß von psychosozialen Belastungen und traumatischen Erlebnissen bei fremdplatzierten Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe zeigen, dass diese in 60-80% der Fälle traumatische Erfahrungen oder Vernachlässigung erlebt haben und somit die Diagnosekriterien für mindestens eine psychische Störung erfüllen (Blower et al., 2004; Ford et al., 2007; McCann et al., 1996; Meltzer et al., 2003b; Schmid et al., 2008). Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen, die in der stationären Jugendhilfe betreut werden müssen, haben nicht nur eine traumatische Erfahrung gemacht, sondern sie waren kontinuierlich in inadäquaten Erziehungsbedingungen, Vernachlässigung und wiederholten traumatischen mit anderen zusätzlichen psychosozialen Belastungen ausgesetzt. Dementsprechend weisen viele dieser Kinder und Jugendlichen neben einer hohen Symptombelastung zudem eine hohe Komorbidität, das hießt mehr als eine psychische Störung auf, und leiden unter einer komplexen Psychopathologie, die durch Bindungsprobleme, unsichere Beziehungen, posttraumatischen Stress, Verhaltensauffälligkeiten, Substanzmissbrauch, deutlichen Aufmerksamkeitsproblemen und Hyperaktivität sowie selbstverletzendes Verhalten gekennzeichnet ist (Tarren-Sweeney, 2008).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit über Heimkinder?
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Heimkinder Symptomträger von Familientraumata sind, und untersucht die Auswirkungen schwerer elterlicher traumatischer Belastung auf die psychische Gesundheit ihrer Kinder. Es geht um unverarbeitete Familientraumata, die an die nächste Generation weitergegeben werden.
Was ist die persönliche Motivation für diese Arbeit?
Die Motivation basiert auf Beobachtungen und Erfahrungen der Autorin als psychologische Fachkraft in der Jugendhilfe. Sie hat festgestellt, dass traumatisierende Erlebnisse, die von den Jugendlichen berichtet werden, oft bereits in der Herkunftsfamilie vorliegen. Die Eltern scheinen selbst unter traumatischen Erfahrungen zu leiden, die sie unbewusst an ihre Kinder weitergeben.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Folgende Forschungsfragen werden untersucht:
- Sind traumatische Ereignisse die Ursache für das auffällige Verhalten der Kinder und Jugendlichen in der stationären Einrichtung (NEUStart)?
- Haben die Eltern oder ein Elternteil eine traumatische Erfahrung gehabt und ist diese die Ursache für deren psychische Belastung?
- Gibt es einen Zusammenhang (Ähnlichkeiten und/oder Unterschiede) zwischen traumatischer Belastung der Eltern und der Kinder?
- Liegen Traumatisierungen sowohl bei den Eltern und deren Kinder vor?
- Inwiefern gibt es einen Zusammenhang zwischen der Art des traumatischen Erlebnisses der Eltern und der Kinder (Wiederherstellung)?
Wie wird Trauma in dieser Arbeit definiert?
Der Begriff Trauma wird im Sinne der Psychoanalyse als eine seelische Verletzung verstanden, zu der es bei einer Überforderung der psychischen Schutzmechanismen durch ein einschneidendes Erlebnis kommt. Es werden verschiedene Definitionen und Konzepte von Trauma, einschließlich Kindertrauma, kumulatives Trauma und sequenzielles Trauma nach Keilson, beleuchtet.
Was bedeutet transgenerationale Weitergabe von Traumata?
Transgenerationale Weitergabe bezeichnet das Phänomen, bei welchem unverarbeitete Traumata, Scham- und Schuldgefühle, Verhaltensweisen und Vorstellungen von Elterngenerationen an die Generation der Kinder und Enkel weitergegeben werden. Es handelt sich um die Folgen für das Leben der Nachfolgegeneration aufgrund der nicht zu bewältigenden Ereignisse im Leben der Vorgeneration.
Was sind die Auswirkungen schwerer Traumatisierungen der Bindungspersonen auf den Umgang mit ihren Kindern?
Schwer traumatisierte Eltern können, entgegen ihrer bewussten Wünsche und Bestrebungen, ihre eigene Beschädigung unvermeidlich an ihre Kinder weitergeben. Dies kann zu einer Schädigung des Stressbewältigungssystems, Mentalisierungsdefiziten, der Entwicklung von desorganisierten Bindungsmustern und Identitätsfragmentierung führen.
Wie verbreitet ist Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe?
Studien zeigen, dass fremdplatzierte Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe in 60-80% der Fälle traumatische Erfahrungen oder Vernachlässigung erlebt haben und somit die Diagnosekriterien für mindestens eine psychische Störung erfüllen.
Welche Methodik wird für die empirische Befragung verwendet?
Für die empirische Befragung wird der von Tagey und seiner Gruppe entwickelte Selbstbeurteilungsfragebogen Essener Trauma – Inventar (ETI) für die Befragung der Eltern und das Essener Trauma – Inventar für Kinder und Jugendlichen (ETI-KJ) für die Jugendlichen benutzt.
Was ist das Ziel der Masterarbeit?
Das Ziel der Masterarbeit ist es, einen Beitrag zu einem größeren Verständnis über die transgenerationale Weitergabe von Trauma aufzuzeigen und neue Interpretationsmuster und Erklärungsangebote im Bereich der stationären Jugendhilfe zu liefern.
Details
- Titel
- Heimkinder. Symptomträger von Familientraumata?
- Untertitel
- Auswirkungen von schwerer elterlicher traumatischer Belastung auf die psychische Gesundheit ihrer Kinder
- Hochschule
- International Psychoanalytic University
- Note
- 1,00
- Autor
- Daniel Apobona Awenva (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 86
- Katalognummer
- V1034325
- ISBN (eBook)
- 9783346444844
- ISBN (Buch)
- 9783346444851
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- heimkinder symptomträger familientraumata auswirkungen belastung gesundheit kinder
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Daniel Apobona Awenva (Autor:in), 2020, Heimkinder. Symptomträger von Familientraumata?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1034325
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-







