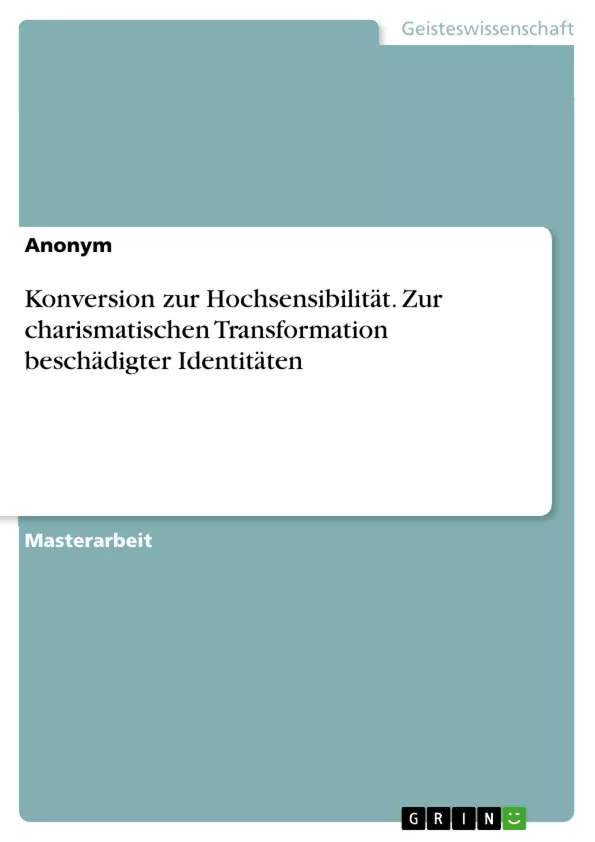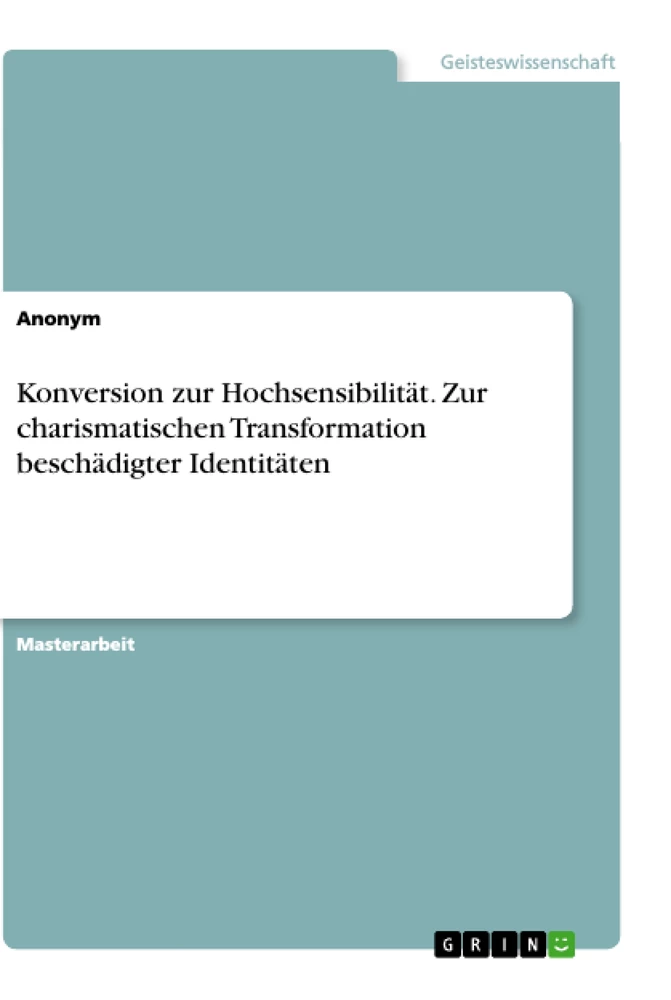
Konversion zur Hochsensibilität. Zur charismatischen Transformation beschädigter Identitäten
Masterarbeit, 2019
192 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2 Gegenstand: Hochsensibilitat
3. Theorie: Wissens- und kultursoziologische Rahmungen
3.1 EinmodernerWahrnehmungsmythos
3.2 Konversion
3.2.1 Spielarten von Konversion
3.2.2 Der Konversionsprozess
3.2.3 Konversionserzahlungen
3.3 Stigma
3.4 Charisma
3.5 Selbststigmatisierung
3.6 Das Schicksal des Helden
3.7 Zur situativen Inszenierung von Hochsensibilitat
4. Empirie: Ethnographische Erkundungen hochsensibler Sinnwelten
4.1 Methodologische Positionierung, Wahl des Forschungsfeldes und derMethoden
4.2 Kontaktaufnahmen
4.3 Theoretisches und empirisches Sampling
4.4 Datenerhebung
4.5 Besonderheiten des Materials und Implikationen fur die Auswertung
5. Auswertung
5.1 Die Umstande der Beschaftigung mit Hochsensibilitat
5.2 Der Erkenntnismoment und seine Folgen
5.2.1 Das plotzliche Evidenzerlebnis
5.2.2 Der allmahliche Erkenntnisprozess
5.2.3 Die biographische Neuinterpretation der personlichen Identitat
5.2.4 Die Herstellung von Intersubjektivitat: Hochsensibilitat als soziale Identitat
5.2.4.1 Die Rolle des Gesprachskreises
5.2.4.2 Die Reaktionen des Umfelds
5.3 Die Erfahrung von Defektivitat und Schuld
5.3.1 „Manifeste“ Stigmata Ill
5.3.2 „Latente“ Stigmata
5.4 Die Darstellung von AuBerordentlichkeit
5.5 Biographische Muster der Selbststigmatisierung
5.6 Entwicklungsstadien und Archetypen des Helden
6 Heldenbiographien
6.1 Mythos Hochsensibilitat: Eine damonische Erzahlung?
6.2 Konversion zur Hochsensibilitat
6.3 Zur narrativen (Re-)Konstruktion beschadigter Identitaten
6.4 Geburt und Transformationen des Charisma
6.5 Der Umschlag von beschadigten zu charismatisierten Identitaten
6.6 Der hochsensible Held und seine Abenteuer
7 Ausblick
7.1 Wahmehmung aus anthropologischer und soziologischer Perspektive
7.2 Sinnessoziologische Annaherungen an Hochsensibilitat
7.3 Hochsensibilitat als neue Institution des Selbst
7.4 Hochsensibilitat als Phanomen der Selbstermachtigung
Literatur
Internetquellen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Manifeste Krise und strukturelle Problemlagen
Abbildung 2: Latente Stigmata und Losungen durch die Konversion
Abbildung 3: Transformationen des Charisma
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Stigmata
Tabelle 2: Theorie-Ebenen
Tabelle 3: Transkriptionsschlussel nach TiQ
Anhang
Anhang A Kontaktaufnahme
Anhang B Erhebungsinstrumente
Anhang Bl Leitfaden
Anhang B2 Erhebung soziokultureller Daten und Datenschutzerklarung
Anhang C Interviewtranskripte
Anhang Cl Vanessa
Anhang C2 Samantha
Anhang C3 Mareike
Anhang C4 Thomas
Anhang C5 Sonja
Anhang C6 Beate
Anhang C7 Silvia
Anhang C8 Anne
Anhang C9Vera
Anhang CIO Lea
Anhang Cll Renate
Anhang C12 Brigitte
Anhang C13 Monika
Anhang C14 Sven
Anhang D Feldprotokolle uber die Interviewsituationen
Anhang Dl Vanessa
Anhang D2 Samantha
Anhang D3 Mareike
Anhang D4 Thomas
Anhang D5 Sonja
Anhang D6 Beate
Anhang D7 Silvia
Anhang D8 Anne
Anhang D9 Vera
Anhang DIO Lea
AnhangDll Renate
Anhang D12 Brigitte
Anhang D13 Monika
Anhang D14 Sven
Anhang E Tabellen u.a. Ordnungsschemata
Anhang El Tabelle Interviewdauern
Anhang E2 Tabelle Ubersicht Interviewpartner
Anhang E3 Fallzusammenfassungen
Anhang E4 Tabelle Narrative Konstruktion einer defektiven Identitat
Anhang E5 Darstellungen der Umstande der Beschaftigung mit dem Thema
Anhang E6 Tabelle Erkenntnismoment Ideencharisma
Anhang E7 Tabelle Charismatische Phanomenbereiche der Hochsensibilitat
Anhang E8 Tabelle Stigmative Phanomenbereiche der Hochsensibilitat
Anhang E9 Darstellungen biographischer Problemlagen
Anhang E10 Schaubild Metamorphosen des Charisma
Anhang Ell Schaubild charismatische Losungen der biographischen Problemlagen
1. Einleitung
Als Kulturwesen hat der Mensch die Fahigkeit, sich zu verwandeln. Anders als korperliche Transformationen, wie sie im Tierreich bei Insekten oder im Mythos zu finden sind, han- delt es sich bei menschlichen Verwandlungen um sozio-kulturelle, die die personliche Identitat und das Erscheinungsbild betreffen. Das Bedurfnis nach Verwandlungen kann als anthropologische Universalie angesehen werden. Zu finden sind sie in alien prahistori- schen und rezenten Kulturen (Stagl 2005: 153). Das ,,noch nicht festgestellte Thier“ (Nietzsche 1968: 79) braucht geradezu Verwandlungen, ja es ist suchtig nach ihnen. Es neigt jedoch dazu, diese in sozialen und kulturellen Prozessen erwachsenen und seinem Spieltrieb geschuldeten Gestalten als naturliche Dinge in der Welt zu betrachten (vgl. Stagl 2005: 165; vgl. Berger/Luckmann2003: 96).
Mit einer Form einer solchen sozio-kulturellen Transformation beschaftigt sich die vorliegende Arbeit: Stigmatisierte Subjekte kommen in Kontakt mit dem (zur Zeit noch) wissen- schaftlich umstrittenen psychologischen Konstrukt Hochsensibilitat (Langosch 2016; Sta- rostzik 2015; Paulus 2017), dessen Anerkennungsprozess seit seiner Erfmdung in den 1990er Jahren durch die Psychologin, Elaine Aron, bereits betrachtlich vorangeschritten ist.1
Die Erkenntnis, hochsensibel zu sein, lost bei Betroffenen regelmaBig hohe Erleichterung aus, da sie so ihr bisher als Makel empfundenes, schwer zu kontrollierendes Affektleben als Ausdruck einer zugrundeliegenden Begabung verstehen lemen und sich nicht mehr als psychisch gestort erfahren (vgl. Aron 2013: 35). Darauf verweisen schon die einschlagigen Titel der psychologischen Ratgeberliteratur: Hurra, ich bin hochsensibel! Und nun? (Roemer 2017).
Hochsensibilitat stellt keine Kategorie des ICD oder DSM dar,2 was dem Umstand ge- schuldet sein mag, dass es sich bei Hochsensibilitat nicht um eine Krankheit, sondern um ein neutrales Personlichkeitsmerkmal handeln soil. Die Gratwanderung zur Psychopatho- logie zeigt sich jedoch darin, dass sich eine ausgepragte Sensibilitat in der psychiatrischen Sinnwelt im ,sensitiven Beziehungswahn‘ (Kretschmer) und in der ,sensitiven Personlich- keitsstorung‘ (Tolle) als krankhafte Erscheinungsformen des ,sensitiven Charakters‘ mani Konversion zur Hochsensibilitat - Zur charismatischen Transformation beschadigter Identitaten festieren (vgl. Faust o.J.).3 In der aktuellen Ausgabe des DSM-5 tritt die ,Vermeidend- Selbstunsichere Personlichkeitsstorung4 (Cluster-C-Personlichkeitsstorungen) deren Nach- folge an: Uberempfindlichkeit gegenuber negativer Beurteilung, soziale Gehemmtheit und Insuffizienzgefuhle pragen auch dieses Krankheitsbild (APA 2018: 922), das eine Pra- valenz von 2,4% aufweisen soil (ebd.: 925).4Klages (1978: 1 f.) beschreibt die sensible und hochsensible Personlichkeit (Hochintellektuelle, Kunstler) als Grenzphanomene zwi- schen Normalpsychologie und Psychopathologie, die daruber hinaus Uberempfmdlichkei- ten gegenuberjeglichen Sinneseindrucken zeigen.
Elaine Aron zufolge soil sich Hochsensibilitat, anders als das pathologische Pendant im DSM, nicht nur auf solche mit Introversion einhergehende Symptome beschranken, son- dem auch bei Extrovertierten vorliegen konnen (vgl. Kapitel 2). Aron (2013: 30) macht Hochsensibilitat bei 15-20% der Weltbevolkerung aus, unabhangig von Kulturkreis oder sozio-kulturellem Status. Hochsensible Personen sollen mehr, intensiver und feiner wahr- nehmen, weil sie pro Zeiteinheit mehr Informationen als nicht-hochsensible Menschen zu verarbeiten hatten. Daher seien sie schneller uberstimuliert und neigten, um sich vor Reiz- uberflutung zu schutzen, zum sozialen Ruckzug und fuhrten haufig ein „EigenbrotlerIn- nendasein“ (Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilitat e.V. 2011). Besonders ausgepragt sei auch ihr Reflexionsvermogen, das sich auf „miteinander verknupften Meta- Ebenen einen hochdifferenzierten Zugang zur Welt, der Stellung des Ich darin und zur Metaphysik“ (ebd.) erschlieBe. Bei Uberreizung tendierten sie schneller zur Ausbildung psychischer Erkrankungen, weil die Grenze des Ertraglichen bei ihnen eher uberschritten sei. Ihr Ruckzug wurde dabei haufig als elitares Empfinden oder Snobismus missverstan- den. In Wahrheit stelle ihr Verhalten jedoch ein naturliches Fluchtverhalten als Schutzme- chanismus fur ihr schneller uberbelastetes Nervensystem dar.
So individual die Wahrnehmungsunterschiede bei Hochsensiblen, so unterschiedlich auch die Uberstimulation auslosenden Reize (ebd.). Hochsensibilitat soil gleichzeitig Fluch und Segen sein, auBergewohnliche Begabung und kann trotzdem dem Umfeld den Eindruck von psychischer Labilitat vermitteln (vgl. Aron 2013; Informations- und Forschungsver- bund Hochsensibilitat e.V. 2011).
In der medialen Berichterstattung wird Hochsensibilitat entweder affirmativ rezipiert, etwa durch die Presentation von Leidensgeschichten (Weber 2018) oder ihre Existenz wird ganzlich in Frage gestellt. Viele Experten (Mediziner, Psychologen) zweifeln an der Vali- ditat des Konstrukts (Paulus 2017; Starostzik 2015). Das Phanomen scheint in jedem Fall zu polarisieren.
Die sich mitunter in Gesprachskreisen vergemeinschaftenden Kollektive kampfen insbesondere auf medialen Plattformen um gesellschaftliche Anerkennung (zartbesaitet.net; hochsensibel.org etc.): „Hochsensibilitat ist keine Krankheit!“ (Strohmaier 2015; Dignos 2018), lautet die Parole (vgl. auch Aron 2013).5
Welchen Beitrag kann eine soziologische Analyse zum Verstandnis dieses auBergewohnli- chen Wahmehmungsphanomens leisten?
Die Umdeutung des im Faile von Hochsensibilitat offensichtlich degradierten Selbstver- standnisses, so die These der vorliegenden Arbeit, kann als Konversion beschrieben werden, die ihren Antrieb aus der Dialektik von Stigma und Charisma bezieht: Aus stigmati- sierten Subjekten werden so in spezifischer Weise charismatisierte Konvertiten. Damit unternimmt die folgende Argumentation den Versuch einer Synthese im Wesentlichen dreier kultursoziologischer Theoriedebatten, um die Dynamik verstehend zu rekonstruie- ren, die sich an die Erkenntnis anschlieBt, hochsensibel zu sein. Soziologisch formuliert verweist sie auf das Fraglichwerden, die Erschutterung uberkommener Ordnungen und daran anknupfende erforderliche Neuorientierungen. Mit dieser Problematik beschaftigen sich unter anderem sowohl die soziologische Konversionsforschung (etwa Snow / Machalek 1983; Stagl 2005; Knoblauch / Krech / Wohlrab-Sahr 1998) als auch die Charismafor- schung im Anschluss an Max Weber (etwa Gebhardt / Zingerle / Ebertz 1993; Gebhardt 1994). Wahrend sich Weber (1980) vorwiegend mit der Entwicklung von Charisma be- schaftigt hat, mit dessen Institutionalisierungs- und Veralltaglichungsprozessen, hat Lipp (1985) die Frage nach der Genese von Charisma gestellt und gezeigt, dass es als Kehrseite von Stigmata - zugeschriebenen, verinnerlichten und verfestigten sozialen Schuldmalen Konversion zur Hochsensibilitat - Zur charismatischen Transformation beschadigter Identitaten gelten kann. Sein Stigma und Charisma vermittelndes Konzept der Selbststigmatisierung zeigt die prinzipiell dialektische Dynamik abweichenden Verhaltens.
Die Erkenntnis, hochsensibel zu sein und deren Folgen sollen hier, ausgehend von der le- bensweltlichen Erfahrung der Betroffenen mit Mitteln der qualitativen Sozialforschung, teilstandardisierten Leitfadeninterviews und teilnehmenden Beobachtungen, rekonstruiert werden.
Dabei abstrahiert die vorliegende sozialwissenschaftliche Analyse von den expliziten oder impliziten integralen Erfahrungen der interviewten Einzelpersonen, auch wenn sie von ihnen ausgeht. Die sozialen Muster, die sich am Einzelfall zeigen, werden vielmehr her- vorgehoben und in einen systematischen Zusammenhang gestellt (vgl. Merton 1995: 128). Die dabei zu entfaltende Argumentation folgt der wohl vornehmsten Aufgabe soziologi- scher Theoriebildung, die in der Befremdung vermeintlicher Selbstverstandlichkeiten be- steht (vgl. Dellwing / Harbusch 2013: 15), um das Phanomen in soziologischen Kategorial- und Handlungszusammenhangen begrifflich zu strukturieren (Buhl 1972: 26). Es muss danach gefragt werden, was die Behauptung, Hochsensibilitat sei ein naturlich gewachse- nes Phanomen, im Sinne eines angeborenen Personlichkeitsmerkmals, sozial leistet (vgl. Dellwing 2014: 170). Auf Individualebene geht es um die Bedeutung von Hochsensibilitat fur das Selbstverstandnis und die Konsequenzen in der Lebenspraxis der Betroffenen.
Den Gutekriterien kultursoziologischer Forschung folgend (vgl. Albrecht 2015b), soil die Kulturbedeutung von Hochsensibilitat als kollektives Sinn- und Deutungsmuster herausge- arbeitet werden, da das Phanomen unter spezifischen gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen auftaucht und von sozial bestimmbaren zeitgenossischen Subjekten in typischer Weise als Selbstinterpretation angeeignet wird. Die Kulturbedeutung verweist schlieBlich darauf, dass die prinzipielle Kontingenz, gerade bei der Aneignung von Identity, nur einen kleinen Spielraum der Entscheidungsfreiheit und Deutungsvarianz des Sub- jekts ausmacht (ebd.: 24 f.).
Die vorliegende Studie setzt sich darum mit folgenden Forschungsfragen auseinander:
Welcher Typus gesellschaftlicher Akteure greift zum Selbstdeutungsmuster Hochsensibili-
tat und was leistet das Konstruktfur ihn im Rahmen seiner Selbstthematisierung? Inw/efern lassen sich typische Krisenerfahrungen im Hintergrund der Neuinterpretation der eigenen Identitat als hochsensibel ausmachen? Wie kann der Erkenntnismoment umschrieben werden und wetche Entwicklungsverlaufe schliefien sich an die Erkenntnis an, hoch
sensibel zu sein? Inwiefernfolgen die interviewten Personen bei ihren Erzahlungen bestimmten kulturellenMustern?
2. Gegenstand: Hochsensibilitat
Der Begriff „Hochsensibilitat“ (engl.: „Sensory-Processing Sensitivity44 oder „High Sensitivity44) geht auf die Forschungsarbeiten der US-amerikanischen Psychologin und Innovatorin des Konstrukts, Elaine Aron, zuruck. 1997 stellte sie in einer Gemeinschaftspublika- tion, im Journal of Personality and Social Psychology, die grundlegende Arbeit dazu vor (Aron/ Aron 1997: 345 ff.).
In diesem Artikel identifizieren Aron / Aron Hochsensibilitat als „unidimensional core variable44 (ebd.), ein Temperamentsmerkmal, das sie bei 15-25 % der menschlichen Spe- zies ausmachen. Diese sensorische Sensibilitat soil in einer leichteren Erregbarkeit des zentralen Nervensystems begrundet sein. Durch diese Reizoffenheit seien Hochsensible („HSP“ = „Highly Sensitive Person44, in deutschen Ubersetzungen auch „HSM“ = ,,Hoch- sensible(r) Mensch(en)44) schneller uberreizt, was besonders in reizintensiven Situationen leicht zur Ubererregung fuhre. Sie sollen ferner nicht nur mehr, sondern auch intensiver sich selbst und ihre Umgebung wahmehmen. Zu einem derart offenen Reizfilter und einer intensiveren Verarbeitung soil eine erbliche Disposition bestehen (Aron / Aron 1997: 345; Aron 2013: 30).
Aron / Aron (1997: 345) beginnen ihre wegbereitende wissenschaftliche Publikation mit einem Zitat, das an dieser Stelle rekapituliert werden soil, da es wichtige Elemente fur die spatere Analyse enthalt:6
I believe in aristocracy, though - if that is the right word, and if a democrat may use it. Not an aristocracy of power... but ... of the sensitive, the considerate... Its members are to be found in all nations and classes, and all through the ages ... there is a secret understanding between them when they meet. They represent the true human tradition, the one permanent victory of our queer race over cruelty and chaos. Thousands of them perish in obscurity, a few are great names. They are sensitive for others as well as themselves... considerate without being fussy, their pluck is not swankiness but the power to endure. (E. M. Forster, Two Cheers for Democracy)
Aron legitimiert den postulierten Unterschied zweier signifikant voneinander zu unter- scheidenden Gruppen hinsichtlich ihrer Sensibilitat vor allem durch Ruckgriff auf Experi- mente des russischen Physiologen Iwan Pawlow. Indem er menschliche Probanden unter- schiedlich hohen Beschallungen aussetzte, sei er zu dem Ergebnis gekommen, dass die ,transmarginale Hemmung‘, eine Schutzfunktion des Organismus, die den Korper vor Uberstimulation bewahrt, bei 15-20% der Probanden deutlich fruher erreicht ist, als beim Rest der Versuchspersonen (Aron 2013: 31). Dieser Umstand ist aus Perspektive der Hochsensiblen-Interessenverbande von hochster Bedeutung. Einer groBeren Gruppe Nicht- Hochsensibler (~85 %) (die in der Ratgeberliteratur von Aron (2013:12) auch als „Nicht- Sensible“ bezeichnet werden) soil eine Minderheit Hochsensibler gegenuberstehen (~15 %), was mittels einer bimodalen Verteilungskurve veranschaulicht wird (zartbesaitet o.J.). Als wichtig erscheint die Existenz einer unuberbruckbaren Kluft zwischen Hochsensiblen und Nicht-Hochsensiblen. Neuere psychologische Forschungsergebnisse, die, mittels stan- dardisierter, auf subjektiven Selbsteinschatzungen beruhenden Befragungen, Hochsensibilitat als einfach normalverteiltes Personlichkeitsmerkmal identifiziert haben sollen, werden angefochten (vgl. ebd.).
Retrospektiv wird Pawlows Forschung zur physiologischen Reizbarkeit fur das postulierte Konstrukt derart ausgelegt, dass Pawlow als Vorreiter der Entdeckung von Hochsensibilitat erscheint (vgl. ebd.). Aron (2013: 18) nutzt ferner C.G. Jungs Unterscheidung von Intro- und Extraversion, um Hochsensibilitat an eine tiefenpsychologische Tradition anzu- schlieBen. Anstatt Hochsensibilitat jedoch auf den introvertierten Typus zu beschranken, kann Hochsensibilitat bei beiden Typen als mogliches kombinatorisches Personlichkeits- merkmal vorkommen.7
Aron / Aron (1997: 345) vertreten die Auffassung, dass es sich bei der unterschiedlichen Sensibilitat Hochsensibler und Nicht-Hochsensibler um zwei divergente evolutionare Uberlebensstrategien handelt: aktive Erforschung und Erkundung (bei den Nicht- Hochsensiblen) oder stille Wachsamkeit mit tendenziellem Ruckzug (bei den Hochsensiblen) (vgl. ebd.), wobei die Hochsensibilitat mit einem evolutionaren Selektionsvorteil ver- bunden sein soil.8 Auch bei anderen Spezies sollen 20 % hochsensibel sein (Aron 2013: 30).
Aron entwickelte einen ordinal-skalierten 27 Item Fragebogen zur Erhebung von Hochsensibilitat (nach Art einer 5-Punkt-Likert Skala), den sie auf ihrer Online-Prasenz einem brei- ten wissenschaftlichen wie laienhaften Publikum zur Verfugung stellt (Aron 2019).9 Um Aron sind intemationale Forschungsnetzwerke entstanden, die nicht nur Informationen und Online-Tests zur Selbstdiagnose zur Verfugung stellen, sondern daruber hinaus auch an der Systematisierung und Spezifizierung, kurz: an der weiteren Rationalisierung des Kon- strukts arbeiten, die Aron selbst nicht leistete (vgl. Paulus 2017; Aron 2019; hochsensibel o.J.; zartbesaitet 2018). Hochsensibilitat wird dann etwa unterteilt in die Bereiche Sinnes- wahmehmungen, emotionale und asthetische Sensibilitat, wobei alle Bereiche sowohl als belastend als auch als Begabung erfahren werden konnen. Die erhohte Sensibilitat kann sich dabei auch auf nur einzelne Empfindungen beziehen, wie etwa Gerauschempfindlich- keit. SchlieBlich kann sie sich daruber hinaus bei jedem anders zeigen, was den Umstand erklart, dass einige darunter leiden, wahrend andere im Alltag keine Probleme haben sollen (Paulus 2017). Andere Differenzierungen erganzen zu den ersten beiden Bereichen einen kognitiven. Kognitiv Hochsensible sollen sich durch hochgradig komplexes analytisches Denken auszeichnen und vor allem im wissenschaftlichen und technischen Bereich heraus- ragen (zartbesaitet 2018). Hochsensibilitat erscheint als ebenso heterogen wie universal.
Selbst wenn es bisher keine einheitliche neuro-physiologische Theorie zur ursachlichen Erklarung von Hochsensibilitat gibt, wird davon ausgegangen, dass neuronale Aktivitaten bei Hochsensiblen weniger Hemm- als Erregungsprozessen unterliegen. Ferner soil der Thalamus, der neuronale Reizfilter, mehr Reize als bedeutsam bewerten, die so zum Be- wusstsein durchdringen (Psychotherapeutische Beratungsstelle fur Studierende (PBS) des Studierendenwerks Karlsruhe AoR). Nach einem Gen fur Hochsensibilitat suchte etwa eine kurzlich veroffentlichte Studie der Queen Mary University in London. An Aron anschlie- Bende wissenschaftliche Experimente, die mittels MRT (Magnetresonanztomografie) die intensivere Verarbeitung nachzuweisen versuchten, kamen zu keinen aussagekraftigen Ergebnissen. Ein zentraler wissenschaftlicher Einwand an Arons Konstrukt wird gegen- uber ihrer postulierten kausalen Konzeption von Hochsensibilitat laut: So kann unter statis- tischen Pramissen eine ausgepragte Feinfuhligkeit sowohl Ursache fur Depressivitat oder Angstlichkeit sein, als auch ihre Wirkung (Paulus 2017).
Das fur Hochsensible beanspruchte umfassendere Wahmehmungsvermogen gegenuber Feinheiten soil mit einer hoheren Nachdenklichkeit einhergehen und zu einer ausgepragte- ren Intuition beitragen (Aron 2013: 31): ,,Sie wissen einfach, wie die Dinge sein sollten, damit sie ihre Richtigkeit haben, oder wie etwas enden wird.“ (ebd.). Hochsensible seien mit einem ausgepragten sechsten Sinn gesegnet, unter ihnen befanden sich Hellseher, Kunstler, Erfinder ebenso wie besonders Gewissenhafte, Vorsichtige und Gebildete (ebd.).10
In Arons Konstrukt Hochsensibilitat sind die postulierte sensorische Empfindlichkeit fur Reize mit einer zwischenmenschlichen, emotionalen Sensibilitat sowiejener fur Werte und Normen verschmolzen, die alle als Resultate einer leichteren neuronalen Erregbarkeit betrachtet werden. Hochsensibilitat soil ebenso ursachlich fur abweichendes Verhalten sein (etwa fur „ubertrieben“ angstliches, aber auch depressives oder nach Stimulation suchen- des ,sensation seeking4), das in den Augen der umgebenden Gesellschaft als Willens- oder allgemeine Schwache, kurzum: als inferiorbetrachtetwird (vgl. ebd.: 13).
Hochsensible seien von jeher Priester, Richter und Berater an den Hofen von Konigen ge- wesen - sie wurden in der heutigen aggressiven Kultur und Gesellschaft nur meist ver- kannt. In den glucklichsten und am langsten wahrenden indogermanischen Reichen hatten sie noch eine respektable Funktion als Teil der erfolgreichen Regentschaft ausgefullt. Ob- wohl sie auch heute noch von uberlebenswichtiger Funktion fur die Gesellschaft seien und weiterhin etwa als Therapeuten, Historiker, Philosophen, Kunstler, Forscher und Schrift- steller wichtige Rollen ubernahmen, wurden sie von den Kriegem der Gesellschaft, den Nicht-Hochsensiblen, marginalisiert (ebd.: 47). Obwohl die Individualist jedes Hochsen- siblen stets betont wird, so wie Raum zur Abweichung von jedem der fur HSP als typisch erachteten Wesensmerkmale gestattet wird, werden die Nicht-Hochsensiblen als recht homogene Gruppe dargestellt, denen etwa zugeschrieben wird, laute Musik, Sirenengerau- sche und Menschenansammlungen als vollig normal zu betrachten. In ihrer negativ sankti- onierten Andersartigkeit scheinen die Hochsensiblen trotz aller individuellen Idiosynkrasi- en ebenso eine homogene Gruppe zu bilden, die das gemeinsame Leiden an der lauten Leistungsgesellschaftverbindet (ebd.: 27).
Der inzwischen zum Klassiker avancierte Ratgeber Sind Sie hochsensibel? (Aron 2013) beginnt mit geschilderten, denunzierenden Erfahrungen: „Heulsuse!“ „Angsthase!“, ,,Sei kein Spielverderber!“ (ebd.: 9), die scheinbar zum Schicksal des Hochsensiblen gehoren, da dieser Erfahrungskomplex in der Literatur und der medialen Berichterstattung einhellig zu finden ist (vgl. Heintze 2015; Schorr 2013). Aron (2013) regt hier ihre Leserschaft dazu an, sich vor „Idealvorstellungen unserer Kulturgesellschaft“ (ebd.: 42) zu schutzen, die auf kommerziellem Weg unerschrockene, oberflachliche Personlichkeiten glorifiziere und for- dert von Hochsensiblen, ihr auBergewohnliche Begabung als neutrales Personlichkeits- merkmal zu betrachten (ebd.). Hochsensible werden hier dazu angehalten:
1. sich selbst zu erkennen. Sie mussen verstehen, was es bedeutet, diese auBerge- wohnliche Begabung zu haben und werden dazu aufgefordert, genau in ihren Kor- per hinein zu fuhlen.
2. ihre Vergangenheit neu zu bewerten, mit dem Bewusstsein, dass sie schon immer hochsensibel waren.
3. ihre seelischen Wunden zu heilen. Sie werden sensibilisiert fur ihre erhohte Vulne- rabilitat und fur ihre radikale Verschiedenheit von anderen.
4. sich selbst zu helfen, indem sie das richtige MaB sozialen Ruckzugs und Einbrin- gung in die Gesellschaft zu kultivieren lernen, da sie in der Welt „wirklich ge- braucht“ werden (ebd.: 14).
Die Pionierin berichtet hier von ihrem eigenen Leidensweg: begonnen mit ihrer Kindheit, wo sie sich am liebsten vor dem familiaren Chaos versteckte (ebd.: 15). Erst nach mehre- ren Abbruchen ihres Studiums und eine gescheiterten, da zu fruh geschlossenen Ehe konn- te sie ihr Familiengluck und berufliche Selbststandigkeit genieBen, bis sie schlieBlich einen Zusammenbruch erlitt, von dem sie sich nicht so schnell erholte. Sie begab sich selbst in psychotherapeutische Behandlung und erfuhr von ihrer Therapeutin von ihrer auBerge- wohnlichen Sensibilitat. Sie selbst fasste diese Zuschreibung zunachst als Ausrede auf und konnte diesen Gedanken nur widerwillig annehmen. Die Therapeutin vermittelte ihrjedoch auch zugleich, dass es sich bei Sensibilitat keineswegs um eine Geistesstorung oder menta- le Desorientierung handele. Aron verbrachte weitere zahlreiche, aus ihrer Perspektive „vergeudete“ Jahre in Therapie, aber ihre Sensibilitat kristallisierte sich fur sie zum zentra- len Problem heraus. Sie entdeckte, dass sie nicht nur mit einem schon immer empfundenen Makel behaftet war, sondem dank ihrer Sensibilitat uber viele Gaben verfugte, wie Kreati- vitat, Weitsicht und Phantasie. Das Wissen um ihren Wesenszug veranderte ihr Leben und sie begann ihre Forschungsaktivitaten zur (Hoch-)Sensibilitat (ebd.: 17 f.).
3. Theorie: Wissens- und kultursoziologische Rahmungen
Im Gegensatz zum neurophysiologischen Reiz-Reaktions-Modell, das neben Arons geneti- scher und evolutionstheoretischer Erklarung zur Legitimierung des heterodoxen11 Kon- strukts Hochsensibilitat genutzt wird,12 geht die die hier vertretene soziologische Analyse weder davon aus, dass menschliches Handeln blinden Verhaltenszwangen unterliegt (vgl. dazu Luckmann 1986: 191),13 noch dass (eine wie auch immer geartete) Sensibilitat auf eine biologische Entitat zu reduzieren sei oder gar die Bedeutung der lebensweltlichen Erfahrung auf Thalamusaktivitaten (vgl. zu soziologischen Wahrnehmungstheorien Kapitel 7.1, 7.2).14
Abgesehen von den Monopolisierungsbestrebungen einer als auBergewohnlich konzipier- ten Sensibilitat, auf die im nachsten Kapitel eingegangen werden soil, geht es zunachst um eine hermeneutische Annaherung an Sensibilitat, um Hochsensibilitat naherungsweise sinnadaquat aufzuschlieBen.
Im geisteswissenschaftlichen Diskurs um Sensibilitat werden nach Mersch (2008: 177) im Wesentlichen zwei konkurrierende Paradigmen vertreten. In beiden: Affekttheorien einer- seits, Gabentheorien andererseits, zeigt sich der ambivalente Charakter von Gefuhlen, die von jeher nicht nur als Quelle von Feinfuhligkeit, sondem auch als Bedrohung erlebt werden und die es etwa durch Askesepraktiken zu beherrschen gilt. Gefuhle sind stets mehr- deutig und verweisen auf das griechische ,pathos‘, worunter sowohl das Erleiden als auch die Leidenschaften und die Fahigkeit zu leiden verstanden wird (ebd.).
Der Begriff ,Sensibilitat‘ taucht im 17. Jahrhundert auf und bezeichnet hier eine gewisse Empfanglichkeit des Menschen fur moralische Eindrucke, etwa gegenuber dem Wahren und Guten. Im 18. Jahrhundert unterscheidet Abbe Girard die ,sensibilite‘, die mehr von den Empfindungen (,sensation‘) abhangt, von der ,tendresse‘, die mehr vom Gefuhl (,sen- timent‘) herruhrt. Wahrend letztere in unmittelbarem Zusammenhang mit den lebhaften Regungen der Seele (Leidenschaften) gedacht wird, die aktiv auf ein Objekt bezogen sind, meint erstere mehr das passive Empfangen von Eindrucken. Greisen wird zu dem Zeit- punkt eine hohere Empfindsamkeit ,sensibilite‘ zugeschrieben, wahrend Junglinge uber eine ausgepragtere ,tendresse‘ verfugen sollen (Liebsch 2008: 24 f.).
Valerys intensive Auseinandersetzung mit Sensibilitat hat wesentlich zum Bedeutungs- wandel des Begriffs beigetragen. Bei ihm reicht das Spektrum vom physischen Schmerz uber Moral und Vemunft bis hin zu einer auBerordentlichen Sensibilitat: der poetischen (ebd.: 25 f.). Bestrebungen, Sensibilitat mit Intelligenz gleichzusetzen lasst er schlieBlich fallen und entwickelt eine Perspektive einer allgemein menschlichen Sensibilitat, die er keineswegs auf eine organische Reizung des Nervenkostums reduziert. Sensibilitat bezeichnet vielmehr die „Offenheit fur das Neue, das Unvorhersehbare, Ereignishafte bzw. einen Sinn fur ,standig Bevorstehendes‘“ (ebd.: 29). Valery (1995: 89, zit. n. Liebsch 2008: 29) postuliert ein ,,Gesetz der Sensibilitat“, das ,,in das lebendige System ein Element [...] von einer standig drohenden Unbestandigkeit“ einfuhrt. Sensibilitat bewirkt, dass ,,sie uns in jedem Augenblick jene Art von Schlummer unterbricht, die sich mit der grauen Mono- tonie der Funktionen des Lebens abfinden wurde“ (ebd.). Ein vollkommen sensibles Leben wurde sich demnach in einem standig wachsamen, ja schlaflosen, immer zu fur das Neue aufgeschlossenem Daseinsstil verkorpern, auch gerade in jenen Bereichen, die nicht als Sensation oder interessant wahrgenommen werden (ebd.).
Aus phanomenologischer Perspektive kann Sensibilitat als das verstanden werden, was das Subjekt der Wahmehmung als „Andersheit“ affiziert (ebd.: 30). Diese Moglichkeit zur Empfindung ist nicht auf ein „empfindliches Naturell“ oder Temperament zu beschranken, vielmehr liegt sie im „Wesen“ allgemein menschlicher Sensibilitat, die sich alltaglich und uber die Lebensspanne Uberforderung als auch Inspiration ausgesetzt sieht (ebd.: 31 f.). Sensibilitat vollzieht sich durch die unvorhersehbare Ereignishaftigkeit als unbedingte Herausforderung, sich dem Anspruch Anderer zu offnen, worin Inspiration und maBlose Uberforderung begrundet liegen (ebd.: 39).
Aus soziologischer Perspektive ist entscheidend, dass Sensibilitaten in Abhangigkeit ihres gesellschaftlichen Standorts einem sozio-historischen und kulturellen Wandel unterliegen. Soziale Gruppen wie Schichten als auch einzelne Individuen mogen unterschiedliche Aus- pragungen existentieller Sensibilitaten ausbilden und kultivieren (vgl. Rosa 2016: 54).15 Um die potentielle Bedrohlichkeit von Sensibilitat, der Affekte oder Gefuhle zu konkreti- sieren, erweisen sich Goffmans (1986: 106 ff.) Untersuchungen zur Verlegenheit als rich- tungsweisend. Verlegenheit zeigt sich ihm zufolge in objektiven Anzeichen und subjektiv empfundenen Symptomen von Verwirrung, mit der das mit „Reizuberflutung“ begrundete abweichende Verhalten verstanden werden kann. Als vollig verwirrt gilt, „wer seine moto- rischen und intellektuellen Krafte im Augenblick nicht fur die anstehenden Anforderungen einsetzen kann, so sehr er es auch mochte“ (ebd.: 110). Damit wird die Situation gewis- sermaBen ruiniert, da der Verwirrte zwar mit anderen zusammen, aber nicht ,,im Spiel“ involviert ist und sich seine Interaktionspartner gezwungen fuhlen mogen, ihre Aufmerk- samkeit vom Konversationsgegenstand ab- und sich der Storung zuzuwenden. Sie werden sich bemuhen, den Verwirrten wiederaufzurichten, ihn ignorieren oder sich von ihm dis- tanzieren (ebd.).
In jedem Fall gilt Verwirrung als Zeichen eines niederen Status, moralischer Schuld oder Schwache, sodass Anstrengungen unternommen werden, Verwirrung zu verbergen (ebd.: Ill) oder zu vermeiden, etwa indem gewisse Situationen gemieden werden. Verlegenheit ist nach Goffman (1986: 119) jedoch mehr ein Zeichen von Uberanpassung als von schlechter Anpassung. Er unterscheidet zwei Umstande, die Verlegenheit auslosen konnen: Im ersten Fall ist die Anwesenheit anderer nicht erforderlich. Dann geht es um die Angst, einer wenig interessierenden Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Im zweiten Fall bezieht sich Verlegenheit auf die reale oder gedachte Gegenwart anderer und resultiert aus der Absicht, einen guten Eindruck zu machen, von Motiven unabhangig (ebd.: 107). Weil der Einzelne uber verschiedene Formen des Selbst verfugt, kann von ihm in bestimmten Situationen gefordert werden, gleichzeitig an- und abwesend zu sein, woraus Verlegenheit resultiert, da er sich hin- und hergerissen fuhlt. Sein Selbst oszilliert dann in der Art seines Verhaltens (ebd.: 121). Hinter einem solchen Identitatskonflikt, so Goffman (1986: 122), verbirgt sich einer des Organisationsprinzips, da das Selbst im Faile vieler Projekte und Erwartungen nur aus der Anwendung legitimer Organisationsprinzipien auf sich besteht (vgl. dazu naherKapitel 3.3).
Was Goffman als Verlegenheit und Verwirrung bezeichnet, kommt Gehlens (2007: 120 f.) Uberlegungen zur Empfmdlichkeit sehr nahe, die fur ihn zujenen nicht primar genetischen Eigenschaften gehort, die er vielmehr als „sekundare Anpassungen an soziale Anspruche“ (ebd.: 121) betrachtet.16 Hier geht es weniger um eine Begabung oder Fahigkeit, sondern darum, ob die Person dem geforderten MaB an Versachlichung nachkommen kann (ebd.: 120). In der Empfmdlichkeit zeigt sich fur ihn, dass es eine „egozentrische Verkrampfung“ (ebd.: 121) zu verteidigen gilt, die die „Herausbildung entlasteter Automatismen mit ihrer innerlich und auBerlich versachlichten Orientierung“ (ebd.) stort. So mogen immer neue defensive „Jetztbewaltigungen“ notig werden, die die Betroffenen als auBerst belastend erfahren, da sie einen immensen „Affekt- und Willensaufwand“ (ebd.) bedeuten, mitunter mogen ihre Einstellungen „habituell unsozial“ und instabil sein - fur das soziale Umfeld hingegen mogen sie eine Belastigung darstellen (ebd.). Empfmdlichkeit oder Verwirrung ist insofern erhohter Stigmatisierungsgefahr ausgesetzt (Kapitel 3.3). Dieses Verhalten, einschlieBlich der damit verbundenen Ideologien, Gesinnungen, Selbstdeutungen und Ge- wohnheitsmotiven, mag sich gegenuber der Person verselbststandigen, womit sich die kausale Ruckbindung des Tuns auf ihre Affekte, Charakteranlagen oder Temperamentsmerk- male als ungenugend erweist (ebd.: 123).
Die fehlgehende Herausbildung entlasteter und entlastender Automatismen kann institutio- nentheoretisch aufgeschlossen werden. Mangelt es an stabilen Institutionen, ist der Mensch den zufalligsten Reizen schutzlos ausgeliefert (Gehlen 2007: 65). Erlebt das Individuum existentielle Orientierungslosigkeit, etwa durch verunsichemde Lebensumstande, uber- nehmen soziale Institutionen die Verantwortung fur sein Wohlbefinden, deren primare Funktion die auBengeleitete Beantwortung kollektiv geteilter Bedurfnisse ist (Tenbruck 1972: 70).17 Wenn dieser stabile Halt fehlt, ist es genotigt, ,,in dauemd wacher Bewusst- heit, in einer Art chronischen Alarmzustandes die Umwelt und [...] eigenes Handeln im- merfort sachdiagnostisch und ethisch zu kontrollieren, ja, jederzeit Grundsatzentscheidun- gen zu improvisieren“ (Gehlen 2007: 58). Valerys Uberlegungen zur Sensibilitat mogen unter diesem Aspekt zur Analyse von Hochsensibilitat aufschlussreich sein. Auf Seiten des Subjekts kann insbesondere das abrupte Bruchigwerden von Institutionen sich in Uberrei Konversion zur Hochsensibilitat - Zur charismatischen Transformation beschadigter Identitaten zung oder einer standigen Wachsamkeit zeigen, die die Hochsensiblen auf ihren offenen Reizfilter zuruckfuhren. Diese Verhaltensmuster mogen sich wiederum institutionalisieren (vgl. Kapitel 7.4). Nach Gehlen (1970) greift in Folge der Erschutterung institutionaler Ordnungen Verunsicherung um sich und erreicht die nervosen Zentren, weil die ungesiebten und drohenden Eindrucke sich als belas- tender Bestand sammeln, wahrend die freien Vollzuge auflaufen. So entsteht etwas, wie eine nach auBen verlegte Atemnot. Die affektive Verarbeitung erfolgt als Angst oder Trotz oder Reizbarkeit, auch als freundliche Zerstreutheit, die schlechthin alles hinzunehmen bereit ist, und die Reaktionen werdenvergrobert und vulgar, weil sie affektnahe bleiben (ebd.: 100 f.).
Institutionen bewahren den Menschen also vor Reizuberflutung, schutzen ihn vor perma- nentem Entscheidungsdruck und entlasten ihn von andauernder Motivbildung. Gelebt werden Institutionen als Systeme geteilter Gewohnheit. Sie liefern Handlungsmuster auf Ver- haltensebene, standardisierte Ideen auf der der Motive, um den individuellen Handlungs- apparat zu mobilisieren oder zu deaktivieren (Gehlen 1956, zit. n. Albrecht 2017: 7). Inwiefern sich die Erschutterung institutionaler Ordnungen nicht nur theoretisch, sondern auch empirisch bei den Erforschten rekonstruieren lasst, vor deren Hintergrund sich Konversionen vollziehen, wird die vorliegende Studie zeigen.
3.1 Ein moderner Wahrnehmungsmythos
Folgt man den Legitimationsbemuhungen der Innovatorin, so handelt es sich bei Hochsensibilitat nicht lediglich um eine „neutrale“ biologische Entitat als radikal divergierende Sensibilitatsauspragung, sondern um ein Privileg einer aristokratischen Geisteshaltung, die bei einer Minderheit von Reprasentanten der „wahren menschlichen Kultur“ durch alle Zeiten, Nationen und Gesellschaften hindurch vorkommen soil. Angesichts einer mehrheit- lich „nicht-sensiblen“ Welt, drohen Hochsensible trotz oder gerade wegen ihrer kulturellen Uberlegenheit unterzugehen. Da die Erftnderin auf kommerziellem Wege tiefgrundige Personlichkeiten als auBergewohnlich glorifiziert, man konnte sagen, „Ubermenschen“ propagiert, die im Besitz einer tieferen Wahrheit zu sein scheinen, da sie wissen, „wie die Dinge sein sollten, damit sie ihre Richtigkeit haben, oder wie etwas enden wird“ (Aron 2013: 31), scheint eine soziologische Analyse an den hier vertretenen „Idealvorstellungen unsererKulturgesellschaft“ (ebd.: 42) angemessen.
Mit Gebhardt (1994: 6 f.) kann formuliert werden, dass die Innovatorin Aron ein zu einer spezifischen Mentalitat verdichtetes und durch intellektuelle Arbeit abgesichertes, durchra- tionalisiertes Weltbild feilbietet, das den eigenen sozio-kulturellen Standort und die moglichen Stellungnahmen zur Welt zuverlassig angibt sowie Orientierungswissen und Hand- lungsanleitungen vermittelt. Die intellektuellen Prozesse, die in der sozialen Bewegung um Hochsensibilitat stattfinden, zeitigen eine dualistische Weltsicht, die mit starren Wertepo Konversion zur Hochsensibilitat - Zur charismatischen Transformation beschadigter Identitaten larisierungen einhergeht, „ubereindeutigen moralischen Zasuren, personalistischen Schuld- zuschreibungen und einem rigorosen Freund-Feind-Denken“ (ebd.). Insofern dieses Stadium erreicht ist, gilt es, die „Simplizitat der einmal aufgerichteten Feindbilder“ (ebd.: 7) zu verteidigen, da die gemeinschaftliche Synchronisierung der Affekte „keine sensiblen Zwi- schentone“ (ebd.) vertragt (vgl. Kapitel 5.2.4.1). So wird auch im Faile der Hochsensibilitat die Welt in eine homogene Gruppe HSPler und Nicht-HSPler unterteilt, wobei letztere letztendlich die Schuld am Leiden ersterer tragen. Die auf Grenzziehung gerichteten Akti- vitaten der Hochsensiblen-Interessenverbande zeugen von Selbstimmunisierung, die ihre kollektive Handlungsfahigkeit erhalten oder steigern soil (vgl. ebd.). Diese ,,Selbstbornie- rungen“ (Paris, zit. n. Gebhardt 1994: 6), die als konstitutiv fur das soziale Bewegungen abstutzende Gemeinschaftsgefuhl betrachtet werden konnen, werden insbesondere dann sichtbar, wenn die Existenz von Hochsensibilitat als Monopol einer 15-20%igen Minder- heit angezweifelt wird.
Nach Gebhardt (1994: 7) mussen sich soziale Bewegungen schlieBlich mit Trivialisierun- gen und Routinisierungen arrangieren und sind alltaglich mit einer Umwelt konfrontiert, die ihren Uberzeugungen und Praktiken gegenuber skeptisch eingestellt ist und die sie als befremdlich wahrnehmen - ein beidseitiger Prozess, der mit Wohlrab-Sahr (2013: 462) als „Boundary Work“ bezeichnet werden kann. Sie sehen sich gezwungen, mit der Welt Kom- promisse einzugehen oder sich um der Reinheit ihrer Ideale willen aus ihr zuruckzuziehen. Sind sie erfolgreich, munden sie in Institutionalisierungsprozesse (Gebhardt 1994: 7), wie bei Hochsensibilitat bereits im Gange (vgl. dazu Kapitel 7.3, 7.4).
Eine „gut verpaBte Ideologie“18 (Freyer, zit. n. Gehlen 2007: 59) mag den Mangel an Ko- harenz und Ordnung der Wirklichkeit bis zu einem gewissen Grad ausgleichen und stoBt insbesondere dann aufResonanz, wenn Institutionen bruchig werden.
Mit Barthes (2015: 11) kann Hochsensibilitat als moderner Wahrnehmungsmythos angesehen werden, fur den die Verwechslung von Natur und Geschichte charakteristisch ist.19
,,Der Mythos ist ein reines ideographisches System, in dem noch die Formen durch den Begriff motiviert sind, den sie reprasentieren, ohnejedoch auch nur annahernd die Totalitat der moglichen Representation abzudecken“ (ebd.: 275). Er ist dabei in der Lage, einen Sinn in eine Form zu transformieren, seine wesentliche Leistung ist eine der Deformation (ebd.: 277; 280).20 Fur Ricoeur (zit. n. Jamme / Matuschek 2014: 23) zeichnet sich ein Mythos dadurch aus, dass ,,er Form ist, und dass bei ihm das Symbol die Form der Erzahlung annimmt.“ Da die Realitat des Mythos die der Erzahlung ist, kann er als ursprungliche Form betrachtet werden, in der der Mensch sich reflektierend zur Welt in ihrer Totalitat in Beziehung setzt (ebd.: 19).Nach Berger / Luckmann (2003: 118) konnen Mythologien als archaischste Legitimationsformen von Sinnwelten gelten, indem sie von der dauernden Einwirkung heiliger Krafte auf die Alltagserfahrung ausgehen.21 Hochsensibilitat kann als menschliches Artefakt uber den Mythos hinaus als symbolische Sinnkonstruktion verstan- den werden (vgl. Kapitel 7.1), die in der Lage ist, unterschiedliche, jedoch typische le- bensweltliche Erfahrungsschemata abstrakt neu zu rahmen (vgl. Luckmann 1986: 198). Als sprachliche Objektivierung und Problemlosung ist diese symbolische Sinnkonstruktion aus einem bereits vorhandenen semantischen Inventar einer Gesellschaft hervorgegangen und verweist damit auf ebenso historische wie kollektive Bedeutungsstrukturen idealisier- ter und anonymisierter Erfahrungs- und Handlungsschemata (ebd.: 199 f.).
Mythen funktionieren dabei weltweit als Erklarungen, Sinnstiftungen oder Deutungen. Sie bewahren dem Menschen einen emotionalen, sinnlichen und affektiven Bezug zur Welt, insbesondere dort, wo rationale Welterklarungen legitimerweise dominieren. Als Sinnver- mittler sind Mythen insofern produktiv, als dass sie dem Menschen Auskunft daruber ge- ben, warum und wie es zu bestimmten Ereignissen gekommen ist und ihm den Weg wei- sen. Mythische Uberlieferungen konnen dabei in sich widerspruchlich und vielfaltig sein, sie sind kulturubergreifend weltweit verbreitet (Jamme / Matuschek 2014: 12 ff.). Mythen erfullen dabei im Wesentlichen folgende Grundfunktionen:
1) Sie vermogen es, uber Schuld und Unschuld zu entscheiden und vermitteln heilige Wahrheiten (kultisch-religiose Funktion).
2) Sie erzahlen die Geschichte einer Institution, eines Ritus oder einer gesellschaftli- chen Entwicklung (historisch-soziale Funktion).
3) Sie sind Ausdruck eines primaren kollektiven Narzissmus und dienen der Selbst- darstellung einer Gesellschaft (politische Funktion).
Sie sind zudem lehrhaft, da sie Beispiele zur Orientierung liefern und wirken asthetisch.
Mythen legitimieren gesellschaftliche Verhaltnisse (ebd.: 15), indem sie Kontingenz in Natur oder Schicksal verwandeln. Sie vermogen es mittels eines universalen Sinnzusam- menhangs Fremdheitserfahrungen des Einzelnen in der Welt zu heilen, indem sie die Vor- stellung ihrer Gleichgultigkeit aufheben (ebd.: 19).22
So kolonisieren im Faile der Hochsensibilitat etwa mechanische Vorstellungen uber das Wesen der Wahmehmung (vgl. dazu Kapitel 7.1, 7.2), wie die eines Reiz-Reaktions- Modells oder eines Wahrnehmungsfilters die Wahrnehmung der Mythenkonsumenten, die diese Formen mit individueller Vergangenheit und reichhaltiger subjektiver Sinnhaftigkeit anfullen. Die Konzeptualisierung von Hochsensibilitat durch Aron (2013: 31) als einer intensiveren, detaillierteren, umfassenderen und komplexeren und letztlich „Wahrheit sprechenden“ Wahmehmung (s.o.), lasst sich idealtypisch zum Anspruch auf absolutes Fremdverstehen (vgl. Schutz 2016) zuspitzen.23 Daruber hinaus wird ein autonomes Indi- viduum adressiert, das trotz seiner auBergewohnlichen Sensibilitat, die Fluch und Gabe zugleich ist, seinen Weg geht und sich damit von institutionellen Zwangen befreit.24
Ob es den Legitimationsexperten gelingen wird, mit wissenschaftlichen Mitteln einen „konservativen Mythos“ (Merton 1995: 151) zu legitimieren, der die gesellschaftlichen Strukturen (etwa bezuglich der Pragung der Wahrnehmung, aber auch der aus ihnen her- vorgehenden subjektiven wie kollektiven Leidenserfahrungen) verleugnet und behauptet, die aus strukturellen Problemlagen erwachsenen Frustrationen lagen in der „Natur der Dinge“ und kamen historisch wie kulturell in jeder Gesellschaft vor, wird die Zukunft zei- gen. Dieser Mythos lehrt die Gesetze des unvermeidbaren Schicksals und mag Feindselig- keit oder Ressentiment (ebd.) gegenuber einer als homogen wahrgenommenen „Leistungs- gesellschaft“ oder Gruppe „Nicht-Hochsensibler“ / „Nicht-Sensibler“ evozieren.
Was es Hochsensiblen ermoglicht, den Mythos affirmativ zu konsumieren, ist nicht die Tatsache, dass seine Absichten verborgen blieben.25 Das gerade geschieht nicht, sonst konnte der Mythos nicht derart wirksam sein, vielmehr werden die Absichten naturalisiert (Barthes 2015: 280). Indem der Mythos nicht als semiologisches, sondem als induktives System gelesen wird, werden aus Aquivalenten Kausalzuschreibungen. Dann liegt etwa eine mutmaBliche Reizuberflutung der Unfahigkeit des Subjekts zugrunde, Leistung zu erbringen, wahrend sein Gehirn auch dann mehr leistet als das des „Normalen“, wenn das Subjekt scheinbar nicht handelt (vgl. Kapitel 5.2.3).
Ideologisch gewendet wird dieser Mythos Barthes (2015: 11) zufolge in der „dekorativen Darstellung des Selbstverstandlichen“, wie sie auch im Faile der psychologischen und spi- rituellen Ratgeberliteratur, insbesondere dem Test zur Selbstdiagnose von Hochsensibilitat, zu finden ist (vgl. High Sensitivity 2017).26 Hiesige Legitimationsexperten sind mit Barthes (2015: 276) als Mythenproduzenten anzusehen, die vom Begriff ausgehend eine Form im Sinne einer Sinnfigur (Selbstverwirklichung) anbieten, die der mythenempfangliche Leser selbst mit subjektivem Sinn fullen kann, ahnlich wie in der Astrologie (vgl. ebd.: 216 ff.).27 Die vorliegende Arbeit widmet sich zum einen der Entmystifizierung von Hochsensibilitat, da sie sich wissenssoziologisch im Gefolge Mannheims als Ideologiekritik versteht (Tanz- ler / Knoblauch / Soeffner 2006: 8). Zum anderen will sie die Haltung des Mythenlesers einnehmen, um die wesentliche Funktion der Mythen zu enthullen, als den Mythos durch Demaskierung zu zerstoren, wie es fur Mythologen typisch ist (Barthes 2015: 276 f.). Die hiesige Auseinandersetzung mit Hochsensibilitat kann wohl am ehesten als Balanceakt zwischen diesen drei Lesarten der modemen Mythen urns hochsensible Subjekt betrachtet werden.28
Im Folgenden soil gezeigt werden, dass die symbolische Aufwertung und Neurahmung der Identitat als hochsensibel als Konversion angesehen werden kann (Kapitel 3.2, 5.2, 6.2). Stigmatisierungserfahrungen bilden dabei den Resonanzboden der Konversion (Kapitel 3.3, 5.3, 6.3), die schlieBlich in ideencharismatische Selbstdeutungen (Kapitel 3.4, 5.4, 6.4) umschlagen. Dieser Prozess wird vermittelt durch Selbststigmatisierung (Kapitel 3.5, 5.5, 6.5). Mythologische Heldenfiguren vereinen in sich diese Transformation, die sich idealty- pisch in den interviewten Hochsensiblen verkorpem (Kapitel 3.6, 5.6, 6.6).
3.2 Konversion
Der lateinische Begriff ,convertere‘ bedeutet soviel wie verwandeln, verandem, umwenden (Wohlrab-Sahr 1995: 287; vgl. Stagl 2005: 153). Ob als religiose Erfahrung, Gnadenemp- fang, Wiedergeburt oder Erlangung von Gewissheit gefasst (James 1997: 209), als Meta- pher des Lebensweges bedeutet Konversion die Abkehr vom schlechten, unheilbringenden Weg zum heilsbringenden, der zur Erlosung fuhrt (Stagl 2005: 153). Subjekt des Wandels ist fur James (1997: 209) ein gespaltenes ,Selbst’, das sich schlecht, minderwertig und un- glucklich fuhlt, durch die Konversion aber, gestutzt auf eine neue Wirklichkeitsauffassung, einen uberlegenen Zustand der Ganzheit, des Glucks und Rechtsbewusstseins erreicht. Konversion kann als Prozess soziokultureller Verwandlung gelten, an dessen Ende der Betreffende ein anderer geworden ist, als er es vorher war (Stagl 2005: 164). Die Konversion kann sich dabei plotzlich oder prozesshaft vollziehen (James 1997: 209). Anders als James, der Konversion als grundsatzlich positiv bewertet und bewusst deren soziale Kom- ponenten ausblendet (Stagl 2005: 154), geht es im Folgenden darum, mit einer moglichst werturteilsfreien Haltung gerade die sozialen Aspekte des Wandels subjektiver Wirklich- keitserfahrung herauszuarbeiten.29
Fur Snow / Machalek (1983: 265) kommt Konversion einem Wechsel des Diskursuniver- sums gleich, einem displacement of one universe of discourse by another and its attendant grammar or rules for putting things together“ (ebd.).30 Konvertiten ubernehmen typischer- weise nicht lediglich einzelne Meinungen, Haltungen oder Einstellungen, sondern ein recht geschlossenes „welterfullendes“ Interpretationsmuster, welches ihnen eine konsistente Perspektive und Erfahrung der Wirklichkeit liefert (Stenger 1998: 197). Bei Konversion handelt es sich so gesehen um einen Wechsel des Erfahrungen organisierenden Rahmens (vgl. Wohlrab-Sahr 2001; Wohlrab-Sahr 1998: 126). Damit ist weit mehr gemeint, als der bloBe Austausch von Rhetorik oder Deutungsmustern (vgl. Wohlrab-Sahr 1995: 287 f.; Wohlrab-Sahr 1998: 126). Wissenssoziologisch kann von einer Transformation der ord- nungsstiftenden Dimensionen von Realitatsauffassungen die Rede sein (vgl. Sprondel 1985: 551).31
Zur Verbindung dieser Bestimmungen schlagt Wohlrab-Sahr (1995: 289 f.) in Anlehnung an Kuhn (1979) vor, Konversion als Paradigmenwechsel zu definieren.32 So wird der Wan- del eines Selbst mit dem seiner Deutungsmuster verschrankt. Damit soil dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Konversion als Losungsversuch fur zentrale biographi- sche Probleme angesehen werden kann (ebd.: 290). Die alte biographische Problematik zeichnet sich auch nach der Konversion noch ab. Was aber in der Konversion deutlich wird, ist eine strukturell neue Form der Problemlosung (ebd.).33 Konversionen sind Indika- toren dafur, dass bestimmte uberkommene soziokulturelle Wirklichkeiten problematisch geworden sind. Damit wird die Frage virulent, was das neue Paradigma im Gegensatz zum alten leisten kann, weiche Problemlosungen es bereit halt (ebd.: 292).
Eine alternative Form des Identitatswandels zur Konversion ist die Alternation. Wahrend die Konversion einen Bruch mit der fruheren Identitat voraussetzt, eine tiefe Krise impli- ziert sowie mit einer radikalen Reinterpretation der subjektiven Wirklichkeit einhergeht und auf einem absolutistischen Organisationsprinzip beruht, ist die Alternation weniger ausschlieBlich gegenuber altemativen Sichtweisen. Sie verlauft im Gegensatz zur Konversion kontinuierlich, ihr geht mehr eine Identitatserweiterung als eine Identitatskrise voraus (Wohlrab-Sahr 2002: 79).34
Fur Konversionen hingegen sind Resozialisationen notig, die sich in einer Gemeinschaft von Vertretern der neuen Wirklichkeitsordnung vollziehen. Konvertiten wechseln also nicht nur das Diskursuniversum, sondern orientieren sich auch im sozialen Raum um: sie streben die Mitgliedschaft neuer sozialer Gruppierungen an (Knoblauch 1998: 248). Resozialisationen ahneln der primaren Sozialisation insofern, als dass dem sozialisierenden „Personal“ seiner Bedeutung nach die Rolle signifikanter Anderer zukommt, mit denen sich die Novizen identifizieren, die sie bewundern und sich zum Vorbild nehmen (Berger / Luckmann 2003: 168). Die Plausibilitat der neuen Wirklichkeit, meist eine ausgearbeitete Weltanschauung (Sprondel 1985: 552), wird dem Konvertiten durch diese signifikanten Anderen vermittelt. Ohne die tiefgreifende Identifikation, an die sich intensive Gefuhle Konversion zur Hochsensibilitat - Zur charismatischen Transformation beschadigter Identitaten heften mogen, kommt es nicht zu einer derart radikalen Transformation der Wirklichkeits- ordnung (Berger / Luckmann 2003: 168).35
Konversionen konnen als institutionalisierte Vorgange begriffen werden, durch die Suchende Zugang zu Weltanschauungsgruppen erhalten. Ebenso wie man die Mitgliedschaft in einem Sportverein durch das Ausfullen eines Formulars und die Zahlung eines Beitrags erwirbt, erhalt man Zugang zu Weltanschauungsgruppen durch das Erleben eines inneren Wandlungsprozesses, der der betreffenden Gemeinschaft als Beleg fur die wahre Zugeho- rigkeit des Anwerbers dient (Sprondel 1985: 557).36
Nach Luckmann (1987: 38) setzen Konversionen einen Kanon, beruhend auf gesellschaft- lich entwickelten Zwangsapparaten voraus. Fur die gesellschaftliche Ausbildung eines Kanons genugen Institutionalisierungsprozesse von Macht wahrend allgemeiner Differen- zierungsprozesse auBerhalb von Verwandtschaftssystemen. Typischerweise bildet sich ein Expertentum, das sich auf die Legitimierung des kognitiven kanonischen Bereichs spezia- lisiert (ebd.: 39). Ein Kanon regelt einen bestimmten Bereich gesellschaftlicher Sinnpro- duktion, indem er Handlungsmoglichkeiten innerhalb seines Gebiets eingrenzt und festlegt. Er kommt durch eine Mischung aus Aushandeln und Zwang zustande, verfugt uber Sankti- onsmoglichkeiten und ist Bestandteil gesellschaftlich objektivierter Wissensbestande.37 Sinnvoll kann von Konversionen aber erst dann die Rede sein, wenn sich parallel zu oder in Folge von Ausgliederungen eines „religiosen“ Bereichs und seiner kanonischen Festle- gung durch Leistungen von „Experten“ auch eine besondere, auf alltags-transzendente Wirklichkeiten bezogene Wissens- und Handlungskonstellation ausbildet, die sich auch bei „Laien“ ausbreitet (ebd.). Hochsensibilitat erscheint als Phanomen vor kategorial expan- dierenden psychiatrischen Diagnosemanualen (DSM, ICD), die als Kanon festlegen, wel- che Erscheinungsformen als pathologisch zu definieren sind.38 Arons Werke zur Hochsensibilitat sind mittlerweile zum kanonischen Klassiker avanciert, die alltags-transzendente Wahmehmungsweisen postulieren und sich explizit gegen psychiatrische Pathologisierung zur Wehr setzen. Die vorliegende empirische Untersuchung wird zeigen, inwiefern deren Wissens- und Handlungsformen unter den Interviewpartnern diskursiv verbreitet sind (vgl. Kapitel 5 und 6). Inwiefern die Umdeutung der eigenen Identitat als hochsensibel als Konversion gelten kann, wird empirisch zu beantworten sein.
3.2.1 Spielarten von Konversion
Es handelt sich bei Konversionen keineswegs um ausschlieBlich religiose Phanomene (vgl. Wohlrab-Sahr / Krech / Knoblauch 1998: 9). Vielmehr sind kulturelle Konversionen all- gemeine Muster von Verwandlungen, wenn man Kultur als System kollektiver Sinnkon- struktionen und Praktiken begreift, mit denen Menschen Wirklichkeit definieren und her- vorbringen(vgl. Stenger 1998: 197).
James untersuchte vorwiegend solche Formen von Konversion, die Stagl (2005: 155) als „Erweckung“ bezeichnet und die dem kalvinistischen Individualismus wesensverwandt sind. Eine weitere Variante stellt der „Ubertritt“ von einer (religiosen) Gruppe zu einer anderen dar, wobei das Moment des (von sozialen Bezugsgruppen haufig als negativ be- werteten) Abfallens vom einen und die Zuwendung zu einem neuen Glauben besonders deutlich wird. Eine dritte Spielart von Konversionen ist die „Berufung“. Wahrend die Er- weckung zu einem selbstbestimmten religiosen Leben fuhrt und der Ubertritt einen Wech- sel der Weltanschauungsgemeinschaften umschreibt, wendet sich der Konvertit bei der Berufung einer institutionalisierten religiosen Sondergruppe zu, etwa einem Orden oder einer Kongregation (ebd.).
Wahrend traditionell religiose Konvertiten eine Heimat finden, bleiben esoterische auf Wanderschaft. Der Weg nach innen und der zu groBen Transzendenzen (Luckmann)39 (vgl. Kapitel 7.1) laufen zusammen, wenn der Kontakt mit dem hoheren Selbst gelingt. Selbst- entdeckung und -erfahrung werden hier spezifisch kultiviert, es gilt, die eigene Gottlichkeit in sich selbst zu finden (Stenger 1998: 216). Die Wanderschaft mag den zum esoterischen Kontext Konvertierten durch unterschiedliche okkulte Subwelten fuhren. Der Wechsel des esoterischen Engagements wird nicht etwa als Unernsthaftigkeit, sondern vielmehr als Be- leg fur die Hingabe an die eigene innere Fuhrung gesehen (ebd.: 213). Bei der Transformation der esoterischen Wirklichkeitsordnung ist besonders die Radikalisierung der Ichzent- rierung soziologisch interessant, die mit einer Forcierung der Reflexivitat einhergeht. Das Innenleben des Konvertiten wird zum Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit, in gesteigerter Form als zuvor. Er lernt, sein Inneres und die Ereignisse der auBeren Welt mittels esoteri- scher Kategorien zu ordnen. So wird aus ihm ein Sehender, dem sich plotzlich Muster und Zusammenhange offenbaren (ebd.: 217). Zur Stabilisierung seiner neuen Wirklichkeits- ordnung benotigt aber auch der Esoteriker die soziale Bestatigung seiner Weltanschau- ungsgemeinschaft. Die von normativer Freiwilligkeit gepragte esoterische Szene ubt je- doch, anders als uberkommene institutionalisierte Glaubensgemeinschaften, nur geringe soziale Kontrolle aus. Die letzte religiose Autoritat stellt das Individuum selbst dar. Ver- bindlichkeit, Organisationsstruktur, ein Kanon an Lebensregeln oder Verhaltensvorschrif- ten fehlen (ebd.: 218). Die Konversion zur Esoterik ist nicht zuletzt auch deshalb bequem und darum attraktiv, da RechtfertigungsmaBnahmen bezuglich der Wahrhaftigkeit der in- neren Verwandlung weitestgehend entfallen (ebd.: 219). Kommt es zu Auseinandersetzun- gen zwischen Konvertiten und Gemeinschaft bezuglich der „richtigen“ Lebensform oder Verhaltensnorm, sind die Sanktionschancen gleich verteilt: Der Konvertit kann die Gemeinschaft ebenso mit Verlassen bestrafen wie die Gruppe den Abweichler ausschlieBen kann (ebd.: 218 f.). Diese Konversionsform kann nach Stenger als weiche beschrieben werden. Von harten Konversionen unterscheiden sie sich vor allem im Grad der sozialen Kontrolle, die auf den Konvertiten ausgeubt wird. Hierarchisierungsgrad und Sanktions- machtigkeit der aufnehmenden Gruppierung sind bei harten Konversionen deutlich starker ausgepragt, die individuellen Freiheitsgrade des Konvertiten hingegen beschrankter als bei der weichen Konversion. Die Kosten von Dekonversionen entscheiden nicht zuletzt uber die Harte einer Konversion (ebd.: 219). Wahrend bei harten kulturellen Konversionen die Gefahr des Scheiterns aufgrund der Rigiditat des Wandels und seinen sozialen Folgen stets immanent bleibt, zeichnen sich weiche Konversionen durch hohe Erfolgswahrscheinlich- keiten aus. Dies nicht zuletzt auch deswegen, da sie die ,naturliche Einstellung‘ (Schutz 2016: 141) langfristig nicht erschuttern. Alltagliche Wissensbestande sind muhelos an- schlieBbar an das neue Sonderwissen (Stenger 1998: 219), wie auch im Faile von Hochsensibilitat, deren Konversion somit als weiche, esoterische gedeutet werden kann, die empirisch auch den Charakter einer traditionell religiosen annehmen kann (vgl. Kapitel 6).
3.2.2 Der Konversionsprozess
Nach Stagl (2005: 156 ff.) konnen funf idealtypische Phasen des Konversionsprozess beschrieben werden:
1. Ablosung
2. Umorientierung
3. DasKonversionserlebnis
4. VerratundZudringlichkeit
5. HeiligungundRuckfall
Zu 1. Am Anfang steht der Uberdruss mit sich selbst, der bestehenden sozio-kulturellen Ordnung und deren Sinngebung, insbesondere bei jenen, die einen Widersprich zwischen ihren Lebensumstanden und ihrem Selbstgefuhl empfinden. Krisensituationen, etwa preka- re soziale Lagen, wie sie bei frustrierten Absteigem oder blockierten Aufsteigem als auch allgemein sozialen Randseitem auftreten, begunstigen die innere Distanzierung, die in eine Sinnkrise mundet: der Uberdruss wird zum Motor der Sinnsuche.40 Der Suchende findet sich mit den vorgegebenen Sinndeutungen nur noch solange ab, bis sich ihm bessere of- fenbaren. Personliche Orientierung und der Sinn des Lebens werden zum zentralen Problem. Seinem sozialen Umfeld mag sein Verhalten als Monomanie erscheinen, seine Ein- stellungen und Handlungen als sonderbar. Es kommt zur beidseitigen Entfremdung zwischen dem Sinnsucher und seiner Umgebung. Sozialer Ruckzug geht Studien zufolge dem Konversionserlebnis voraus - die Einsamkeit wird gesucht, wie auch haufig die Umgebung gewechselt (Stagl 2005: 157).41 Fur die Heilsvermittlungsangebote seiner bisherigen Religions- oder Kulturgemeinschaft (hier: der Psychiatrie / Psychotherapie) stellt der Konvertit als Abtrunniger eine Bedrohung dar.
Zu 2. In der Phase der Umorientierung wird die uberkommene Ordnung und deren Deu- tungen fragwurdig, der Suchende offnet sich fur fremde Lehren. Dies kann als rein intel- lektuelles Interesse dargestellt werden, jedoch zeigen empirische Studien, dass im Vorfeld einer Konversion soziale Beziehungen zu Reprasentanten fremder Heilsvermittlungsangebote aufgenommen werden. Der Suchende gerat mehr oder weniger zufallig an solche Per- sonen, ob er den rein gedanklichen oder personlich-leiblichen Kontakt zur religiosen Gruppe sucht, ist eine Frage seiner Personlichkeitsstruktur. Sind die zu uberbruckenden sozio-kulturellen Distanzen bei der Erweckung gering, so nehmen sie bei der Berufung und demUbertrittdeutlichzu(ebd.: 158).
Zu 3. Das Konversionserlebnis kann sich sowohl plotzlich und dramatisch ereignen, als auch uber einen langeren Zeitraum vollziehen. Insofern es sich um ein punktuelles Ge- schehen handelt, wird es haufig als Ergriffenwerden geschildert, wobei die Gefuhlerschut- terung nach auBen hin sichtbar ist (ebd.: 159). Diese emotionale, existentielle Erschutte Konversion zur Hochsensibilitat - Zur charismatischen Transformation beschadigter Identitaten rung, wird im christlich-religiosen Kontext als direkte Berufung durch Gott gedeutet, in jedem Fall handelt es sich um eine auBeralltaglich erzeugte Erregung und Erschutterung, die zum Anlass eines inneren Wandels wird und zum Uberdenken des vergangenen Lebens geradezu zwingt (Sprondel 1985: 554 f.). Wahrend dieser biographischen Rekonstruktion in Ausdrucken der neuen Lehre fallt es dem Konvertiten sprichwortlich „wie Schuppen von den Augen“. Durch die Verbindung mit dem Ereignis erscheint ihm seine Vergangen- heit nun als entschlusselte Kontinuitat (ebd.: 555). In Konversionsberichten wird dieser auBeralltagliche Moment haufig mit Metaphern versucht in Worte zu fassen (Stagl 2005: 159). Letztlich ist ein solches Erlebnis inkommensurabel, die innere Transformation lasst sich nur vage beschreiben.
Ein Bekehrter zeichnet sich nach James (1997: 216) dadurch aus, dass einst periphere religiose Vorstellungen ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit gelangen und sich sein Energie- zentrum um religiose Ziele formiert. Die Erregung des psychischen Systems wechselt also auf mysteriose Weise: aus toten Gefuhlen und Vorstellungen sowie kalten Uberzeugungen werden heiBe, lebendige, um die sich fortan alles um sie herum neu anordnet (ebd.: 217) - dieser dialektische Umschlag wird in der folgenden Argumentation durch die Konfrontati- on stigmatisierter Subjekte mit einer ideencharismatischen Identitatsvorstellung befordert.
Zwar findet das Konversionserlebnis meist in Abgeschiedenheit und zeitlich gesehen vor dem Aufsuchen der neuen Gemeinschaft statt, deren Mitgliedschaft der Bekehrte als Novi- ze anstrebt, jedoch ware das Konversionserlebnis als einzelnes Ereignis unbedeutend und fluchtig, wurde der Konvertit dieses fur sich behalten. Erst dessen Versprachlichung und damit Objektivierung innerhalb einer wirklichkeitsstutzenden Gemeinschaft verleiht dem Konversionserlebnis intersubjektive Gultigkeit (Berger / Luckmann 2003: 163 f.).
Zu 4. Da Konversion nicht lediglich eine individuelle Personlichkeitstransformation be- schreibt, sondern mit einer Bewegung im sozialen Raum einhergeht, unterliegt sie Kraften sozialer Kontrolle. Will sich der Konvertit aus alten Bindungen losen, muss er sich mit Widerstanden seiner sozialen Beziehungspartner arrangieren. Auch mogen ihn Gewissens- bisse plagen sowie Nostalgiegefuhle befallen, da ihm die Loslosung von eingelebten Ge- wohnheiten und Bindungen schwerfallen kann. Beide Seiten mogen dies als Verrat emp- finden. Das ungeheure Glucksgefuhl, das den Konvertiten uberkommt, will er sich um je- den Preis erhalten. Er vertieft sich in die Lehren des neuen Glaubens und kennt diese bald besser und systematischer als jene, in denen er aufwuchs. In seinem Eifer wird er haufig zum Missionar und beginnt, andere zu bekehren. So uberzeugt er sich gleichzeitig selbst von der Richtigkeit seiner neuen Wirklichkeit (Stagl 2005: 162).
Zu 5. Der Bekehrte trifft, getragen von der ersten Welle der Euphorie, Entscheidungen, die ihm die Ruckkehr zum alten Leben verbauen. So lost er sich etwa von alten unerwunschten Gewohnheiten, wie vom Genussmittelkonsum. SchlieBlich vermag es der Konvertiteneifer, der in seiner Wirkung als starkste Droge angesehen werden kann, ihn von schwacheren Substanzen zu losen.
Der frisch Bekehrte kann nur zur Einheit mit sich selbst gelangen, wenn er sich von seiner alten Gemeinschaft abkoppelt und der neuen anschlieBt (Stagl 2005: 160). Er bedarf der Unterstutzung seiner neuen Gemeinschaft, um der neue Mensch zu bleiben, zu dem er durch die Konversion wurde. Seine ,Heiligung’ wird mitunter auch in kryptoreligiosen Selbsthilfegruppen vorangetrieben, die ihn davor bewahrt, in alte Glaubensmuster und Uberzeugungen zuruckzufallen (ebd.: 163f.; vgl. Knoblauch 1998).42
Ein entscheidender Schritt, die neue Identitat zu festigen, ist das offentliche Bekenntnis. Nicht nur vor den Hinterbliebenen, sondern auch in Gegenwart Gleichgesinnter. Der demonstrative Kirchenbesuch wurde bereits von Augustinus als eigentlicher Prufstein der Bekehrung angesehen, die innere Annahme der neuen Wirklichkeit genugt nicht (ebd.: 162).
Die neue Gemeinschaft verfugt ihrerseits uber Anwarterrollen wie das Noviziat. Unter der Anleitung der Alteingesessenen erlernen die Konvertiten neue Umgangsformen und sym- boltrachtige Verhaltensweisen (mitunter wechseln sie den Namen und ihr Erscheinungs- bild), die zwar Negativsanktionen der Hinterbliebenen evozieren mogen, die Konvertiten jedoch durch ihr erlebtes Martyrium umso fester in die neue Gemeinschaft integrieren (ebd.: 163).43 Die hiesigen Sinnweltexperten haben Einfluss auf das Konversionsgesche- hen. Ob nun als Vorbilder oder als Bezugspersonen, sie leiten den Konvertiten durch sei- nen Transformationsprozess in der Rolle signifikanter Anderer, wie Paten. Dieser Prozess folgt kulturspezifischen Mustern, die sich in Erwartungen an den Konvertiten und dessen eigenen an sich selbst artikulieren (ebd.: 155).
All diese Erscheinungen sind reversible Verwandlungen (ebd.), sie mogen sich jedoch ha- bituell verfestigen, so dass sie als bestandiges Ausdrucksrepertoire, als Stil erkennbar wer- den. Die genannten MaBnahmen der Fremd- und Selbstkontrolle konnen sich lockern, sobaid sich die neue Identitat einmal verfestigt hat und zur Grundlage neuer Bindungen und Gewohnheiten geworden ist. Beziehungen zur Herkunftsgruppe konnen wieder aufge- nommen werden, der Bekehrte ist nun vollwertiges Mitglied der von ihm gewahlten Ge- meinschaft(ebd.: 164).
Konversionen mussen einerseits nicht von langer Dauer sein und konnen ebenso recht oberflachlich verlaufen, andererseits konnen sie auch lediglich als Begleiterscheinungen tiefergreifenderer Wandlungsprozesse auftreten (ebd.: 165).44 Gerade unter den Bedingungen der fortgeschrittenen Moderne ist es wahrscheinlich, dass diese im Zuge von Selbster- machtigungsprozessen (vgl. Kapitel 7.4) permanent in Frage gestellt werden.
Sprondel (1985: 552) verweist darauf, dass es sich bei Konvertiten fur gewohnlich um er- folgreich sozialisierte Subjekte handelt, die bereits eine auf sozialen Interaktionszusam- menhangen beruhende Weltsicht intemalisiert haben. So ist ein mehr oder weniger hoher Artikulationsaufwand notig, um sich selbst, alten und neuen Wirklichkeitsgefahrten ge- genuber den Wandel zu legitimieren.
Nach Snow / Machalek (1983: 266 ff.) kann der Konvertit oder Konversion als sozialer Typus angesehen werden, der an vier Merkmalen zu erkennen ist:45
1. Biographische Rekonstruktion
2. Ubemahme eines Generalschlussels fur die Wirklichkeit (,master attribution scheme‘)
3. Ausklammerung analogischen Denkens46
4. Rollentotalisierung (,embracement of a master role‘) (Snow / Machalek 1983: 266
ff.; vgl. auchLuckmann 1987: 40; Wohlrab-Sahr2002: 83 f.).
In Konversionserzahlungen konnen nur die ersten beiden Merkmale untersucht werden.47 Wichtig erscheint hier insbesondere die institutionelle Veranlassung zu einer solchen Selbstthematisierung (Hahn 1987: 17; Hahn 1995: 127). Historisch wandeln sich ihre insti- tutionalisierten Formen, die spezifische handlungsfahige soziale Typen hervorbringen, ohne die wiederum bestimmte Typen von Gesellschaft undenkbar waren (Hahn 1995: 128).
3.2.3 Konversionserzahlungen
Konversionserzahlungen konnen mit Hahn (1987:12) als Biographiegeneratoren betrachtet werden. In der Kommunikation uber Konversion hat das Individuum, wie in der Beichte oder Psychoanalyse die Gelegenheit, sich auf die eigene Existenz zu besinnen und uber sich als Ganzheit zu sprechen.48 Ein symbolischer Daseinszusammenhang erschliebt sich dabei nur in derartig herausgehobenen Gesprachssituationen (ebd.: 16). Bei Konversionserzahlungen handelt es sich um hochgradig typisierte Darstellungen, die nach Luckmann (1986: 205; 1987: 41) zu den rekonstruktiven kommunikativen Gattungen zu zahlen sind (vgl. Ulmer 1988). Gewisse soziale Milieus scheinen Luckmann (1986: 205) zufolge durch eine besondere Auspragung rekonstruktiver Gattungen charakterisiert zu sein, uber eine spezifische „narrative Kultur“ zu verfugen.49 Insgesamt unterscheidet sich der Vorrat kommunikativer Gattungen kulturell und historisch sowie auch in der Art der von ihnen festgelegten Schichten und Elementen kommunikativen Handelns. Kommunikative Gattungen konnen als vergesellschaftete verbindliche Problemlosungen von kommunikativen Problemen angesehen werden (ebd.: 202).50
Im gesellschaftlichen Wissensvorrat liegt bereits ein bestimmtes Modell des Erzahlens bereit, an dem sich die Konvertierten orientieren.51 Auch wenn ihre Erzahlungen eingebet- tet sind in biographische Zusammenhange oder solche erzeugen (Hahn 1987: 12) und auf lebensweltlicher Erfahrung beruhend den Subjekten als hochgradig individuell erscheinen, folgen sie institutionalisierten Mustem, die sich typologisch und hinsichtlich ihrer funktio- nalen Bedeutung beschreiben lassen (Sprondel 1985: 557). Sie konnen als Exemplare der hier realisierten Gattung betrachtet werden. Genauer lassen sie sich bei ihren Schilderun- gen von Deutungs- und Darstellungsmustem leiten, die ihnen ihre Weltanschauungsge- meinschaft, zu der sie konvertiert sind, vermittelt (Ulmer 1988: 20). Wandelt sich die Gruppenideologie, andern sich auch die Konversionserzahlungen, wie Beckford (1978, zit. n. Ulmer 1988: 20) empirisch bei den Zeugen Jehovas zeigen konnte. Konvertiten uber- nehmen durch ihre Teilhabe an den Praktiken ihrer Gruppe die dort herrschenden Vorstel- lungen uber das Wesen einer Konversion und beziehen diese bei ihren Schilderungen mit ein (ebd.).
Konversionserzahlungen kommen, im Gegensatz zu anderen rekonstruktiven Gattungen wie Klatsch, in vergleichsweise wenigen sozialen Arrangements vor. Zu den besonderen Bedingungen, unter denen sie erzahlt werden, gehort etwa eine raumlich abgeschiedene Kommunikationssituation, in der die Konvertierten ungestort und ohne zeitliche Ein- schrankung von ihrer Transformation berichten konnen. Typischerweise ergibt sich eine solche Situation im Verlauf eines uber die Konversionserzahlung hinausgehenden Ge- sprachs, das diese nicht intendiert haben muss. Zwischen dem Konversionserzahler und seinem Zuhorer besteht eine besondere Sozialbeziehung, weil das zentrale beziehungsver- mittelnde Merkmal die Zugehorigkeit zu einer religiosen oder ideologisch vergemeinschaf- teten52 Gruppe ist (vgl. Ulmer 1988: 21). In alien denkbaren Gesprachskontexten, in denen solche Konversionserzahlungen vorkommen, gibt es zumindest ein engagiertes Gruppen- mitglied (den Konvertierten), wahrend das oder die Gegenuber sich in unterschiedlicher Nahe zu dessen Gruppe und deren Ideologic oder Weltanschauung befinden:
[...]
1 So hat es bereits Einzug in Lehre und Forschung von Bildungsinstitutionen gehalten (Helmut-Schmidt- Universitat 2018; Queen Mary University ofLondon o.J.).
2 In Deutschland erfasst das international anerkannte aktuelle Manual der WHO, der ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) systematisch (Psycho-)Pathologien. Mitunter findet auch das der amerikanischen Psychiatervereinigung (APA), der DSM (Diagnostical and Statistical Manual ofMental Disorders) Anwendung (vgl. Klausner 2015: 67 ft., 97).
3 Kretschmers ,sensitiver Charakter‘ zeichnet sich einerseits durch eine „auBerordentliche Gemutsweichheit, Schwache und zarte Verwundbarkeit“ aus, andererseits soil er auBerst ehrgeizig und eigensinnig sein (soziale Tuchtigkeit). Es soil sich um sehr intelligente, „hochwertige“ Personlichkeiten handeln, die aber als kompli- ziert, fein und tief empfindsam beschrieben werden und eine ubergenaue bis selbstqualerische ethische Hal- tung mit starken Gewissenszweifeln aufweisen sollen. Ihr Gemutsleben zeichnet sich durch nachhaltig ge- spannte Affekte aus, wobei sie Gefuhle moralischer Beschamung typischerweise tief in sich verschlieBen (Faust o.J.: 4). Als sensitive Personlichkeitsstorung, zu der Kretschmers Konstrukt von Tolle pathologisch gewendet wurde, auBert sie sich in Krisensituationen in einer depressiven, hypochondrischen und phobischen Symptomatik (ebd.: 8), wahrend sie sich nicht-pathologisch auBerst positiv - in FleiB, Ehrgeiz, Ordentlich- keit, im ausgepragten Streben nach Anerkennung - manifestiert. So kann sie sowohl als Fluch als auch als Segen erscheinen - ein Schicksal, das sich im Faile der Hochsensibilitat wiederholt, wie femer noch zu zeigen sein wird.
4 Im DSM 3 stellte die ,Hypersensitive Personlichkeitsstorung4 mit ihren Hauptmerkmalen der Uberempfindlichkeit gegenuber moglicher Zuruckweisung, Demutigung und Beschamung noch ein anerkanntes Krankheitsbild dar. Ein weiteres Symptom dieser Pathologie stellt die „fehlende Bereitschaft, sich auf Beziehungen einzulassen, auBer wenn ungewohnlich sichere Garantien fur ein unkritisches Angenommenwerden vorlie- gen“ (Illouz 2006: 93) dar.
5 Auch wenn der Institutionalisierungsprozess von Hochsensibilitat bereits im Gange ist, organisieren sich die hier empirisch untersuchten Hochsensiblen gegenwartig in relativ fluiden Sozialformen in der Art von Gesprachskreisen mit hoher Teilnehmerfluktuation.
6 Dieses Zitat findet sich auch in deutscher Ubersetzung des mittlerweile kanonisch gewordenen Klassikers (Aron2013: 5): Ich glaube an den Adel - falls dies das richtige Wort ist und ein Demokrat es benutzen darf - nicht an die Macht des Adels ... sondern an die Sensibilitat und Rucksichtnahme des Adels ... Seine Mitglieder lassen sich in alien Nationen und Gesellschaftsschichten finden, durch alle Altersstufen hindurch. Wenn sie sich treffen, besteht eine geheimnisvolle Ubereinstimmung zwischen ihnen. Sie reprasentieren die wahre menschliche Kultur, den einzigen bestandigen Sieg unserer sonderbaren Rasse uber Gemeinheit und Chaos. Tausende von ihnen gehen im Ungewissen unter, wenige erlangen Ruhm. Sie sind feinfuhlig anderen und sich selbst gegen- uber, nehmen Rucksicht ohne viel Aufhebens zu machen und ihr Mut zeichnet sich nicht durch Protzerei aus, sondern ihre Starke liegt im Ertragen. E. M. Forster „What I Believe” in Two Cheers for Democracy
7 Auch wenn in der phanomenologisch orientierten Psychiatrie bereits tiefgreifende Auseinandersetzungen mit dem sensitiven Charakter oder auch der sensitiven Personlichkeitsstorung bestehen (vgl. Faust o.J.; Kla- ges 1978, greift Aron (2013) diese Tradition nicht auf, um ihr neurophysiologisches, genetisches und evolu- tionarbedingtes Konstrukt zu legitimieren (vgl. auchAron/Aron 1997; Acevedo et al. 2014).
8 Bereits hier zeigt sich ein Paradox, insofem extrovertierte Hochsensible wohl zu aktiver Erforschung und Erkundung neigen wurden. Die Formulierung von Paradoxen kann als Teil symbolischer Arbeit begriffen werden, die Wirklichkeit mit einem Netz von Bedeutungen uberspannt und damit absichert (Soeffner 1991: 74) (vgl. Kapitel 7.1).
9 Von den 27 Items sollten 14 bejaht werden, um eine Hochsensibilitat bei sich selbst zu „diagnostizieren“. Allerdings konnen auch beliebig weniger Aussagen als besonders zutreffend empfunden werden und ein positives Testergebnis nicht in Abrede stellen. Interessant ist der Umstand, dass die Hochsensiblen- Interessenverbande die Validitat von Studien nihilieren, die mittels Selbsteinschatzung Hochsensibilitat er- heben, da diese keine „objektiven“ Aussagen zulieBen, andersherum aber Selbsteinschatzungstests anbieten, um Laien und Experten eine Selbstdiagnose zu ermoglichen. Die Fragen erscheinen, nach eingehender Un- tersuchung, als bricolage aus narzisstischer Selbstbespiegelung (etwa: ,,Ich besitze ein reiches, vielschichti- ges Inncnlcbcn.'') und allgemein in der conditio humana liegenden Empfindungspotentialen (wie: ,,Die Stimmungen anderer Menschen beeinflussen mich.“) (High Sensitivity 2017). Nach leibphanomenologi- schem Verstandnis wird hier ein Teil des Erfahrungsspektrums des sozial situierten und geschichtlichen Leibes thematisiert (vgl. Gunther 2017), das im Rahmen der Hochsensibilitat in einem symbolisch uberhoh- ten Sinnzusammenhang erscheint (vgl. Kapitel 3.1, 3.4, 3.5, 7.1).
10 In der Ratgeberliteratur und den Online-Portalen findet sich die Unterscheidung zwischen Hochsensibilitat und (Hoch-)Sensitivitat, wobei letztere sich in Medialitat: Hellsichtig-, Hellfuhlig-, Hellhorigkeit, kurzum: in einer ausgepragten ubersinnlichen Wahmehmung und Spiritualitat niederschlagen soil (vgl. Heintze 2015: 39; Institut fur Hochsensitivitat & Hochbegabung 2017).
11 Unter heterodoxem Wissen werden von der institutionalisierten Ordnung abweichende Realitatsauffassun- gen verstanden (hier: der psychologischen/psychiatrischen), wohingegen orthodoxe Verhaltnisse jene affir- mativ bestatigen. Ortho- und heterodoxe Uberzeugungen kennen im Gegensatz zum doxischen Weltverhalt- nis bereits die Moglichkeit anderer sozialer Welten (Bourdieu 1979: 330). Entscheidend fur ein doxisches Verhaltnis zur sozialen Welt ist dabei das Verwachsensein mit ihr, ein Grenzfall von Legitimitatsgeltung, in dem sie als naturlich vorgegeben erscheint. Die Erfahrung der sozialen Welt, wie sie als selbstverstandlich erscheint, wenn idealtypisch „die Koinzidenz zwischen objektiver Ordnung und den subjektiven Organisati- onsprinzipien gleichsam vollkommen ist (wie in archaischen Gcscllscliaftcn)'' (ebd.: 325) wird bei Bourdieu als Doxa bezeichnet.
12 Insgesamt erscheinen die Legitimationsbemuhungen der Innovatorin eine eigentumlich sozialdarwinisti- sche Perspektive zu offerieren, nach der die Geschichte als Kampf zwischen Nicht-Hochsensiblen und Hoch- sensiblen ausgelegt wird. Scheinbar naturgegebene Merkmale (eine durch einen offenen Reizfilter bedingte, essentialisierte, radikal divergierende Wahmehmung) sind mit einer als hoherwertig zu betrachtenden Le- bensform einer ,,sensiblen Aristokratic'' gekoppelt, die durch die moralisch verwerfliche Aggressivitat der Nicht-Hochsensiblen im Daseinskampf unterliegen, obwohl Hochsensibilitat mit einem evolutionaren Selek- tionsvorteil verbunden sein soil (vgl. Kapitel 3.1).
13 Wahmehmen und Handeln konnen als zwei Seiten einer Medaille betrachtet werden (Reckwitz 2015: 448).
14 Vielmehr wird mit der hier vertretenen Haltung eines methodologischen Agnostizismus der Geltungscha- rakter von Hochsensibilitat als naturliches Phanomen eingeklammert (Bohnsack 2008: 131). Es liegt nicht in der soziologischen Kompetenz uber mutmaBlich neurophysiologische Entitaten Aussagen bezuglich ihrer „positiven“ Existenz zu machen. Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit Hochsensibilitat als sozialer Tatsache, die in subjektiven wie objektiven Wirklichkeitskonstruktionen vielfaltige Deutungen zulasst. Inso- fem liefert sie ein solches Deutungsangebot mit Mitteln derverstehenden Soziologie.
15 Bereits Elias’ (1988: 207) Analyse des Zivilisationsprozesses hat gezeigt, wie aus der auBengeleiteten Disziplinierung der Affekte eine innengeleitete wurde. Durch die soziale Kontrolle des Gewissens wird der Mensch zur Besinnung auf sein Innerstes zuruckgeworfen und entwickelt ein erhohtes Subjektivitatsempfin- den. Erganzend lasst sich hinzufugen, eine erhohte Sensibilitat (vgl. auch Durkheim 1984: 221). Seine in- nersten Antriebe werden heils- und erforschungsbedurftig. Subjektivitat, Individualitat und Sensibilitat erfah- ren durch auf sie bezogene soziale Kontrollprozesse eine spezifische Differenzierung (vgl. Hahn 2010: 167 f). Auch Rosa (2016: 57) weist auf gesteigerte Sensibilitaten in der Modeme hin, die er allerdings beschleu- nigungsbedingt erklart. Aus pragmatischen Grunden kann diese Perspektive hier nicht weiterverfolgt werden.
16 Empfmdlichkeit gehort fur Gehlen (2007: 120) wie etwa „Absonderung“ und „Eigenbrotelei“, ,,Selbstunsi- cherheit“, „Angstbereitschaft“ oder ..Kritizismus” zu ..adjustments by defence”, die Ergebnisse komplizierter sozialer Prozesse darstellen, deren naturlicher Anted sichnicht ausmachenlasst (ebd.: 121). Kompensationen wie ..Eitclkcit” oder „tendenziose Markicrungcn” wie ..Untcrwiirfigkcit” oder ...Schncid'” gehoren ebenso dazu (ebd.: 120). Mit Lipp (1985) kann fomuliert werden, dass es sich bei diesen Verhaltensweisen um Selbststigmatisierungen handelt (vgl. Kapitel 3.5).
17 Nach Tenbruck (1972: 70) hat dies zur Folge, dass der modeme Mensch seine Gegenwart innerlich nicht mehr verarbeiten und sich auf sie einlassen muss, weil er glaubt, durch Veranderung auBerer Umstande seine Wirklichkeit nach seinen Bedurfnissen formen zu konnen.
18 Von Ideologic kann insofem gesprochen werden, als dass sich ein konkretes Machtinteresse mit dieser Wirklichkeitsbestimmung verbindet (vgl. Berger / Luckmann 2003: 132), das in den Institutionalisierungsbe- strebungen der Legitimationsexperten von Hochsensibilitat zum Ausdruck kommt.
19 Mit Berger / Luckmann (2003: 94 f.) kann auch von ,Verdinglichung‘ gesprochen werden. In Prozessen vergesellschafteter Tatigkeit hervorgebrachte Phanomene werden dabei so aufgefasst, als waren sie etwa naturgegeben, Konsequenzen kosmischer Gesetze oder Offenbarungen einer gottlichen Macht. Fur das indi- viduelle Bewusstsein wird das Wechselspiel von menschlicher Urheberschaft und dessen Produkten unsicht- bar. So wird aus einer Modalitat der humanen Objektivation der Wirklichkeit ein ontologisches Faktum (ebd.: 96). Der Mensch ist paradoxerweise imstande, eine Welt zu schaffen, die ihn verleugnet. Was bei Marx als „falsches Bewusstsein“ (zit. n. ebd.) deklariert ist, soil hier aber nicht kulturpessimistisch als Sun- denfall angeklagt, sondem danach gefragt werden, was diese Verdinglichung leistet, wenn sich Individuen mit ihr als gesellschaftlich vorgegebener (Rollen-)Typisierung identifizieren (vgl. ebd.: 97). Auch wenn solche intemalisierten Rollen nur einen Teil des Subjekts objektivieren konnen, neigen Individuen dazu, diese Verdinglichungen mittels symbolischer Uberhohung nicht nur zu ontologisieren, sondem auch zu tota- lisieren (ebd.: 98), sodass sie in derenBewusstsein als substantielle rollenubergreifende Identitat erscheinen.
20 Sozialkonstruktivistisch ausgedruckt muss der Begriff der ..Deformation'' relativiert werden: In der dialek- tischen Bewegung der Intemalisierung gesellschaftlicher Wirklichkeit und ihrer Extemalisierung zu wiede- rum gesellschaftlichen Objektivationen kann von einer wechselseitigen Formgebung subjektiver und objekti- ver Wirklichkeit die Rede sein (vgl. Berger / Luckmann 2013: 65). Zentral ist wohl die Tatsache, dass theore- tische Stutzkonzeptionen zur Legitimierung einer institutionalen Ordnung oder ihrer symbolischen Sinnwelt eine nomische Funktion fur das Bewusstsein ausuben (Berger / Luckmann 2003: 105). Indem sie die Dinge an ihren rechten Platz rucken, bieten sie auch Wahmehmungsprogramme an, was Bourdieu (1990: 109 f.) auch im Zusammenhang des Theorieeffekts der Wissenschaft thematisiert. Wissenschaftliche Theorien sind verwachsener Teil der sozialen Wirklichkeit. Einerseits sind ihre Begriffe in der Alltagswelt fundiert, ande- rerseits ziehen wissenschaftliche Begrifflichkeiten in die Alltagssprache ein und entfalten dort eine Eigendy- namik, die als eigentumliche gegenseitige Beeinflussung von Wissenschaft und Alltagswelt etwa dann be- schrieben werden kann, wenn wissenschaftlich erforschte Subjekte lemen, mit wissenschaftlicher Semantik uber sich zu sprechen lemen.
21 Die vier Ebenen der Legitimierung reichen dabei von 1. vortheoretischen Aussagen, wie ,,So ist es eben“ (ebd.: 101) uber 2. rudimentar theoretische Postulate, etwa in Form von Sprichwortem, Lebensweisheiten oder Legenden, hin zu 3. expliziten Legitimationstheorien, die geschlossene Bezugssysteme fur gewisse institutionalisierte Ausschnitte des Handelns liefem und munden schlieBlich auf der hochsten Legitimations- ebene in 4. symbolischen Sinnwelten. Hier werden verschiedene Sinnprovinzen integriert und die institutionale Ordnung in ihrer Totalitat uberhoht. Es handelt sich nach Berger / Luckmann (2003: 102) dabei um „synoptische Traditionsgesamtheiten“. Legitimationen erfolgen auf dieser Ebene mittels Verweisungen auf andere Wirklichkeiten alsjene der Alltagserfahrung mittels symbolischer Verweisungen, die nur noch theore- tisch eingeholt werden konnen (ebd.).
22 Nach Horkheimer / Adorno (2013: 14) benennt der Mythos als Kind der Aufklarung, Ursache und Wir- kung, fallt aber mit der Fortschrittsprogrammatik der Wissenschaft, dieser zum Opfer. Formein ersetzen dann Begriffe und Wahrscheinlichkeitsregeln Ursachen. Das letzte Geheimnis, hier: des Inneren, gilt es zu entzif- fem. Dass Autklarung wiederum in Mythologie umschlagtja, sich in ihrem Fortschreiten zunehmend mit ihr verstrickt (ebd.: 6, 18), wird auch im Faile von Hochsensibilitat ersichtlich.
23 Wahrend sie idealtypisch zu ,,absolutem Selbstverstehen“ ermutigt werden, in dem sie ihr „wahres Wesen” erkennen. Auch wenn hier nicht der Raum fur eine eingehende Erorterung der Moglichkeiten und Grenzen des Selbst- und Fremdverstehens zur Verfugung steht, muss betont werden, dass fur Schutz absolutes (Fremd- und Selbst-)Verstehen ein unerreichbares Ziel darstellt. Verstehen ist stets abhangig von den vor- handenen Deutungsschemata und Wissensvorraten des Verstehenwollenden und kann daher nur in Annahe- rung an die Sinnkonstruktionen des zu Verstehenden erfolgen (vgl. Schutz 2016: 141; eine eingehendere Auseinandersetzung zu dieser Problematik istbereits an anderer Stelle erfolgt, vgl. Gunther 2017).
24 Der von der Pionierin berichtete Leidensweg und die Dynamik, die sich nach der Entdeckung ihrer wahren Wesenseigenart entwickelte, kann wohl als Ursprungsmythos betrachtet werden. Die Empirie wird zeigen, inwiefern er von den erforschten Hochsensiblen wiederholt wird. Mit Illouz (2009: 308 ff.) kann Arons Erzahlung als Ausdruck des therapeutischen Narrativs verstanden werden, das in der Lage ist, eine ubergreifen- de Erklarung fur die widerspruchlichsten Gefuhle und Erfahrungen zu liefem, ohne von konkreten Inhalten abhangig zu sein. So kann sie individuellen Besonderheiten gerecht und auf eine Vielzahl von Ubeln ange- wandt werden, um Leiden kollektiv, etwa in Selbsthilfegruppen, zu organisieren. Die therapeutische Erzah- lung adressiert dabei ein virtuelles Subjekt, das gleichzeitig Patient und Konsument, Opfer sozialer Umstan- de und aktiver Gestalter seines Lebens ist und bedient sich dabei basaler kultureller Schablonen der judisch- christlichen Erzahlung. Indem sie von vergangenen, aber immer noch prasenten Opfererfahrungen handelt, macht sie Erlosung in Form von seelischer Gesundheit zum Ziel und ermoglicht so eine koharente Rahmung des Selbst. Furs seelische Wohlergehen sind die Betroffenen der therapeutischen Erzahlung zufolge selbst verantwortlich, ohne Begriffe von moralischer Schuld zu liefem. Die damit einhergehende Forderung nach stetiger autonomer Selbstverbesserung delegitimiert ein unbefriedigendes Leben, sodass sich modeme Sub- jekte in der Erfahrung von Selbstveranderung sozial und moralisch als kompetent erleben. Das therapeutische Narrativ zehrt dabei von symbolischen Strukturen, die kranke, heilungsbedurftige Subjekte entwerfen, die aus eigener Kraft, durch die Hinwendung an die eigenen Makel und Funktionsstorungen, ihr Leben verbes- sem mogen.
25 Selbstverstandlich sind auch andere Subjektivierungsweisen denkbar, wie etwa Keller (2012: 99) zeigt: auch kreative Umgangsformen mit den Inhalten und adressierten Subjektpositionen sind moglich, die nicht vollig in ihrem gesellschaftlich situierten Standort aufgehen. Innerhalb gewisser Freiheitsgrade und mit eigenen Relevanzsetzungen eignen sich auch die Erforschten das hier propagierte Wissen uber Hochsensibilitat mitunterwiderstandig an (vgl. Kapitel 5.2.2).
26 Als Selbstverstandlichkeiten erscheinen (liest man den Mythos induktiv) aus anthropologischer und sozio- logischer Perspektive facettenreiche zur conditio humana gehorende Wahmehmungsphanomene, die durch ihre Stilisierung und symbolische Uberhohung im Zusammenhang mit Hochsensibilitat zum Monopol einer Minderheit von 20% der Weltbevolkerung nostrifiziert werden und nur darum als besonders erscheinen. Ein Ereignis wird nicht durch seine „objektive“ Qualitat auBergewohnlich, sondem durch dessen Deutung (Schetsche / Schmied-Knittel 2012: 185). Schetsche / Schmied-Knittel konnten empirisch zeigen, dass selbst „auBergewdhnliche Erfahrungen“, wie die des Ubersinnlichen als „alltagliche Wunder” zum Erfahrungs- spektrum einer breiten Bevolkerung gehoren. Lediglich deren Deutungen als alltagstranszendente Phanome- ne, rahmten sie als besonders.
27 Was Barthes (2015: 216 ff.) fur die Astrologie gezeigt hat, erhellt auch die Analyse der Ratgeberliteratur zur Hochsensibilitat: Auch hier wird einer deterministischen Betrachtungsweise (in diesem Fall die der neu- rophysiologischen Konzeption des Reizfilters, bei der Astrologie die des Einflusses der Steme) eine neolibe- rale Konzeption der Person gegenubergestellt, die durch stetige Arbeit an sich selbst durch eigene Leistung zum Schmied ihres eigenen Schicksals wird. Was auf den ersten Blick als Fluchtwelt erscheinen mag, ist bei naherer Betrachtung Ausdruck realistischer Evidenz der Lebensbedingungen der Leserschaft. Indem das Reale benannt wird, wird es Barthes (2015: 219) zufolge ausgetrieben. Als Mythenproduzenten erscheinen in der vorliegenden Arbeit uber die Ratgeberliteratur hinaus auch die interviewten Personen sowie die Interviewerin, da sie die Interviewten in der Erhebungssituation als Hochsensible adressiert.
28 SchlieBlich ist auch Wissenschaft an der Mythenproduktion beteiligt, indem sich auch in ihr schwerlich hintergehbare Werthaltungen verbergen, die einem wissenschaftsglaubigen Publikum als universelle Wahr- heit vorkommen mag. Dem kann hier schlieBlich nur durch die Reflexion auf die eigene Standortgebunden- heit begegnet werden. Nun ist es nach Barthes (20f5: 285 f.) die beste Waffe gegen den Mythos, ihn selbst zu mythifizieren, also einen kunstlichen Mythos zu schaffen, der dann so etwas wie eine Mythologie liefert.
29 Nach Weber gilt es, Fragen nach dem Sein und Sollen zumindest formal zu unterscheiden, wenn sie sich auch im konkreten Forschungsprozess uberlappen mogen. Dies geschieht bereits durch begriffliche Vorent- scheidungen, da alle Begriffe historisch perspektivisch bestimmte Problemansichten liefem, in denen Tatsa- chen und Werte untrennbar miteinander verflochten sind. Klarheit daruber zu verschaffen, wo diese Spharen ineinanderlaufen, ist dann Aufgabe des Sozialwissenschaftlers (vgl. Albrecht 2017: 1 f.). Siehe zur Problema- tik der Werturteilsfreiheit Kapitel 6.6 und Weber (1968: 146 ff.).
30 Die Autoren beziehen sich bei dem Terminus des Diskursuniversums auf Mead (1962: 88 ff., zit. n. Snow / Machalek 1983: 265).
31 Der subjektive Wissensvorrat mag auch umgebaut werden durch die schlichte Kenntnisnahme neuer Inhal- te, wenn dabei aber nicht die ordnungsstiftenden Dimensionen betroffen sind, kann von „Lemen“ oder ,,neu- enErfahrungen“ die Rede sein, nichtvonKonversion (Sprondel 1985: 552).
32 Unter einem Paradigma kann in der Wissenschaftstheorie eine Art ubergeordnete disziplinare Matrix ver- standen werden, die samtliche Wissensbestande einschlieBt, die fur die Erkenntnis einer Gruppe von For- schem relevant sind (Wohlrab-Sahr 1995: 290). Ein Paradigma liefert der Forschungsgemeinschaft Kriterien fur die Wahl von Problemen, die nur losbar erscheinen vor dem Hintergrund ebendieses Paradigmas (Kuhn 1979: 51). Paradigmen liefem Modelle, Musterexemplare sowie symbolische Vergemeinschaftungsformen und stellen der Gruppe bevorzugte Analogien bis hin zu einer Ontologie zur Verfugung. Paradigmen stellen so konkrete Problemlosungen bereit. Bereits in den 1970er Jahren hat Jones vorgeschlagen, bei Konversions- prozessen von „paradigm shifts” zu sprechen, um sich gegen ein substantielles Verstandnis von Identitat zu wenden. Damit handelte er sich jedoch die Kritik ein, Konversion auf ein bloh situationsspezifisches Identi- tatsmanagement zu reduzieren, sodass letztlich das strukturelle Verhaltnis von Konversion und biographi- schenldentitatsentwurfenunthematisiertbleibt (Wohlrab-Sahr 1995: 290).
33 Wahrend es fur die Psychologie wohl zweifelhaft ware, dass sich ein Identitatsproblem durch Konversion losen lieBe und sie es als ihre Aufgabe betrachten konnte, zugrundeliegende Konfliktstrukturen zu analysie- ren, stellt sich der soziologischen Untersuchung die Aufgabe, die Sinnstruktur eines derartigen Rahmen- wechsels zu analysieren. Anders als es die religiose Rhetorik meint, behauptet der Soziologe jedoch nicht, dass die Konversion dazu in der Lage ware, eine neue Person zu schaffen oder die Person in ihrer Grund- struktur zu verandem (Wohlrab-Sahr 2001: 225).
34 Folgt man den Erzahlungen der Ratgeberliteratur zur Hochsensibilitat, kann eine Krise und der darauf folgende Wandel des Selbstverstandnisses auch bei der Neuinterpretation der eigenen Identitat als hochsensi- bel nachgezeichnet werden. Im empirischen Teil wird zu sehen sein, inwiefem auch die Interviewpartner von Krisenerfahrungen berichten und ihre Identitat biographisch neu rahmen (vgl. Kapitel 5).
35 Die Rolle der Weltanschauungsgemeinschaft, die im Faile von Hochsensibilitat in der vorliegenden Studie in Gesprachskreisen zusammenkommt, wo der Glaube an den Wahmehmungsmythos und die eigene Zuge- horigkeit zu ihm aufrechterhalten wird, zeigt sich empirisch inKapitel 5.2.4.I.
36 Im Fall von Hochsensibilitat, die sich als heterodoxes Konstrukt zwischen Wissenschaft und Religion bewegt, sollte erganzt werden, dass der institutionalisierte Eintritt in die Psychiatrie oder Psychotherapie die Diagnose ist, die, wie auch im Faile der Hochsensibilitat, meist mittels standardisierter Testverfahren erwor- ben wird. Anders als jene (Selbsteinschatzungs-) Tests zur Feststellung einer Hochsensibilitat, verfugen psychiatrische uber das gesellschaftliche Herrschaftsmonopol, subjektive Realitaten als objektiv gultig zu definieren. Aber auch hier erfolgt nicht lediglich ein formal auherlicher, sondem ein leiblicher Wandlungspro- zess (der Diagnostizierten und der diagnostizierenden Psychiater), der an anderer Stelle bereits beschrieben wurde (Gunther 2018). Psychotherapie und Psychiatrie sind zudem selbst sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der religiosen Sphare situiert (vgl. Hahn 1987: 16; Hahn 1995: 137; vgl. Kapitel 7.3).
37 Assimilation und Akkulturation stellen weitere einschneidende Veranderungen der Wirklichkeitsauffas- sung dar (Luckmann 1987: 39), anders als bei der Konversion fehlt hier allerdings der Kanon.
38 Zur Ausweitung psychiatrischer Krankheitskategorien siehe Dellwing / Harbusch (2013).
39 Wahrend Immanenz als Kern der Alltagswirklichkeit gelten kann, als unmittelbar erfahrenes Hier und Jetzt, an dem nicht gezweifelt wird, kann von kleinen Transzendenzen die Rede sein, wenn Zeitstrukturen in der Erinnerung, also Rekonstruktionen von Handlungszusammenhangen, Ursache und Wirkungsverhaltnis- sen etc. ins Spiel kommen. Von mittleren Transzendenzen kann gesprochen werden, wenn anderen Akteuren Intentionalitat unterstellt wird. GroBc Transzendenzen schlieBlich gestalten sich vielseitig als auBeralltaglich, etwa als Traume, in denen die Alltagswirklichkeit verlassen wird oder als religiose Erfahrungen (Soeffner 1991: 72). Entscheidend ist nun die Deutung der Transzendenzerfahrungen als inner- oder auBerweltlich (Knoblauch 2006: 96 ff.).
40 Damit soil kein Determinismus heraufbeschworen werden. Viele Menschen in aussichtslosen Lagen kon- vertieren nicht und viele Konvertiten hatten auch andere Moglichkeiten gehabt, sich aus der Krise zu befreien (Stagl2005: 156).
41 Diese Entwicklung ist anjedem Punkt ruckgangig zu machen, der letzte Schritt zur Herauslosung des Ein- zelnen aus seinem unmittelbaren sozialen Umfeld vollzieht sich oft durch unvorhergesehene Umstande (Stagl 2005: 157).
42 Knoblauch (1998: 247 ff.) hat weltliche Konversionen zu Gruppierungen analysiert, die er mit Luckmanns (1991) Theorie der ,,unsichtbaren Religion” fasst. Genauer untersuchte er Selbsthilfegruppen der aus den Vereinigten Staaten kommenden Anonymous-Bewegung (hier: Nicotine Anonymous). Auch wenn es in diesen Gruppen, die als Auswuchse des amerikanischen Revivialismus betrachtet werden konnen, um die innerweltliche Befreiung von Suchtproblematiken geht, arbeiten sie mit Bekenntnis und Konversion. Hier vollzieht sich die stetige Emeuerung der Selbstausrichtung auf das transzendente Erlosungsziel. Durch re- gelmahiges Zeugnisablegen der eigenen Sundhaftigkeit, festigt sich die neuen Identitat (Stagl 2005: 163 f.). Heiligung ist als solche empirisch schwer zu fassen wie auch zu definieren. Mit Lipp (1985) kann dieser Prozess mit der Dialektik von Stigma und Charisma naherungsweise nachvollzogen werden (vgl. Kapitel 3.5).
43 Nicht nur auherlich sichtbare Verwandlungen sind Negativsanktionen ausgesetzt. Das Christentum etwa setzt an die Stelle korperlicher Metamorphosen geistige in Form von Sakramenten. Sie sollen ihren Empfan- gem einen irreversiblen neuen Identitatsteil einpragen (Stagl 2005: 163).
44 Konversion ist somit von der dauerhaften Bindung (,commitment‘) an die strukturell neue Wirklichkeits- auffassung und der sie stutzenden Gemeinschaft zu trennen. Wahrend in der Konversion versucht wird, das wahre Selbst zu finden, kann ,commitment‘ als Versuch betrachtet werden, die Bestandigkeit dieses Selbst zu wahren (Wohlrab-Sahr / Krech / Knoblauch 1998: 24).
45 Snow / Machalek (1983) unterscheiden nicht systematisch zwischen Konversion und dem Konvertiten als sozialem Typus (vgl. Luckmann 1987: 40).
46 Insbesondere analogische Metaphem werden bei Konversionserzahlungen vermieden, wenn der Konvertit seinen Glauben und religiose Praxis thematisiert. Innerhalb des allgemein sparsamen Gebrauchs von Metaphem finden ikonische bevorzugte Verwendung, die illustrieren, was und nicht wie die Dinge sind. Snow / Machalek (1983: 273 f.) betrachten dies als Ausdruck der radikalen Scheidung von Heiligem und Profanem, wobei analogische Metaphem Profanitat ausdrucken. Die von den Hochsensiblen-Interessenverbanden pro- pagierte bimodale Verteilungskurve zur Illustration der empirischen Existenz und Evidenz von Hochsensibilitat entspricht, ebenso wie der divergierende Reizfilter, dieser ikonisch-metaphorischen Unterscheidung. Auch fur einige der interviewten Hochsensiblen ist sie von herausragender Bedeutung (vgl. Kapitel 5.2.3), was auf die Unantastbarkeit der von Aron postulierten Monopolstellung einer auberordentlichen Sensibilitat bei 20% der menschlichen Spezies verweist.
47 Bei der Neurahmung des Selbstverstandnisses als hochsensibel, ist von einer rollenubergreifenden, identi- tatsstiftenden Konzeption auszugehen (vgl. zur Konzeptualisierung von Identitat Kapitel 3.3).
48 Eine derart umfangreiche Selbstthematisierung wird auch durch biographische Interviews der qualitativen Sozialforschung evoziert (vgl. ebd.). Ob im Beichtstuhl, auf der Couch des Analytikers oder auf der eigenen in der sozialwissenschaftlichen Erhebungssituation (wie in der vorliegenden Studie), alien Fallen ist gemein, dass soziale Institutionen Individuen auf besondere Weise zur Befassung mit sich selbst bringen und die in diesem Kontext erzeugten Selbstbilder dann als verpflichtend erscheinen lassen. Sie stellen Muster fur das Reden und Denken uber sich selbst zur Verfugung. Die Selbstthematisierer reflektieren so uber ihren Identi- tatsverlauf und abstrahieren von ihren inneren Lagen oder Empfindungen, die fur sie als Ganzheit reprasenta- tiv werden (Hahn 1987: 18).
49 So verfugt auch das therapeutische Milieu (Illouz 2006; 2009) uber eine narrative Kultur und Gattungser- zahlung: die therapeutische Erzahlung des Selbst, die als sakularisierte Variante von Konversionserzahlungen betrachtet werden kann. Indem sie der Vorstellung von Selbstverwirklichung als fiktives Ziel ohne konkreten Inhalt folgt, bringt sie automatisch nicht selbstverwirklichte, kranke Subjekte hervor (Ilouz 2006: 75), die sie zur stetigen Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen, dem Selbst und seinen Beziehungen motiviert und zu heilen verspricht (vgl. Illouz 2009: 297). Eine Leidensgeschichte stutzt dabei die Erzahlung von Selbsthilfe, die von der gegenwartigen Lage ausgeht und samtliche Ereignisse des Lebens als Anzeichen verpasster oder vereitelter Chancen zur Selbstentwicklung versteht (ebd.: 291). Von der Vision von Gesund- heit motiviert, lebt die therapeutische Erzahlung von Selbstbefreiung, also von der Erzahlung der Krankheit undkannnarrativ als Heilmittel gegen ScheitemundNot erscheinen (ebd.: 297). Problemen. So gesehen sind letztere Institutionen des Redens, wobei die Unterscheidung von Problemen des gesellschaftlichen Lebens undjenen der Kommunikation nur schwer scharf zu vollziehen ist (vgl. Luckmann 1986: 202 f.). Kommunikative Gattungen konnen hinsichtlich ihrer Binnen- und Auhenstruktur analysiert werden. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, dass sie in ihrer Entlastungsfunktion analog zu Institu- tionenbetrachtet werdenkonnen (ebd.: 204 f.).
50 So verfugt auch das therapeutische Milieu (Illouz 2006; 2009) uber eine narrative Kultur und Gattungser- zahlung: die therapeutische Erzahlung des Selbst, die als sakularisierte Variante von Konversionserzahlungen betrachtet werden kann. Indem sie der Vorstellung von Selbstverwirklichung als fiktives Ziel ohne konkreten Inhalt folgt, bringt sie automatisch nicht selbstverwirklichte, kranke Subjekte hervor (Ilouz 2006: 75), die sie zur stetigen Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen, dem Selbst und seinen Beziehungen motiviert und zu heilen verspricht (vgl. Illouz 2009: 297). Eine Leidensgeschichte stutzt dabei die Erzahlung von Selbsthilfe, die von der gegenwartigen Lage ausgeht und samtliche Ereignisse des Lebens als Anzeichen verpasster oder vereitelter Chancen zur Selbstentwicklung versteht (ebd.: 291). Von der Vision von Gesund- heit motiviert, lebt die therapeutische Erzahlung von Selbstbefreiung, also von der Erzahlung der Krankheit undkannnarrativ als Heilmittel gegen ScheitemundNot erscheinen (ebd.: 297). Problemen. So gesehen sind letztere Institutionen des Redens, wobei die Unterscheidung von Problemen des gesellschaftlichen Lebens undjenen der Kommunikation nur schwer scharf zu vollziehen ist (vgl. Luckmann 1986: 202 f.). Kommunikative Gattungen konnen hinsichtlich ihrer Binnen- und Auhenstruktur analysiert werden. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, dass sie in ihrer Entlastungsfunktion analog zu Institu- tionenbetrachtet werdenkonnen (ebd.: 204 f.).
51 Solche Modelle sind Ergebnisse von Sedimentierungsprozessen, die historisch gewachsene und gesell- schaftlich bewahrte kommunikative Losungen fur kommunikative Probleme bereitstellen. Diese Probleme kehren bei bestimmten Rekonstruktionsvorhaben in typischer Weise standig wieder und wollen bewaltigt werden. Durch die Verfestigung der Rekonstruktion nach einem verbindlichen Muster verliert die zugrunde- liegende kommunikative Schwierigkeit ihre Problematik. Mit Hilfe der sozial vorgefertigten Losungsmuster kann sie routiniert bewaltigt werden (Ulmer 1988: 20).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Inhaltsverzeichnis dieses Dokuments?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst Themen wie Einleitung, Gegenstand (Hochsensibilität), theoretische Rahmungen (wissens- und kultursoziologisch), empirische Erkundungen, Auswertung, Heldenbiographien, Ausblick (anthropologische und soziologische Perspektiven), Literatur, Internetquellen, Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis und Anhang.
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Die Hauptthemen sind Hochsensibilität, Konversion, Stigma, Charisma, Selbststigmatisierung, Heldenbiographien, Wahrnehmung aus anthropologischer und soziologischer Perspektive, Sinnessoziologie, Hochsensibilität als neue Institution des Selbst und Selbstermächtigung.
Welche theoretischen Rahmungen werden im Dokument verwendet?
Das Dokument verwendet wissens- und kultursoziologische Rahmungen, einschliesslich Theorien über moderne Wahrnehmungsmythen, Konversion (mit Spielarten, Prozessen und Erzählungen), Stigma, Charisma, Selbststigmatisierung und das Schicksal des Helden.
Welche empirischen Methoden werden im Dokument angewendet?
Das Dokument nutzt ethnographische Erkundungen, methodologische Positionierung, Forschungsfeldwahl, theoretisches und empirisches Sampling, Datenerhebung und berücksichtigt Besonderheiten des Materials bei der Auswertung.
Welche Aspekte werden bei der Auswertung der Daten berücksichtigt?
Die Auswertung berücksichtigt Umstände der Beschäftigung mit Hochsensibilität, Erkenntnismomente und deren Folgen, biographische Neuinterpretationen persönlicher Identität, Herstellung von Intersubjektivität (Hochsensibilität als soziale Identität), Erfahrung von Defektivität und Schuld, Darstellung von Außergewöhnlichkeit sowie biographische Muster der Selbststigmatisierung und Entwicklungsstadien des Helden.
Welche Konzepte werden im Zusammenhang mit Heldenbiographien diskutiert?
Im Zusammenhang mit Heldenbiographien werden Mythos Hochsensibilität, Konversion zur Hochsensibilität, narrative Rekonstruktion beschädigter Identitäten, Geburt und Transformationen des Charisma, Umschlag von beschädigten zu charismatisierten Identitäten sowie die Abenteuer des hochsensiblen Helden thematisiert.
Welche Perspektiven werden im Ausblick auf Hochsensibilität eingenommen?
Der Ausblick umfasst Wahrnehmung aus anthropologischer und soziologischer Perspektive, sinnessoziologische Annäherungen an Hochsensibilität, Hochsensibilität als neue Institution des Selbst und Hochsensibilität als Phänomen der Selbstermächtigung.
Was sind die Forschungsfragen, mit denen sich die Studie auseinandersetzt?
Die Forschungsfragen umfassen, welcher Typus gesellschaftlicher Akteure zum Selbstdeutungsmuster Hochsensibilität greift, welche Krisenerfahrungen im Hintergrund der Neuinterpretation der eigenen Identität als hochsensibel auszumachen sind, wie der Erkenntnismoment umschrieben werden kann, welche Entwicklungsverläufe sich an die Erkenntnis anschliessen und inwiefern die interviewten Personen bei ihren Erzählungen bestimmten kulturellen Mustern folgen.
Was ist das Ziel des Textes bezüglich Hochsensibilität?
Ziel des Textes ist es, die Umdeutung des Selbstverständnisses als hochsensibel als Konversion zu beschreiben, die ihren Antrieb aus der Dialektik von Stigma und Charisma bezieht, und die Dynamik verstehend zu rekonstruieren, die sich an die Erkenntnis anschliesst, hochsensibel zu sein.
Details
- Titel
- Konversion zur Hochsensibilität. Zur charismatischen Transformation beschädigter Identitäten
- Hochschule
- Universität Koblenz-Landau (Soziologie)
- Note
- 1,0
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 192
- Katalognummer
- V1035185
- ISBN (eBook)
- 9783346444554
- ISBN (Buch)
- 9783346444561
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Archetyp Kollektives Unbewusstes Kosmopolitisches Gedächtnis Schuldbewältigung Trauma
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 54,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Konversion zur Hochsensibilität. Zur charismatischen Transformation beschädigter Identitäten, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1035185
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-