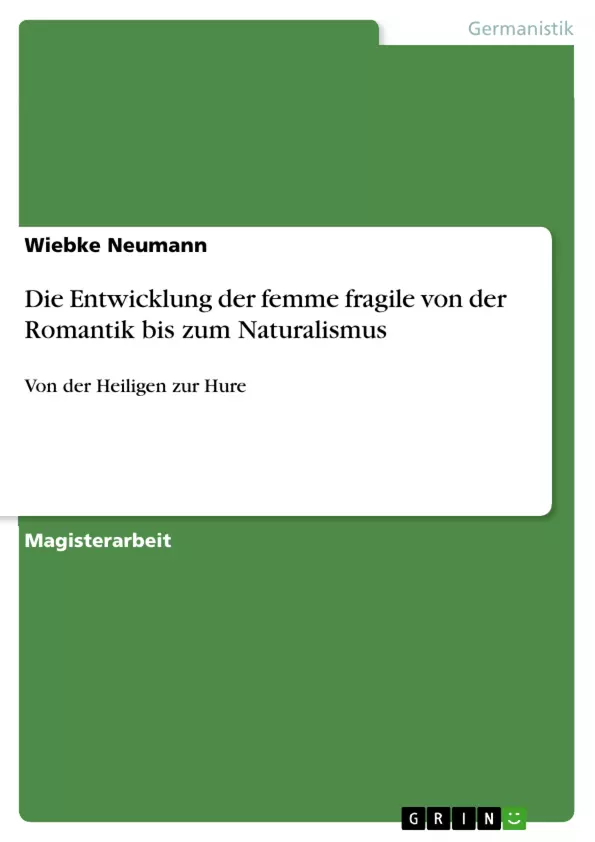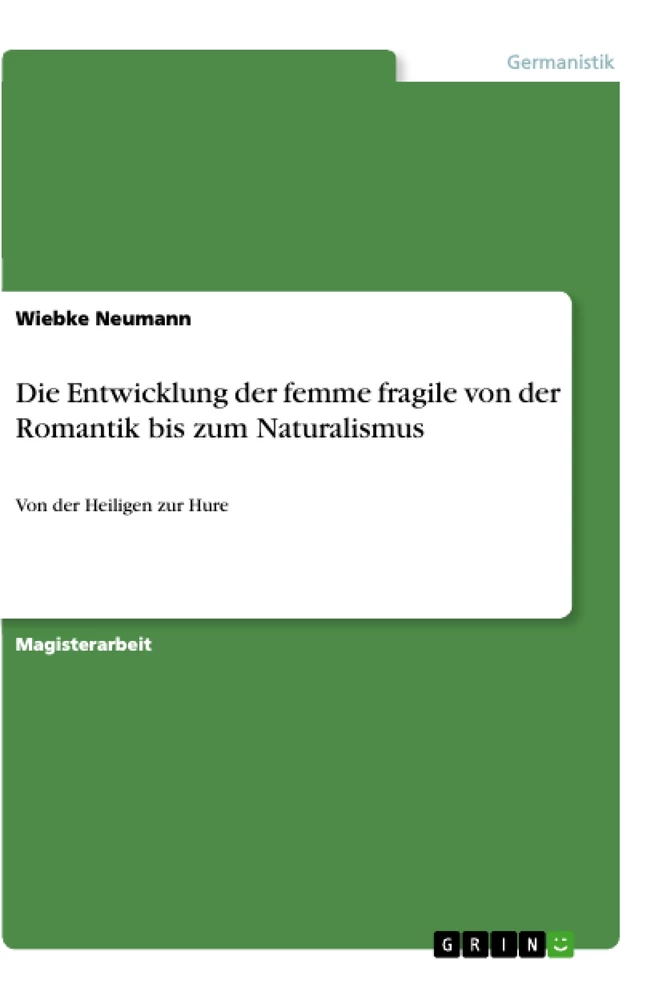
Die Entwicklung der femme fragile von der Romantik bis zum Naturalismus
Magisterarbeit, 1999
91 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die femme fragile
- Merkmale der femme fragile
- Biographische Einflüsse
- Zusammenfassung
- Religion und Liebe
- Priesterin der Liebe
- Heilsbringerinnen im Tod
- Preis für christliches Gottvertrauen
- Zusammenfassung
- Natur und Schicksal
- Naturkinder
- Schuldlose Opfer
- Zusammenfassung
- Unschuld und Krankheit
- Erotische Kinder
- Sterbende Rätsel
- Befleckte Reinheit
- Zusammenfassung
- Exkurs: Otto Weiningers ,,Geschlecht und Charakter“ (1903)
- Werk und Wirkung
- Die Ideen des Otto Weininger
- Weininger und die femme fragile
- Techniken der Verführung: Die Sexualisierung der femme fragile
- Märchen und Mythos
- Trieb und Amoral
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Entwicklung des Frauenbildes der "femme fragile" von der Romantik bis zum Naturalismus. Ziel ist es, die Veränderungen dieses Stereotyps im Kontext gesellschaftlicher und politischer Umwälzungen des 19. Jahrhunderts zu analysieren und die Wünsche und Unsicherheiten der männlichen Konstrukteure aufzuzeigen.
- Die Merkmale der femme fragile und ihre ikonografische Darstellung
- Der Einfluss von Religion, Natur und Schicksal auf die Konstruktion der femme fragile
- Die Verbindung von Unschuld, Krankheit und Sexualität im Bild der femme fragile
- Der Einfluss von Otto Weiningers Werk auf die Darstellung der femme fragile
- Die Sexualisierung der femme fragile und ihre Entwicklung von der "Heiligen zur Hure"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den engen Zusammenhang zwischen Frauenbildern in Literatur und Kunst und dem gesellschaftlichen Status quo. Sie beleuchtet die gesellschaftlichen Umwälzungen des 19. Jahrhunderts – Französische Revolution, Industrialisierung, Frauenbewegung – und deren Einfluss auf die Entstehung der Stereotypen "femme fatale" und "femme fragile" als Ausdruck männlicher Verunsicherung angesichts der veränderten Geschlechterrollen. Die Arbeit fokussiert auf die "femme fragile" und ihre Entwicklung von der Romantik bis zum Naturalismus.
Die femme fragile: Dieses Kapitel definiert die "femme fragile" anhand ihrer körperlichen Merkmale (Zartheit, Zerbrechlichkeit, Krankheit), ihres Verhaltens (Passivität, kindliche Hilflosigkeit) und ihrer symbolischen Bedeutung (Unschuld, Reinheit). Es wird die Rolle von Krankheit und Tod als konstitutive Elemente des Stereotyps hervorgehoben und deren Funktion in der romantisierten Darstellung erläutert.
Religion und Liebe: Dieses Kapitel untersucht die Darstellung der "femme fragile" im Kontext von Religion und Liebe. Es analysiert verschiedene Rollen, wie die der "Priesterin der Liebe" oder die der "Heilsbringerin im Tod", und zeigt auf, wie religiöse Vorstellungen und christliche Werte in die Konstruktion des Stereotyps eingeflochten sind. Die Zusammenfassung des Kapitels fasst die unterschiedlichen Facetten der religiös geprägten Darstellung der "femme fragile" zusammen.
Natur und Schicksal: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss von Natur und Schicksal auf das Bild der "femme fragile". Es analysiert die Darstellung von Naturkindern und schuldlosen Opfern, die oft mit der "femme fragile" assoziiert werden. Die Zusammenfassung beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte der Natur- und Schicksalsbindung und deren Bedeutung für die Charakterisierung der Figur.
Unschuld und Krankheit: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Unschuld, Krankheit und Erotik im Kontext der "femme fragile". Es analysiert die Darstellung erotischer Kinder und sterbender Rätsel, und beleuchtet die Ambivalenz von Reinheit und Befleckung in diesem Stereotyp. Die Zusammenfassung des Kapitels integriert die verschiedenen Facetten von Unschuld, Krankheit und Erotik in die Gesamtdeutung des Kapitels.
Exkurs: Otto Weiningers ,,Geschlecht und Charakter“ (1903): Dieser Exkurs analysiert das Werk von Otto Weininger und seine Relevanz für das Verständnis der "femme fragile". Er untersucht Weiningers Ideen und deren Einfluss auf die literarische Darstellung des Stereotyps. Die Zusammenfassung fasst Weiningers Beitrag und seine Wirkung auf das Frauenbild der "femme fragile" zusammen.
Techniken der Verführung: Die Sexualisierung der femme fragile: Dieses Kapitel untersucht die Sexualisierung der "femme fragile" und die Techniken ihrer Verführung. Es analysiert die Verwendung von Märchen und Mythen sowie die Darstellung von Trieb und Amoralität. Die Zusammenfassung vertieft die Analyse der Techniken der Verführung und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Stereotyps.
Schlüsselwörter
Femme fragile, Romantik, Realismus, Naturalismus, Frauenbild, Geschlechterrollen, 19. Jahrhundert, Gesellschaft, Religion, Liebe, Natur, Schicksal, Krankheit, Unschuld, Sexualität, Otto Weininger, Verführung, Stereotyp.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Die Femme Fragile
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Entwicklung des Frauenbildes der "femme fragile" von der Romantik bis zum Naturalismus im 19. Jahrhundert. Sie analysiert die Veränderungen dieses Stereotyps im Kontext gesellschaftlicher und politischer Umwälzungen und legt den Fokus auf die Wünsche und Unsicherheiten der männlichen Konstrukteure dieses Bildes.
Welche Aspekte der "femme fragile" werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der "femme fragile", darunter ihre körperlichen Merkmale (Zartheit, Zerbrechlichkeit, Krankheit), ihr Verhalten (Passivität, kindliche Hilflosigkeit) und ihre symbolische Bedeutung (Unschuld, Reinheit). Es werden die Einflüsse von Religion, Natur, Schicksal, Krankheit, Sexualität und die Rolle von Otto Weiningers Werk untersucht. Besonders wird die Entwicklung von der "Heiligen zur Hure" analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die femme fragile, Religion und Liebe, Natur und Schicksal, Unschuld und Krankheit, Exkurs: Otto Weiningers ,,Geschlecht und Charakter“ (1903), Techniken der Verführung: Die Sexualisierung der femme fragile und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Wie wird die "femme fragile" in Bezug auf Religion und Liebe dargestellt?
Das Kapitel "Religion und Liebe" analysiert die "femme fragile" als "Priesterin der Liebe" oder "Heilsbringerin im Tod". Es zeigt auf, wie religiöse Vorstellungen und christliche Werte in die Konstruktion des Stereotyps eingeflochten sind.
Welche Rolle spielen Natur und Schicksal in der Konstruktion der "femme fragile"?
Das Kapitel "Natur und Schicksal" untersucht die Darstellung von Naturkindern und schuldlosen Opfern, die oft mit der "femme fragile" assoziiert werden. Es beleuchtet die Natur- und Schicksalsbindung und deren Bedeutung für die Charakterisierung der Figur.
Wie werden Unschuld, Krankheit und Sexualität im Kontext der "femme fragile" dargestellt?
Das Kapitel "Unschuld und Krankheit" analysiert den Zusammenhang zwischen Unschuld, Krankheit und Erotik. Es untersucht die Darstellung erotischer Kinder und sterbender Rätsel und beleuchtet die Ambivalenz von Reinheit und Befleckung.
Welche Bedeutung hat Otto Weiningers Werk für das Verständnis der "femme fragile"?
Der Exkurs zu Otto Weiningers ,,Geschlecht und Charakter“ (1903) analysiert dessen Ideen und deren Einfluss auf die literarische Darstellung des Stereotyps der "femme fragile".
Wie wird die Sexualisierung der "femme fragile" und ihre Verführungstechniken dargestellt?
Das Kapitel "Techniken der Verführung: Die Sexualisierung der femme fragile" untersucht die Sexualisierung des Stereotyps und die verwendeten Verführungstechniken, unter anderem die Verwendung von Märchen und Mythen sowie die Darstellung von Trieb und Amoralität.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Femme fragile, Romantik, Realismus, Naturalismus, Frauenbild, Geschlechterrollen, 19. Jahrhundert, Gesellschaft, Religion, Liebe, Natur, Schicksal, Krankheit, Unschuld, Sexualität, Otto Weininger, Verführung, Stereotyp.
Welche gesellschaftlichen Umwälzungen werden in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die gesellschaftlichen Umwälzungen des 19. Jahrhunderts wie die Französische Revolution, die Industrialisierung und die Frauenbewegung und deren Einfluss auf die Entstehung der Stereotype "femme fatale" und "femme fragile".
Details
- Titel
- Die Entwicklung der femme fragile von der Romantik bis zum Naturalismus
- Untertitel
- Von der Heiligen zur Hure
- Hochschule
- Universität Bielefeld
- Note
- 1,0
- Autor
- Wiebke Neumann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1999
- Seiten
- 91
- Katalognummer
- V1036908
- ISBN (eBook)
- 9783346447876
- ISBN (Buch)
- 9783346447883
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- mit Auszeichnung bestanden
- Schlagworte
- femme fragile Romantik Naturalismus Frauenbilder
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Wiebke Neumann (Autor:in), 1999, Die Entwicklung der femme fragile von der Romantik bis zum Naturalismus, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1036908
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-