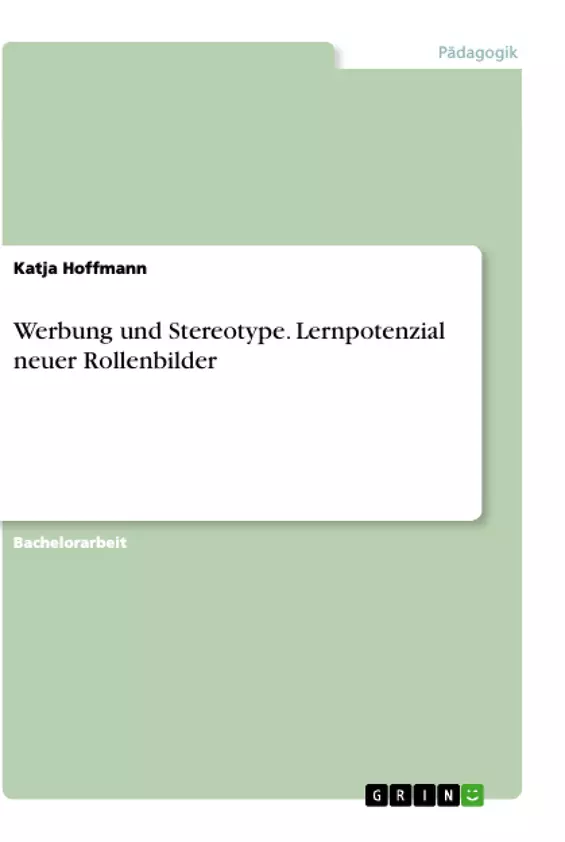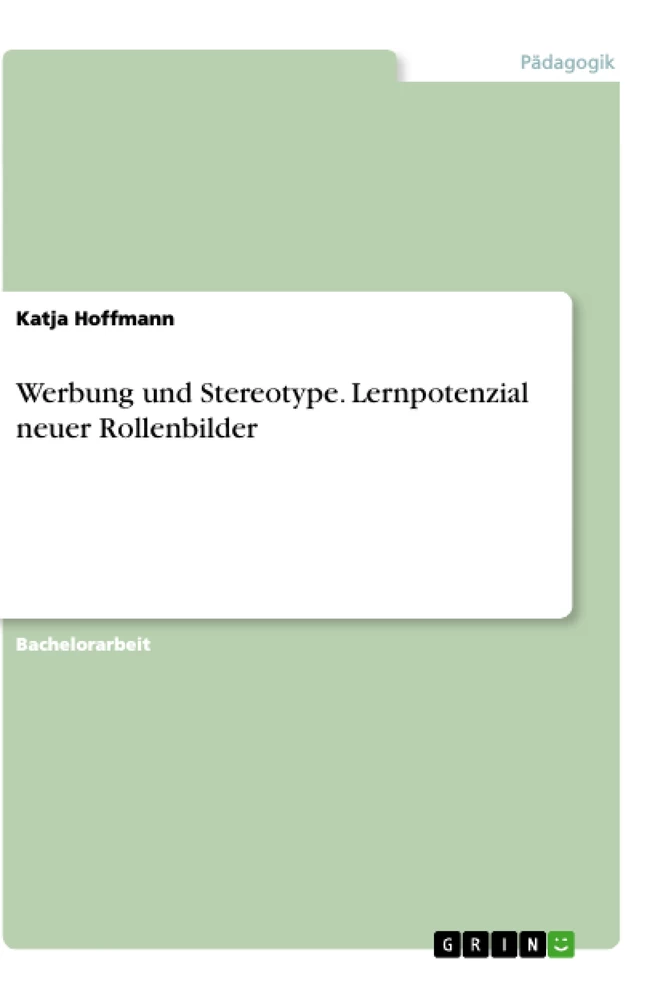
Werbung und Stereotype. Lernpotenzial neuer Rollenbilder
Bachelorarbeit, 2020
70 Seiten, Note: 2,2
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Erkenntnisinteresse
- Gegenwärtiger Forschungsstand und Literaturrecherche
- Theoretischer Rahmen
- Begriffserläuterungen und -abgrenzungen
- Entstehung, Effekte, Intervention
- Werbung und Stereotype
- Vorläufige Zusammenfassung und Bedeutung für Erhebung
- Empirischer Teil
- Befragung der Konsumierenden
- Methodik, Untersuchungsform, Stichprobenverfahren, Pretest
- Datenerhebung
- Datenauswertung
- Fachpersonenbefragung
- Methodik, Untersuchungsform, Stichprobenverfahren, Pretest
- Datenerhebung
- Datenauswertung
- Berichterstattung
- Ergebnisse und Diskussion
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Frage, welches Lernpotenzial neue Geschlechterbilder in der Werbung besitzen und ob diese klassische Rollenbilder ablösen können. Die Arbeit untersucht dies anhand von zwei Online-Umfragen. Die erste Umfrage befasst sich mit der Wahrnehmung und Identifikation von Stereotypen in der Werbung durch Konsumierende. Die zweite Umfrage erfragt die Einschätzungen frühpädagogischer Fachkräfte bezüglich des Lernpotenzials neuer Geschlechterbilder.
- Analyse der Darstellung von Geschlechterrollen in der Werbung
- Untersuchung der Wahrnehmung von Stereotypen durch Konsumierende
- Bewertung des Lernpotenzials neuer Geschlechterbilder durch Fachkräfte
- Bewertung der Möglichkeit, klassische Rollenbilder durch neue Geschlechterbilder abzulösen
- Entwicklung von Empfehlungen für die Gestaltung von Werbung mit vielfältigeren Geschlechterbildern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Geschlechterdarstellung in der Werbung ein und stellt das Forschungsinteresse der Arbeit dar. Der theoretische Rahmen behandelt die relevanten Begriffsdefinitionen, die Entstehung und Effekte von Stereotypen sowie die Rolle der Werbung in der Reproduktion von Geschlechterrollen. Der empirische Teil beschreibt die Durchführung und Auswertung der zwei Online-Umfragen, die sich mit der Wahrnehmung von Stereotypen durch Konsumierende und der Einschätzung des Lernpotenzials neuer Geschlechterbilder durch Fachkräfte befassen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Stereotype, Geschlechterrollen, Werbung, Medienkonsum, Genderbilder, Lernpotenzial, frühpädagogische Fachkräfte, Online-Umfragen, qualitative und quantitative Datenanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirken Stereotype in der Werbung auf Konsumenten?
Stereotype festigen klassische Rollenbilder und können die Selbstwahrnehmung sowie soziale Erwartungen beeinflussen, oft unbewusst während des Medienkonsums.
Welches Lernpotenzial bieten neue Genderbilder?
Neue, vielfältigere Geschlechterbilder können zu einer freieren Selbstentfaltung beitragen, Ausgrenzung reduzieren und veraltete gesellschaftliche Normen aufbrechen.
Befürworten Konsumenten einen Wandel in der Werbegestaltung?
Die Untersuchung zeigt, dass ein Großteil der Befragten moderne und weniger stereotype Darstellungen von Männern und Frauen in der Werbung ausdrücklich begrüßt.
Was sagen frühpädagogische Fachkräfte zu neuen Rollenbildern?
Fachkräfte sehen positive Lerneffekte für Kinder, da vielfältige Vorbilder die Entwicklung individueller Identitäten jenseits starrer Klischees unterstützen.
Wie sollten Werbefiguren zukünftig gestaltet werden?
Die Arbeit empfiehlt, Werbefiguren anhand vielfältigerer Charakteristika zu entwerfen, um klassische Stereotype nachhaltig durch modernere Bilder abzulösen.
Details
- Titel
- Werbung und Stereotype. Lernpotenzial neuer Rollenbilder
- Hochschule
- Technische Universität Chemnitz (Pädagogik)
- Veranstaltung
- Bachelorarbeit
- Note
- 2,2
- Autor
- Katja Hoffmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 70
- Katalognummer
- V1043181
- ISBN (eBook)
- 9783346464958
- ISBN (Buch)
- 9783346464965
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Interkulturelle Pädagogik Interkulturell Pädagogik Medienpädagogik Medienbildung Stereotype Lernpotenzial Rollenbilder Mixed Methods Umfrage Qualitative Inhaltsanalyse Quantitative Forschung Bachelorarbeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Katja Hoffmann (Autor:in), 2020, Werbung und Stereotype. Lernpotenzial neuer Rollenbilder, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1043181
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-