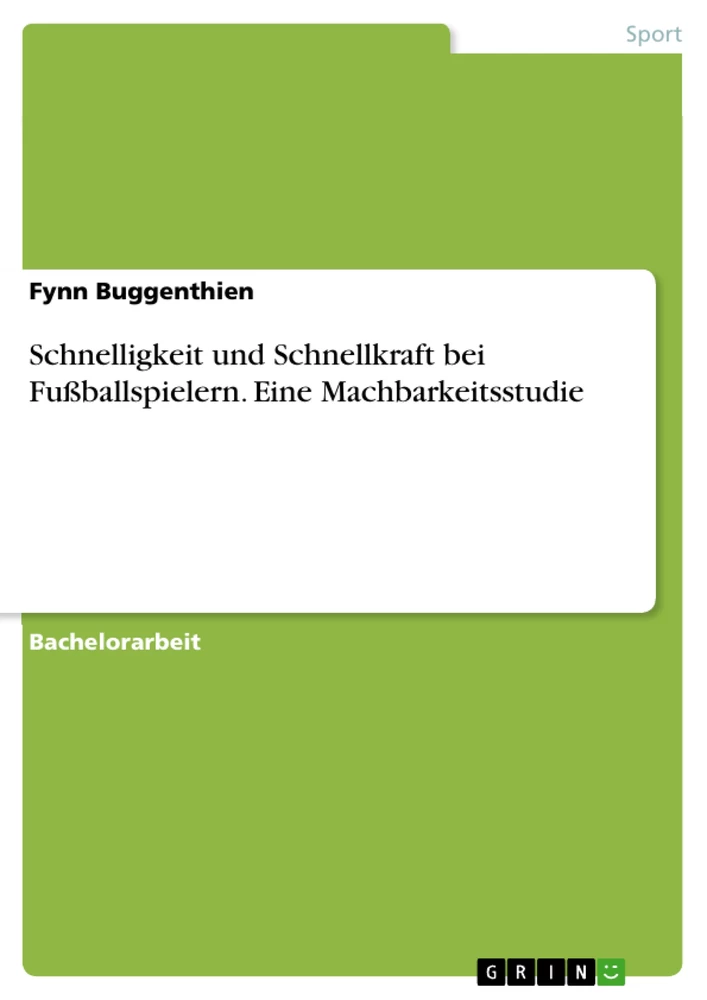
Schnelligkeit und Schnellkraft bei Fußballspielern. Eine Machbarkeitsstudie
Bachelorarbeit, 2019
44 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Schnellkraft
- 2.2 Reaktivkraft
- 2.3 Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus (DVZ)
- 2.4 Sprünge
- 2.5 Schnellkrafttraining
- 2.6 Aktueller Forschungsstand
- 3. Fragestellung und Hypothesen
- 4. Methodik
- 4.1 Studiendesign
- 4.2 Stichprobe
- 4.3 Untersuchungsablauf
- 4.4 Testverfahren
- 4.4.1 Testverfahren Sprünge
- 4.4.2 Testverfahren Counter Movement Jump (CMJ)
- 4.4.3 Testverfahren Drop Jump (DJ)
- 4.4.4 Lichtschrankenläufe
- 4.4.5 Testverfahren Schussstärke
- 4.5 Messsysteme
- 5. Mathematische-statistische Auswertung
- 6. Ergebnisse
- 6.1 Messergebnisse CMJ
- 6.2 Messergebnisse DJ
- 6.3 Messergebnisse 5m Sprint
- 6.4 Messergebnisse 20m Sprint
- 6.5 Messergebnisse Schussstärke
- 7. Diskussion
- 7.1 Diskussion der Hypothesen
- 7.2 Generalisierbarkeit und Limitierung der Untersuchung
- 8. Fazit
- 9. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorthesis untersucht die Auswirkungen eines achtwöchigen Trainings auf die Schnelligkeit und Schnellkraft von Fußballspielern. Die Studie vergleicht eine Experimentalgruppe mit einer Kontrollgruppe, um die Effektivität des Trainingsprogramms zu erforschen.
- Einfluss eines achtwöchigen Schnellkrafttrainings auf die Leistungsfähigkeit von Fußballspielern
- Vergleich von Schnelligkeits- und Schnellkraftwerten in einer Experimentalgruppe und einer Kontrollgruppe
- Analyse verschiedener Testverfahren zur Messung von Schnelligkeit und Schnellkraft
- Diskussion der Ergebnisse und Generalisierbarkeit der Untersuchung
- Bewertung der Effektivität des Trainingsprogramms für die Steigerung von Schnelligkeit und Schnellkraft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Schnelligkeit und Schnellkraft im Fußball ein und erläutert die Relevanz des Themas. Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Studie, indem es Konzepte wie Schnellkraft, Reaktivkraft, Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus und Schnellkrafttraining diskutiert. Es beleuchtet den aktuellen Forschungsstand und die Bedeutung von Schnellkrafttraining für die Leistungsfähigkeit von Fußballspielern. Kapitel 3 formuliert die Fragestellung der Studie und stellt Hypothesen auf, die im weiteren Verlauf untersucht werden sollen. Die Methodik in Kapitel 4 beschreibt den Studiendesign, die Stichprobe, den Untersuchungsablauf, die Testverfahren und die verwendeten Messsysteme. Die mathematische-statistische Auswertung der Daten wird in Kapitel 5 dargestellt. Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Studie, wobei die Messergebnisse verschiedener Tests, wie z.B. Counter-Movement-Jump, Drop Jump und Lichtschrankenlauf, analysiert werden. Kapitel 7 diskutiert die Ergebnisse im Kontext der Hypothesen, beleuchtet die Generalisierbarkeit und Limitierung der Untersuchung und zieht Schlussfolgerungen aus den ermittelten Daten.
Schlüsselwörter
Schnellkraft, Schnelligkeit, Fußball, Schnellkrafttraining, Reaktivkraft, Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus, Counter-Movement-Jump, Drop Jump, Lichtschrankenlauf, Schussstärke, Trainingseffekte, Performance-Verbesserung, empirische Studie, Interventionsgruppe, Kontrollgruppe.
Details
- Titel
- Schnelligkeit und Schnellkraft bei Fußballspielern. Eine Machbarkeitsstudie
- Hochschule
- Universität Hamburg
- Note
- 1,7
- Autor
- Fynn Buggenthien (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 44
- Katalognummer
- V1059612
- ISBN (eBook)
- 9783346470898
- ISBN (Buch)
- 9783346470904
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Schnelligkeit Schnellkraft Fallstudie Trainingsplan Verbesserung Dropjump Countermovemantjump Sprint
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Fynn Buggenthien (Autor:in), 2019, Schnelligkeit und Schnellkraft bei Fußballspielern. Eine Machbarkeitsstudie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1059612
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









