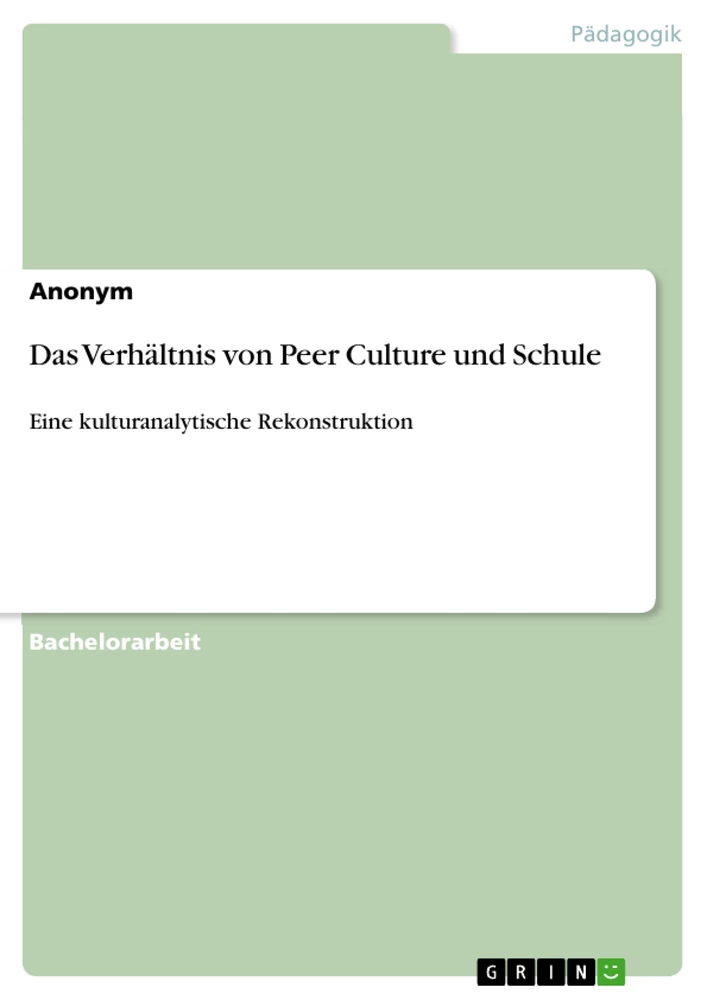
Das Verhältnis von Peer Culture und Schule
Bachelorarbeit, 2021
36 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Peers
- 2.2 Peer-Groups
- 2.3 Peer-Culture
- 3. Forschungshistorie
- 4. Peers und ihre Wirkung im Leben von Kindern und Jugendlichen
- 4.1 Unterschiede zwischen Peers und Familie im Kontext der Sozialisation
- 4.2 Die Wirkung von Peers in der Schule
- 5. Peer-Culture in jeder Schule gleich? Einflussfaktoren auf die Entfaltung einer Schülerkultur
- 5.1 Peer-Culture und Schulkultur
- 5.2 Peer-Culture in aufstrebenden Schulformen am Beispiel der Ganztagsschule
- 6. Peer-Culture in der Schule – ein mikroperspektivischer Blick
- 6.1 Die Perspektive der Schüler/innen auf die Institution Schule
- 6.2 Die Entstehung und Bedeutung von Peer-Culture in der Schule
- 6.3 Erwachsene in der Kultur von Peers - Die Verflochtenheit von Peer-Culture und Lehrkraft
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Peer-Culture und Schule und verfolgt das Ziel, eine kulturanalytische Rekonstruktion des Schülerhandels zu liefern. Die Arbeit untersucht, wie sich Peer-Culture im schulischen Kontext entwickelt, welche Einflussfaktoren auf ihre Entfaltung wirken und wie sie sich auf das schulische Leben von Kindern und Jugendlichen auswirkt.
- Die Bedeutung von Peers und Peer-Culture für die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen
- Die Rolle von Peer-Culture im schulischen Kontext und ihre Interaktion mit der Institution Schule
- Die Herausarbeitung der Besonderheiten von Peer-Culture in verschiedenen Schulformen
- Die Bedeutung der Perspektive der Schüler/innen auf die Institution Schule und die Entstehung von Peer-Culture
- Die Interaktion zwischen Peer-Culture und der Lehrkraft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand "Peer-Culture in der Schule" vor und hebt die Bedeutung des Themas im Kontext der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen hervor.
- Kapitel 2: Begriffsdefinitionen - Dieses Kapitel klärt die wichtigsten Begriffe, wie "Peers", "Peer-Groups" und "Peer-Culture" und zeigt ihre Relevanz für die schulische Forschung.
- Kapitel 3: Forschungshistorie - In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Forschungslandschaft zur Peer-Culture gegeben, wobei die zentralen Forschungsansätze und -ergebnisse skizziert werden.
- Kapitel 4: Peers und ihre Wirkung im Leben von Kindern und Jugendlichen - Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss von Peers auf die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen und untersucht die Unterschiede zwischen Peer- und Familienbeziehungen.
- Kapitel 5: Peer-Culture in jeder Schule gleich? Einflussfaktoren auf die Entfaltung einer Schülerkultur - Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Entstehung und Entwicklung von Peer-Culture in der Schule und beleuchtet die Besonderheiten von Peer-Culture in verschiedenen Schulformen, wie zum Beispiel der Ganztagsschule.
- Kapitel 6: Peer-Culture in der Schule – ein mikroperspektivischer Blick - Dieses Kapitel fokussiert auf die Perspektive der Schüler/innen auf die Institution Schule und untersucht die Entstehung und Bedeutung von Peer-Culture in der Schule. Des Weiteren beleuchtet es die Interaktion zwischen Peer-Culture und der Lehrkraft.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den zentralen Themenbereichen Peer-Culture, Schulkultur, Sozialisation, Identitätsbildung, Schülerperspektive, Lehrkraft und Institution Schule. Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Peer-Culture für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext und analysiert die vielfältigen Interaktionen zwischen Peer-Culture und der Institution Schule.
Details
- Titel
- Das Verhältnis von Peer Culture und Schule
- Untertitel
- Eine kulturanalytische Rekonstruktion
- Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- Note
- 1,0
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 36
- Katalognummer
- V1059924
- ISBN (eBook)
- 9783346474711
- ISBN (Buch)
- 9783346474728
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Peer-Culture Peers und Schule
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Das Verhältnis von Peer Culture und Schule, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1059924
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









