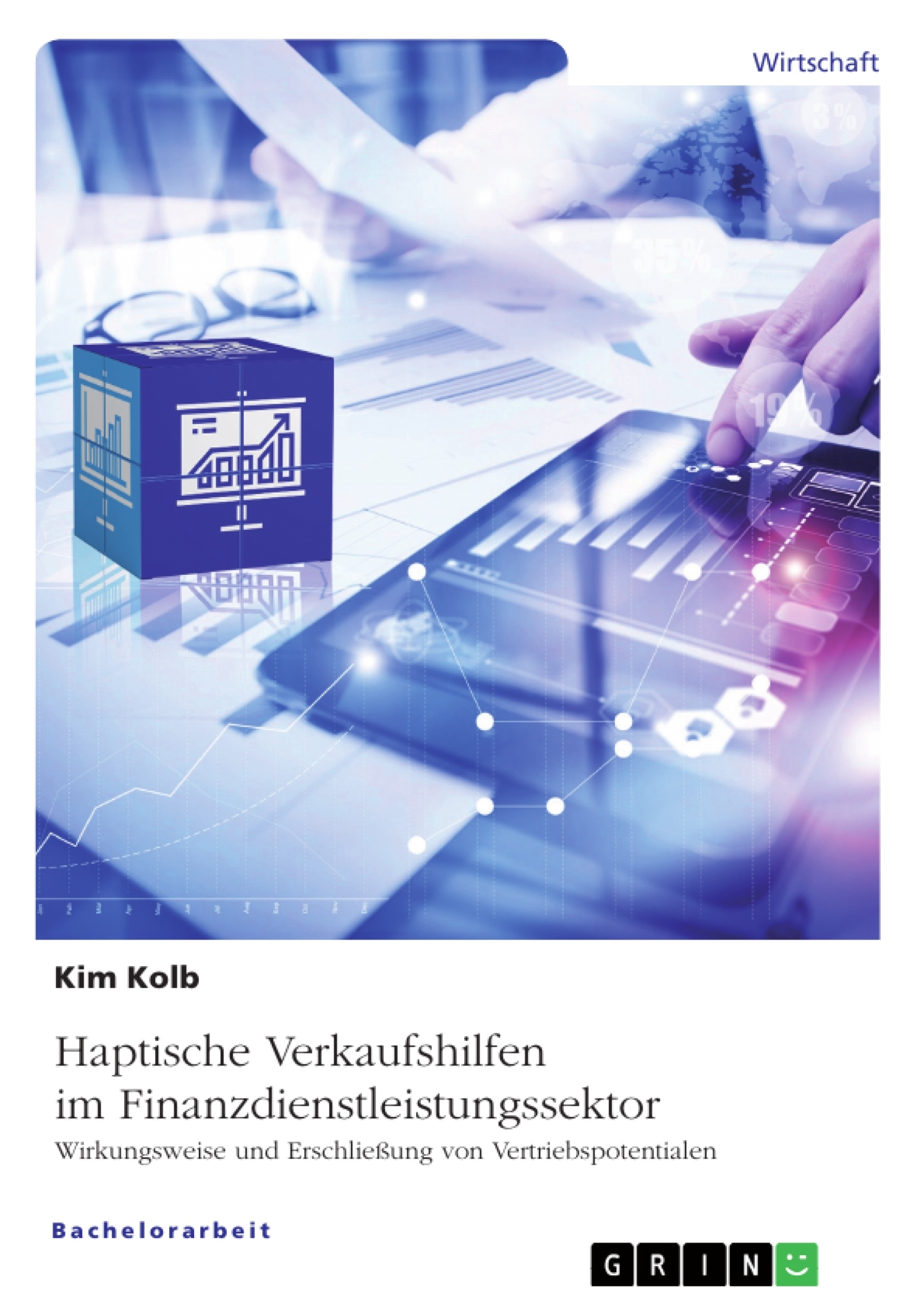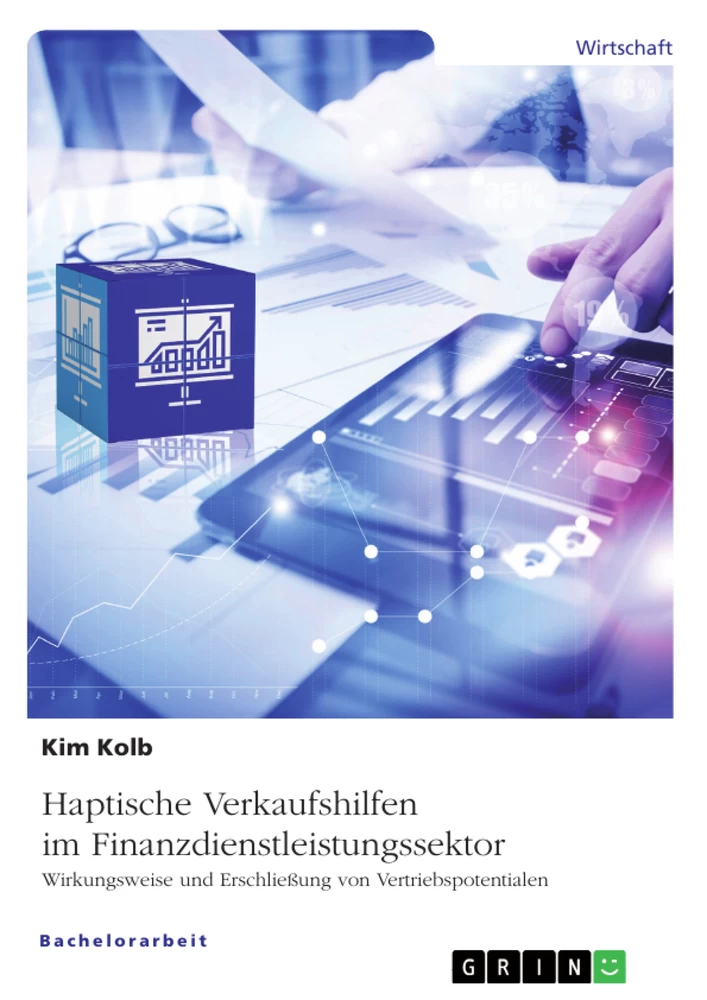
Haptische Verkaufshilfen im Finanzdienstleistungssektor. Wirkungsweise und Erschließung von Vertriebspotentialen
Bachelorarbeit, 2019
59 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
- Kapitel 3: Haptische Verkaufshilfen
- Kapitel 4: Methodik
- Kapitel 5: Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Wirkung haptischer Verkaufshilfen im Finanzdienstleistungssektor und deren Potential zur Erschließung von Vertriebspotentialen. Die Arbeit zielt darauf ab, den Nutzen des Haptik-Effekts aufzuzeigen und Handlungsempfehlungen für die Praxis abzuleiten.
- Wirkungsweise haptischer Verkaufshilfen
- Nutzen von Haptik im Finanzdienstleistungssektor
- Kategorisierung haptischer Verkaufshilfen
- Verbesserung der Kundenberatung durch Haptik
- Steigerung der Vertriebspotentiale
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Relevanz haptischer Verkaufshilfen im Kontext der Finanzdienstleistung, wo Produkte oft abstrakt und schwer greifbar sind. Es wird die Forschungsfrage formuliert: Wie wirken haptische Verkaufshilfen und wie können sie genutzt werden, um Vertriebspotentiale im Finanzdienstleistungssektor zu erschließen? Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die Methodik der Untersuchung.
Kapitel 2: Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beleuchtet die Bedeutung der Lernpsychologie und der Funktionsweise des menschlichen Gehirns für die Informationsvermittlung, insbesondere im Hinblick auf die Überlastung des visuellen und auditiven Systems. Es wird dargelegt, warum der Tastsinn einen wichtigen Kanal zur Informationsübertragung darstellt, besonders im Kontext von abstrakten Finanzprodukten. Das Kapitel dient als Basis für das Verständnis der Wirkung haptischer Verkaufshilfen.
Kapitel 3: Haptische Verkaufshilfen: In diesem Kapitel werden verschiedene Arten haptischer Verkaufshilfen kategorisiert und ihre Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten im Detail beschrieben. Es werden Beispiele für haptische Verkaufshilfen genannt und ihre spezifischen Vor- und Nachteile im Bezug auf die Zielgruppe und den Vermittlungszweck untersucht. Dieser Abschnitt bildet die Grundlage für die Analyse der empirischen Ergebnisse.
Kapitel 4: Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit, einschließlich der verwendeten Methoden zur Datenerhebung und -analyse. Es wird detailliert erläutert, wie die in Kapitel 3 beschriebenen haptischen Verkaufshilfen untersucht und kategorisiert wurden. Die gewählte Methodik wird begründet und im Kontext der Forschungsfrage eingeordnet.
Kapitel 5: Ergebnisse: Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es wird aufgezeigt, wie die Anwendung haptischer Verkaufshilfen zu einer authentischeren Beratung, zur Darstellung abstrakter Kundenvorteile und zur Erklärung komplexer Finanzprodukte beiträgt. Die Ergebnisse belegen die positiven Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Produktqualität, die Einstellung gegenüber der Dienstleistung und die Bereitschaft, Premiumpreise zu zahlen.
Schlüsselwörter
Haptische Verkaufshilfen, Finanzdienstleistung, Vertriebspotentiale, Lernpsychologie, Kundengewinnung, Kundenberatung, Tastsinn, Premiumpreise, Produktqualität, abstrakte Produkte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Haptische Verkaufshilfen im Finanzdienstleistungssektor
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Wirkung von haptischen Verkaufshilfen im Finanzdienstleistungssektor und deren Potential zur Steigerung der Vertriebspotentiale. Sie analysiert den Nutzen des Haptik-Effekts und leitet daraus Handlungsempfehlungen für die Praxis ab.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Wirkungsweise haptischer Verkaufshilfen, ihren Nutzen im Finanzdienstleistungssektor, ihre Kategorisierung, die Verbesserung der Kundenberatung durch Haptik und die Steigerung der Vertriebspotentiale. Es werden theoretische Grundlagen der Lernpsychologie und der Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen, Haptische Verkaufshilfen, Methodik und Ergebnisse. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau vor. Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen. Kapitel 3 kategorisiert und beschreibt haptische Verkaufshilfen. Kapitel 4 beschreibt die Methodik der Untersuchung. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wirken haptische Verkaufshilfen und wie können sie genutzt werden, um Vertriebspotentiale im Finanzdienstleistungssektor zu erschließen?
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Methodik der Datenerhebung und -analyse. Es wird erläutert, wie die haptischen Verkaufshilfen untersucht und kategorisiert wurden. Die gewählte Methodik wird begründet und im Kontext der Forschungsfrage eingeordnet.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse zeigen, wie der Einsatz haptischer Verkaufshilfen zu einer authentischeren Beratung, zur Darstellung abstrakter Kundenvorteile und zur Erklärung komplexer Finanzprodukte beiträgt. Die positiven Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Produktqualität, die Einstellung gegenüber der Dienstleistung und die Bereitschaft, Premiumpreise zu zahlen, werden belegt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Haptische Verkaufshilfen, Finanzdienstleistung, Vertriebspotentiale, Lernpsychologie, Kundengewinnung, Kundenberatung, Tastsinn, Premiumpreise, Produktqualität, abstrakte Produkte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit Vertrieb, Kundenberatung und der Anwendung von innovativen Methoden im Finanzdienstleistungssektor beschäftigen. Sie bietet praktische Handlungsempfehlungen für die Verbesserung der Kundenkommunikation und die Steigerung der Vertriebserfolge.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnte ein Link zur vollständigen Arbeit eingefügt werden, falls verfügbar)
Details
- Titel
- Haptische Verkaufshilfen im Finanzdienstleistungssektor. Wirkungsweise und Erschließung von Vertriebspotentialen
- Hochschule
- Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn
- Note
- 1,7
- Autor
- Kim Kolb (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V1066490
- ISBN (eBook)
- 9783346497000
- ISBN (Buch)
- 9783346497017
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Verkauf Vertrieb Verkaufsförderung Umsatzsteigerung FInanzdienstleistung FDL Bankprodukte Versicherungsprodukte verkaufen vertreiben Umsatz steigern Gewinn steigern Geld verdienen kaufen Geldanlage Versicherung Altersvorsorge Konto Kreditkarten Krankenversicherung Sachversicherung Zukunft Kaufentscheidung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Kim Kolb (Autor:in), 2019, Haptische Verkaufshilfen im Finanzdienstleistungssektor. Wirkungsweise und Erschließung von Vertriebspotentialen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1066490
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-