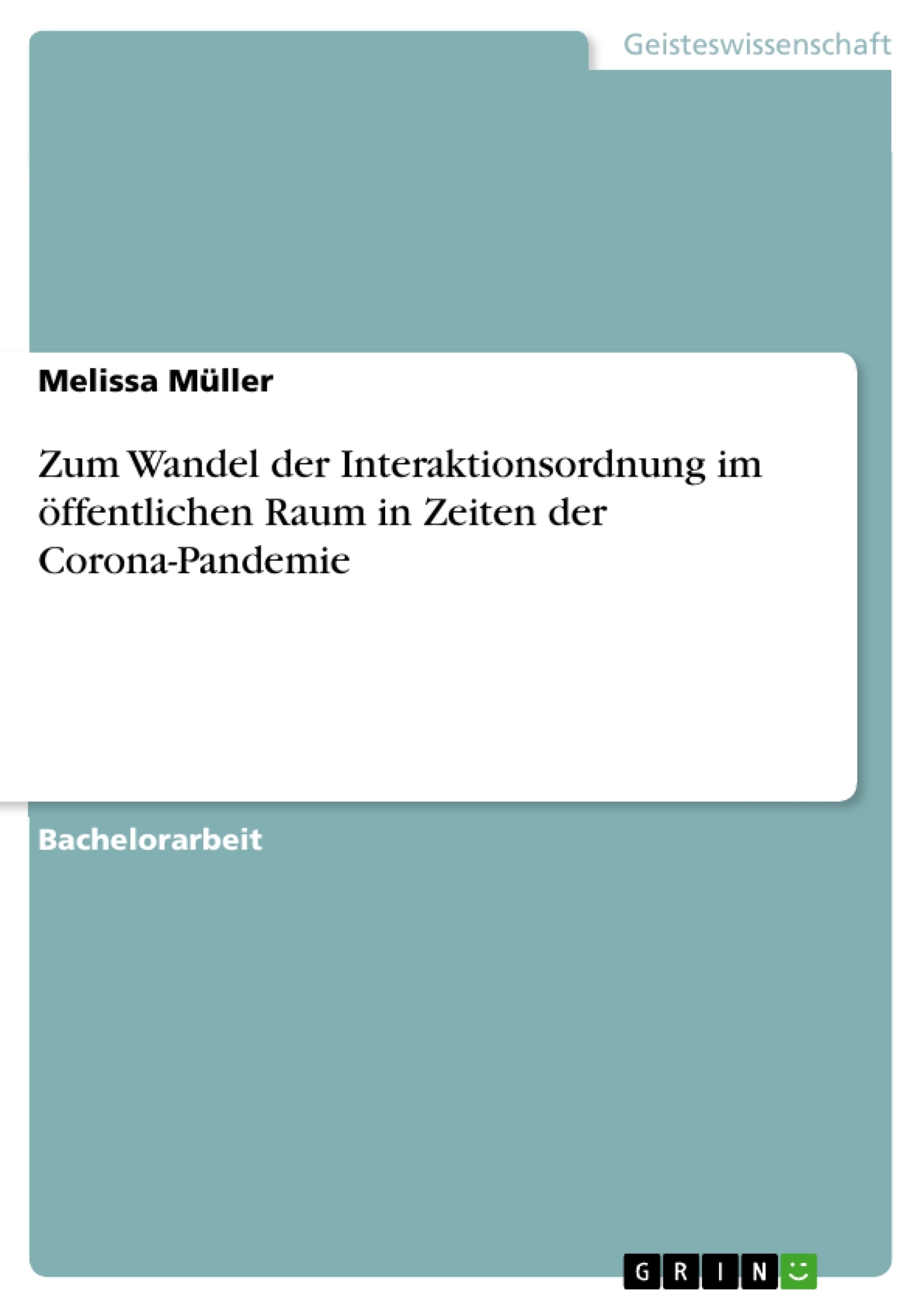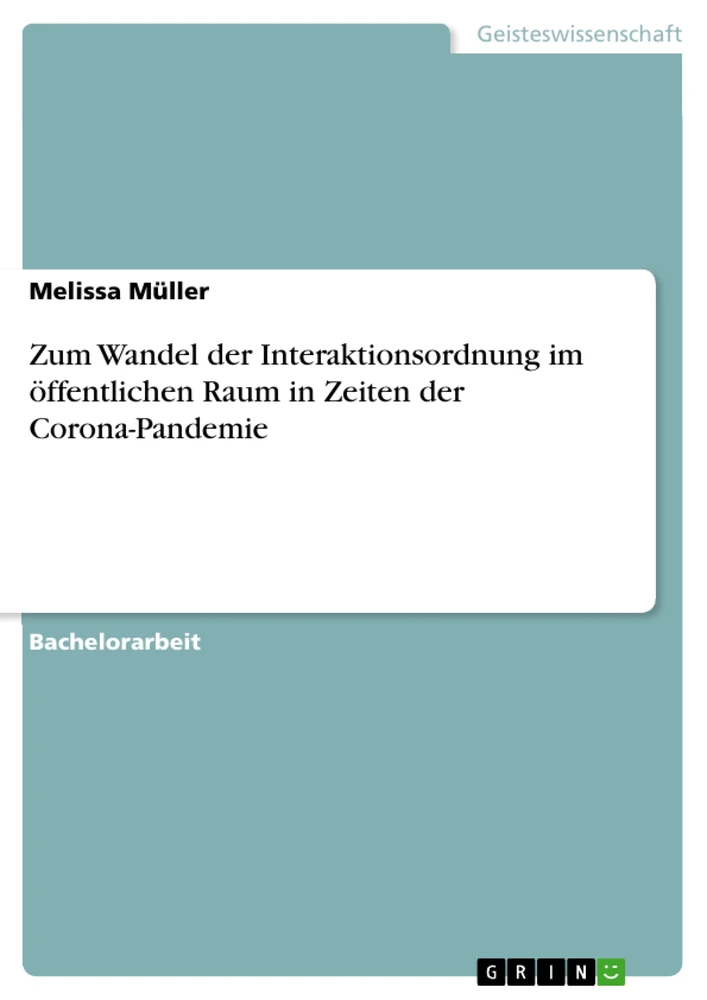
Zum Wandel der Interaktionsordnung im öffentlichen Raum in Zeiten der Corona-Pandemie
Bachelorarbeit, 2021
35 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Interaktionssoziologie nach Erving Goffman
- Das Alltägliche als Gegenstand
- Die Interaktionsordnung
- Der Interaktionsbegriff
- Die Organisation von Körpern im Raum
- Interaktionsrituale
- Der Wandel der Interaktionsordnung
- Abstand halten
- Maske tragen
- Neue Höflichkeiten
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht den Wandel der Interaktionsordnung im öffentlichen Raum im Kontext der Corona-Pandemie. Sie fokussiert sich auf die Veränderungen, die durch Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, wie Abstandhalten, Masketragen und neue Höflichkeitsformen, hervorgerufen wurden. Die Arbeit greift auf die Interaktionssoziologie von Erving Goffman zurück, um die Veränderungen in den alltäglichen Begegnungen von Angesicht zu Angesicht zu analysieren.
- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Interaktionsordnung im öffentlichen Raum
- Die Rolle von Abstandhalten, Masketragen und neuen Höflichkeitsformen in der Gestaltung von Interaktionen
- Die Anwendung der Interaktionssoziologie von Erving Goffman auf den Wandel der Interaktionsordnung
- Die Bedeutung von Face-to-Face-Interaktionen in der digitalen Welt
- Die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf das soziale Leben und die gesellschaftliche Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Abstandhaltens. Es wird untersucht, wie die räumliche Vergrößerung der „Territorien“ (Goffman, 1974) eines Individuums zur Vermeidung einer Ansteckung mit dem Coronavirus die Interaktionsordnung im öffentlichen Raum beeinflusst.
Das zweite Kapitel analysiert das Masketragen als weitere Corona-Maßnahme und erörtert, wie es die Kommunikation im öffentlichen Raum verändert und welche Auswirkungen es auf die Interaktionsordnung hat.
Das dritte Kapitel untersucht die neuen Höflichkeitsrituale, die sich als Konsequenz der veränderten Interaktion im öffentlichen Raum ergeben. Der vergrößerte Abstand und die eingeschränkte Kommunikation durch die Maske machen neue Formen der Höflichkeit erforderlich.
Schlüsselwörter
Interaktionssoziologie, Erving Goffman, Corona-Pandemie, Interaktionsordnung, öffentlicher Raum, Abstandhalten, Masketragen, Höflichkeitsrituale, Face-to-Face-Interaktionen, digitale Welt, soziale Ordnung, gesellschaftliche Ordnung.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat die Corona-Pandemie die Interaktion im öffentlichen Raum verändert?
Maßnahmen wie Abstandhalten und Masketragen haben die Interaktionsordnung und die nonverbale Kommunikation nachhaltig beeinflusst.
Was bedeutet „Interaktionsordnung“ nach Erving Goffman?
Goffman beschreibt damit die Regeln und Rituale, die alltägliche Face-to-Face-Begegnungen strukturieren und für soziale Ordnung sorgen.
Welchen Einfluss hat das Masketragen auf die Kommunikation?
Die Maske schränkt die Mimik ein, was die Interpretation von Emotionen erschwert und neue Formen der Bestätigung (z.B. durch Gestik) erforderlich macht.
Warum ist „Abstandhalten“ soziologisch interessant?
Es vergrößert das persönliche „Territorium“ eines Individuums und verändert die Organisation von Körpern im Raum.
Was sind „neue Höflichkeiten“ in der Pandemie?
Es handelt sich um Rituale wie das Ausweichen auf dem Gehweg oder neue Begrüßungsformen, die trotz Distanz Höflichkeit signalisieren sollen.
Was versteht Goffman unter Interaktionsritualen?
Es sind standardisierte Handlungen (z.B. Grüßen oder Blickvermeidung), die den reibungslosen Ablauf sozialer Begegnungen sichern.
Details
- Titel
- Zum Wandel der Interaktionsordnung im öffentlichen Raum in Zeiten der Corona-Pandemie
- Hochschule
- Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Note
- 1,3
- Autor
- Melissa Müller (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 35
- Katalognummer
- V1068921
- ISBN (eBook)
- 9783346477620
- ISBN (Buch)
- 9783346477637
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Goffman Interaktionsordnung Corona Interaktionssoziologie face to face interaktion Höflichkeitsrituale Maske tragen Abstand halten
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Melissa Müller (Autor:in), 2021, Zum Wandel der Interaktionsordnung im öffentlichen Raum in Zeiten der Corona-Pandemie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1068921
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-