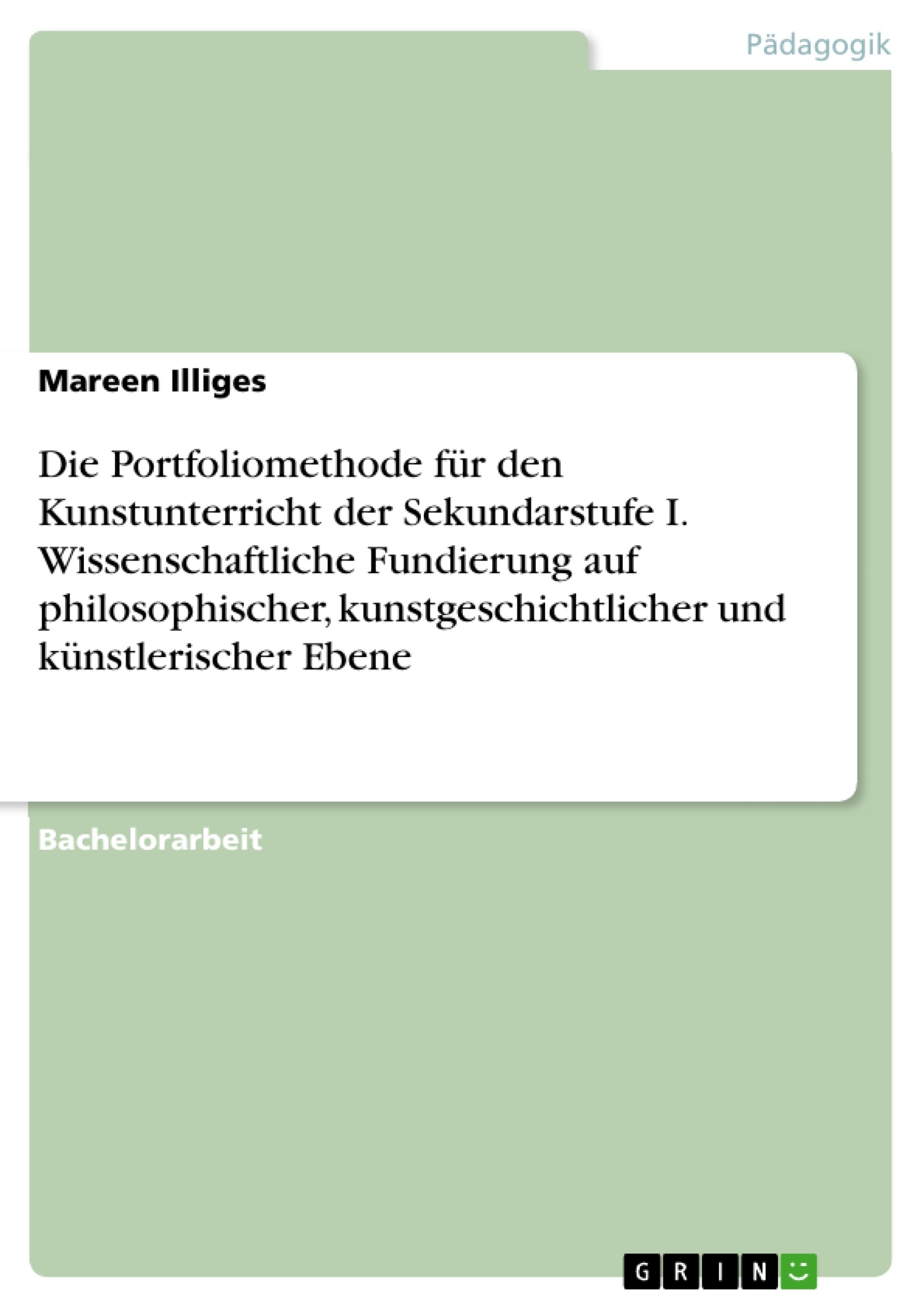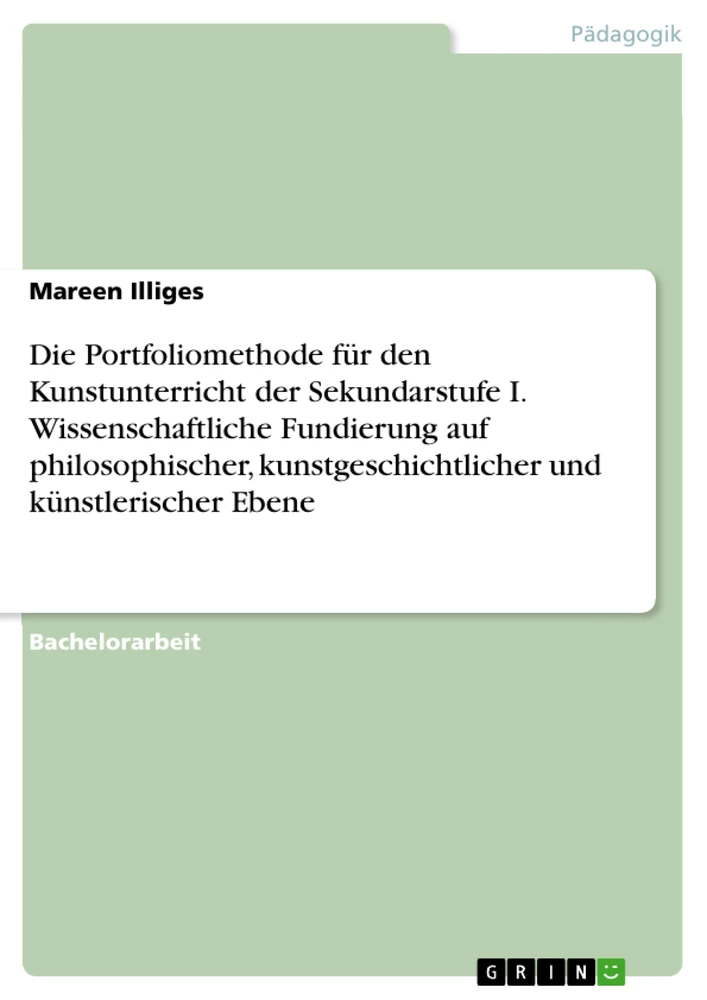
Die Portfoliomethode für den Kunstunterricht der Sekundarstufe I. Wissenschaftliche Fundierung auf philosophischer, kunstgeschichtlicher und künstlerischer Ebene
Bachelorarbeit, 2021
52 Seiten, Note: 1.1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Portfolio
- 2.1 Ursprünge
- 2.2 Definition und Portfolioarten
- 2.3 Portfolios im kompetenzorientierten Unterricht – Eine Verortung in der Unterrichtsentwicklung und Lerntheorie
- 2.4 Potentiale der schulischen Portfolioarbeit
- 2.5 Kritische Beleuchtung - Auswirkungen auf die Lehrerrolle
- 3. Curriculare Anforderungen an das Fach Kunst – Einblicke in den Kernlehrplan
- 3.1 Ziele des Kunstunterrichts
- 3.2 Kompetenzbereiche und Inhalte des Faches
- 3.3 Leistungsbewertung
- 3.4 Exkurs: Sprache und Kommunikation im Kunstunterricht und der Portfolioarbeit – Busses methodisches Skript des Mitteilens
- 4. Philosophische Fundierung der schulischen Portfolioarbeit
- 4.1 Konstruktivismus
- 4.2 Die Bedeutung von Reflexion in erkenntnistheoretischen Ansätzen
- 5. Kunstgeschichtliche und künstlerische Fundierung der schulischen Portfolioarbeit
- 5.1 Skizzenbuchgeschichte(n) – Das Portfolio als Skizzenbuch?
- 5.2 Künstlerische Fundierung - Das Buch und der Atlas als Kunstobjekt
- 5.2.1 Künstlerbücher
- 5.2.2 Atlas Warburg und Richter
- 5.2.3 Das schulische Portfolio als Kunstobjekt
- 6. Kunstdidaktische Fundierung der schulischen Portfolioarbeit
- 6.1 Die Otto-Selle-Debatte
- 6.2 Busse - Kunstunterricht zwischen Spielraum und Festlegung
- 6.3 Der Atlas und das Mapping als kunstdidaktische Handlungsapparate
- 6.4 Ästhetische Forschung
- 6.5 Das Portfolio als kunstdidaktisches Instrument
- 7. Exkurs: Bezugsfeld Alltag – Sammeln und ästhetische Biografie
- 7.1 Schülerindividualität bei alltagsästhetischen Erkundungen
- 7.2 Dinge sammeln
- 7.3 Das Portfolio als Sammlung
- 8. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der wissenschaftlichen Fundierung der Portfoliomethode im Kunstunterricht der Sekundarstufe I. Die Arbeit untersucht die didaktische Wirksamkeit des Portfolios und analysiert seine Anwendbarkeit in einem kompetenzorientierten Unterricht. Die Arbeit strebt an, ein umfassendes Verständnis des Portfolios als didaktisches Instrument zu vermitteln, indem sie verschiedene Wissenschaftsbereiche miteinbezieht und die Relevanz des Portfolios für den Kunstunterricht unterstreicht.
- Das Portfolio als didaktisches Instrument im Kunstunterricht
- Wissenschaftliche Fundierung der Portfoliomethode
- Kompetenzorientierter Unterricht und die Rolle des Portfolios
- Künstlerische, kunstgeschichtliche und philosophische Perspektiven auf das Portfolio
- Der Bezug des Portfolios zum Alltag und die Förderung von Schülerindividualität
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Portfoliomethode und ihre Bedeutung für den Kunstunterricht vor. Sie beleuchtet den Ursprung des Portfolios, die Verbindung zum analogen Sammeln und Dokumentieren im Alltag und die Entwicklung der Methode in der Schulpraxis.
- Das zweite Kapitel beleuchtet den Begriff des Portfolios und seine Vielschichtigkeit. Es werden Ursprünge, verschiedene Definitionen und Einsatzgebiete aufgezeigt, um das Portfolio im schulischen Kontext einzuordnen.
- Kapitel drei beleuchtet die curricularen Anforderungen des Faches Kunst in der Sekundarstufe I. Es werden die Ziele des Kunstunterrichts, Kompetenzbereiche und Inhalte sowie die Leistungsbewertung näher betrachtet.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit der philosophischen Fundierung der Portfolioarbeit. Der Konstruktivismus und die Bedeutung von Reflexion werden in diesem Kontext beleuchtet.
- Das fünfte Kapitel setzt sich mit der kunstgeschichtlichen und künstlerischen Fundierung der Portfolioarbeit auseinander. Hierbei werden die Verbindung zum Skizzenbuch, der Atlas Warburg und das Portfolio als Kunstobjekt untersucht.
- Kapitel sechs verortet das Portfolio im Bereich der Kunstdidaktik. Verschiedene Ansätze zur Integration des Portfolios im Kunstunterricht werden beleuchtet.
- Der siebte Kapitel beleuchtet den Bezugsfeld Alltag und die Rolle des Sammelns in der ästhetischen Biografie.
Schlüsselwörter
Portfolio, Kunstunterricht, Sekundarstufe I, Kompetenzorientierter Unterricht, Didaktik, Konstruktivismus, Reflexion, Kunstgeschichte, Skizzenbuch, Atlas, Ästhetische Forschung, Sammeln, Alltag, Schülerindividualität.
Details
- Titel
- Die Portfoliomethode für den Kunstunterricht der Sekundarstufe I. Wissenschaftliche Fundierung auf philosophischer, kunstgeschichtlicher und künstlerischer Ebene
- Hochschule
- Technische Universität Dortmund (Institut für Kunst und Materielle Kultur)
- Note
- 1.1
- Autor
- Mareen Illiges (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 52
- Katalognummer
- V1075125
- ISBN (eBook)
- 9783346480989
- ISBN (Buch)
- 9783346480996
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Bachelorarbeit entstand im Rahmen des Lehramtstudiums für Gymnasium und Gesamtschule im Fachbereich Kunstdidaktik. Sie wurde im Frühjahr 2021 verfasst und mit der Note 1.1 bewertet. In der Arbeit wird untersucht, inwiefern sich das didaktische Portfolio für den Kunstunterricht eignet und wie es sich hier auf philosophischer, kunstgeschichtlicher und künstlerischer Ebene wissenschaftlich fundieren lässt.
- Schlagworte
- Portfolio Portfoliomethode Kunstdidaktik Didaktik Kunstunterricht Wissenschaftliche Fundierung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 18,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Mareen Illiges (Autor:in), 2021, Die Portfoliomethode für den Kunstunterricht der Sekundarstufe I. Wissenschaftliche Fundierung auf philosophischer, kunstgeschichtlicher und künstlerischer Ebene, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1075125
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-