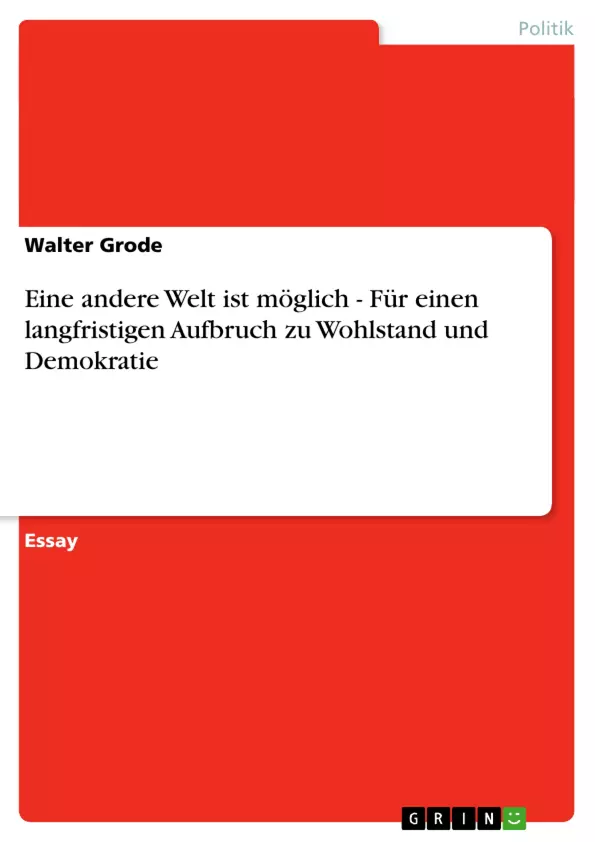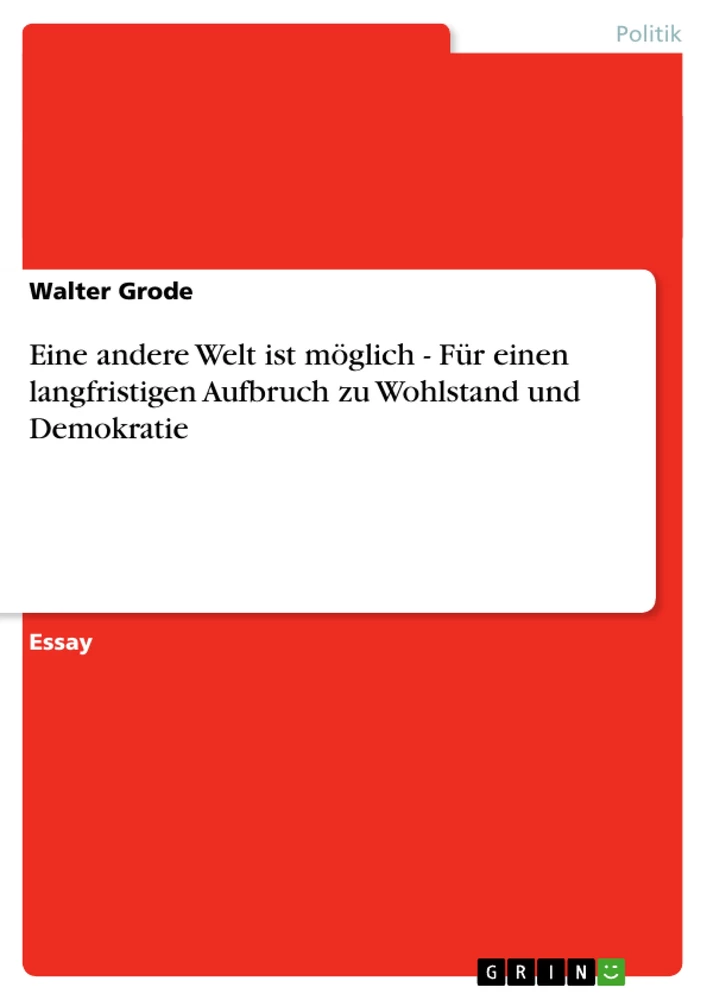
Eine andere Welt ist möglich - Für einen langfristigen Aufbruch zu Wohlstand und Demokratie
Essay, 2005
5 Seiten
Leseprobe
Walter Grode
>Eine andere Welt ist möglich<
Für einen langfristigen Aufbruch zu Wohlstand und Demokratie
In: Walter Grode: Aufsätze und Essays, Hannover 2005
Notiz: Ein auf "Arbeit und soziale Gerechtigkeit" beschränkter Abwehrkampf wird ebenso in Resignation versinken, wie die Protestaktionen für die "Rettung des Sozialstaats" und eine Humanisierung von Hartz IV. Notwendig und realistisch ist ein sehr sehr langer Atem - vergleichbar dem, am Beginn des sozialdemokratischen Jahrhunderts - für einen globalen Marshallplan, die solare Revolution und die Ablösung des konsumistischen Wohlstandsmodells. Denn die Aufklärung über die Zusammenhänge von Globalisierung und Klima, Kapitalismus und Depression, Wohlstandsmauern und Terroroismus hat eben erst begonnen.
>Wohlstand, europäische Lebensformen, Kultur und Demokratie sind nur zu verteidigen, wenn man die Dominanz der Großbanken und transnationalen Konzerne bricht, die Privatisierung staatlicher Leistungen rückgängig macht - und das ist nur noch auf europäischer Stufenleiter möglich.< (zit. nach Greffrath 2004, >Für einen Aufbruch<) Diese, unser neoliberales Denken radikal in Frage stellenden Worte fielen nicht etwa auf einem Attac-Kongress im studentischen Boheme-Millieu, sondern auf der Tagung "Wirtschaft und Vertrauen" im edlen Ambiente des brandenburgischen Schlosses von Neuhardenberg. Und derjenige, der sie im Herbst 2004 aussprach, war kein jugendlicher Rebell, sondern ein Christdemokrat und Konservativer im besten Fontane´schen Sinne: Es war Dietrich Hoppenstedt, der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes.
Vor ihm hatte auf derselben Tagung in Neuhardenberg bereits Hoppenstedts Parteifreund Friedrich Merz gesprochen und zum wiederholten Male das ebenso alternativlose wie furchterregende Szenario, der "Allparteienkoalition in Reichstag" zum Thema Wirtschaft und Globalisierung skizziert.
Ganz hinten auf der Weltkarte drohen Vietnam und China, mit "Arbeit billig wie Dreck" (Horst Afheldt), weiter vorn liefert Indien qualifizierte Arbeit zu Niedriglöhnen; davor saugt Osteuropa nicht nur Zulieferer von Autoteilen und Hersteller von Weihnachtsengeln an. .(vgl. Grode 1996 >Billig, wie eine leere Cola-Dose<). Und ganz vorn auf Merz' Weltkarte, stehen im Westen, auf verlierendem Posten: Wir. Die wir schon seit geraumer Zeit über unsere Verhältnisse gelebt haben.
Als uneinsichtiges Wahlvolk aber beharren wir weiterhin auf viel zu hohen Löhnen und Renten und wollen einfach die 6,5 Cent Stundenlohn in Saigon nicht sehen, mit dem kein 1 Euro-Job mithalten kann (vgl. Hein 2004 >Dritte Welt überall<). Statt dessen verabschieden wir uns in politische Apathie oder Schwarzarbeit und drohen linken Populisten und, wenn es ganz schlimm kommt, rechen Rattenfängern auf den Leim zu gehen.
Denn wir Wahlbürger spüren instinktiv, was kritische Wirtschaftswissenschaftler seit langem analysieren: Niedriglöhne, Flexibilisierung, Aufweichung und Beseitigung des Kündigungsschutzes, kurz "die Reformpoltik" der Regierung, ob Schröder/Fischer oder Merkel/Westerwelle, wird unter dem Strich keinen einzigen neuen Arbeitsplatz schaffen. Beim Handwerk/Mittelstand mag der eine oder andere Arbeitssuchende zusätzlich eingestellt werden, der eine oder an der frisch Ausgebildete mag zusätzlich mangels Anstellung den Sprung ins Ungewisse der Selbständigkeit wagen, dieser (temporäre) Gewinn wird aber überkompensiert durch den Abbau bei den Großen. Der Trend ist vorgegeben durch den technischen Fortschritt, und dessen Form wiederum durch das Wirtschaftssystem, in dem er sich vollzieht: den Kapitalismus.
Bezeichnend für das Niveau unserer gesellschaftlichen Debatte ist, daß sich kein Politiker und kein "führender" Ökonom, und natürlich auch kein Topmanager, diesem Problem stellt: daß aus technischen Gründen, aus Gründen der explosiv gestiegenen und weiter steigenden Arbeitsproduktivität überhaupt nicht genügend Arbeitsplätze vorhanden sind, also unmöglich jeder Mensch erwerbstätig sein kann - solange wir darauf beharren, die vorhandene Arbeit nach neoliberalen Marktgesetzen zu verteilen Und so lange wir zunehmend nur solche Güter und Dienste produzieren, für die es einen privaten "freien" Markt gibt." (Schüngel 2004, >Die Reform des Sozialsystems<)
Auf der einen Seite also eine große Koalition neoliberaler "Realisten" in Parlament und Vorständen - allesamt in der Verantwortung und deshalb von Tag zu Tag durch Sachzwänge erpressbar. Und auf der anderen Seite eine schweigende Mehrheit. Sie schweigt resigniert, weil sie weiß oder spürt, eine andere Welt ist notwendig, könnte aber nur über "quasirevolutionäre Veränderungen" gebaut werden.
Und auch die "Wahlinitiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit", die jetzt neu die Parteifrage stellt, hat weniger Zulauf, als der Frust hergebe, weil sie vor dieser Erkenntnis zurückschreckt. Diejenigen, die vor einer Parteigründung warnen, sagen: "Solange in diesem Land eine Mehrheit immer noch glaubt, dass Lohnverzicht das Wachstum belebt, Steuersenkungen zu Investitutionen führen und eine niedrige Staatsquote im Interesse der großen Mehrheit der Menschen ist, haben neue Parteien keinen Sinn" Die politischen Strategen warnen vor Experimenten unterhalb der Fünfprozentklausel, weil sie etwa in Nordrhein-Westfalen die SPD in die Opposition schicken könnten.
Angesichts der "Kleinstdifferenzen in der liberalen Allparteienkoalition" ist das altes Denken. Die Möglichkeiten des Protests sind weitgehend erschöpft, die soziale Bewegung braucht eine parlamentarische Vertretung: damit sie gezwungen wird, eine Alternative auszuarbeiten und zu vertreten, die der Radikalität ihrer ökonomischen und ökologischen Analysen entspricht. Denn genau da liegt die Gefahr einer Parteigründung: nicht, dass sie zu früh kommt, sondern dass sie zu kurz springt - und intellektuell und emotional unattraktiv bleibt. Das sie einen "Sozialstaat" retten will, der so nicht zu retten ist.
Die Situation ähnelt der Lage vor der Gründung der Grünen Partei Anfang der Achzigerjahre. Getragen wurde deren Erfolg von einer radikalen Analyse der apokalyptisch wahrgenommenen neuen Gefahren für Natur, Klima, Gesundheit und von Forderungen, die dieser Analyse an Radikalität entsprachen: die Grünen wurden attraktiv für Medien und Mittelschichtswähler, weil sie Mut zu einem kulturrevolutionären Gesellschaftsentwurf hatten.
Und heute? Die Polarisierung des Reichtums auf globalen und nationalen Märkten ruft nach einer Deglobalisierung der Wirtschaft (vgl. Grode 2004, >Soziale Gerechtigkeit<) und einer Internationalisierung des Steuersystems, die fortbestehende ökologische Bedrohung, nach gewaltigen öffentlichen Investitutionen in Energie und Verkehrssysteme, die Computerrevolution und die technologische Arbeitslosigkeit erfordern eine radikale Arbeitszeitverkürzung und eine Kultur von gemeinwohlorientierter und Eigen-Arbeit (vgl.Grode/Grode 2000, >Das Ende der Arbeitsgesellschaft<), die Flexibilisierung der Arbeit, die Umstellung Sozialsysteme und eine Erziehung, die nicht nur Qualifikationen vermittelt, sondern die Vorstellungen vom guten Leben und den Konsum entkoppelt. (vgl. Grode 2003, >Glücklich altwerden<) und die Dominanz des amerikanischen Imperiums macht zwingend eine europäische Gegenmacht, einen "europaen way of live" erforderlich - das aber heißt: Reichtumsausgleich im neuen Europa, eine kluge Rüstungsanstrengung und verstärkte Hilfe für die armen Länder.
Alles dieses kann gut begründet werden, wird aber, wie es dem ehemaligen CDU-Generalsekretär im Anschluß an seine Philippika gegen den Turbokapitalismus vorschwebt (Geißler 2004, >Wo bleibt Euer Aufschrei?<), mitnichten zur guten alten sozialen Marktwirtschaft zurückführen. Sondern mutet den Unterschichten und dem stöhnenden Mittelstand eher einiges mehr zu an kultureller Neudefinition dessen, was wir als Reichtum verstehen, an langfristiger politischer Verpflichtung.
Eine neue Partei habe, so heißt es in den Papieren der "Wahlalternative", eine "lange, lange" Strecke vor sich. Die Strecke ist mit Sicherheit noch länger, wen es nicht (nur) um die "Rettung des Sozialstaats" und eine Humanisierung von Hartz IV geht, sondern um einen globalen Marshallplan, um die solare Revolution und die Ablösung des konsumistischen Wohlstandsmodells. Aber der Stand der Aufklärung über die Zusammenhänge von Globalisierung und Klima, Kapitalismus und Depression, Wohlstandsmauern und Terroroismus hat eben denkenden Teil der Bevölkerung bereits so sehr imprägniert, daß man, so Greffrath (2004), nicht weniger fordern darf als einen Aufbruch. >Der Rest ist Poltik und die ist Verschleiß<: "Die immer selben Wellen brandeten gegen das immer gleiche Gestade der Oligarchen" - so schrieb es Robert Michels vor hundert Jahren in seine Parteientheorie zu Beginn des sozialdemokratischen Jahrhunderts<.
LITERATUR
Geißler, Heiner (2004): >Wo bleibt Euer Aufschrei?< In der globalen Wirtschaft herrscht pure Anarchie, in: >Die Zeit, Nr. 47.
Greffrath, Mathias (2004): >Es muß ein Aufbruch sein<, in die taz vom 24. November.
Grode, Gertrud/ Grode, Walter (2000) >Das Ende der Arbeitsgesellschaft<. Benötigen wir mehr oder weniger Beschleunigung?, in : >Lutherische Monatshefte<. Kirche im Dialog mit Kultur, Wissenschaft und Politik, Heft 9 www.wisswn24.de/vorschau/17563.html
Grode, Walter (1996): >Billig wie eine leere Cola-Dose<. Falsche Dogmen vom freien Welthandel, in: >Lutherische Monatshefte<. Kirche im Dialog mit Kultur, Wissenschaft und Politik, Heft 6 Demnächst in: www.wissen24.de
Grode, Walter (2003): >Glücklich altwerden<. Altern zwischen Defekt und Weisheit www.wissen24.de/vorschau/18617.html
Grode, Walter (2004) >Soziale Gerechtigkeit unter den Bedingungen turbokapitalistischer Globalisierung< www.wissen24.de/vorschau/2844.html
Hein, Christoph (2004): >Dritte Welt überall< Ostdeutschland als Avangarde der Globalsierung, in: >Die Zeit, Nr. 47.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Eine andere Welt ist möglich" von Walter Grode?
Der Text argumentiert, dass ein reiner Abwehrkampf, der sich auf "Arbeit und soziale Gerechtigkeit" beschränkt, ebenso wenig Erfolg haben wird wie Protestaktionen für die "Rettung des Sozialstaats" oder eine Humanisierung von Hartz IV. Notwendig sei ein sehr langer Atem für einen globalen Marshallplan, die solare Revolution und die Ablösung des konsumistischen Wohlstandsmodells, da die Aufklärung über die Zusammenhänge von Globalisierung, Klima, Kapitalismus, Depression und Terrorismus erst begonnen habe.
Was kritisiert der Text an der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation?
Der Text kritisiert die Dominanz der Großbanken und transnationalen Konzerne, die Privatisierung staatlicher Leistungen und die vorherrschende neoliberale Denkweise. Er bemängelt, dass trotz der kritischen Analysen von Wirtschaftswissenschaftlern die Regierungspolitik (ob Schröder/Fischer oder Merkel/Westerwelle) unter dem Strich keine neuen Arbeitsplätze schaffen wird, sondern der Trend durch den technischen Fortschritt und das Wirtschaftssystem (Kapitalismus) vorgegeben ist.
Welche Alternativen werden in dem Text vorgeschlagen?
Der Text fordert einen globalen Marshallplan, die solare Revolution und die Ablösung des konsumistischen Wohlstandsmodells. Er schlägt eine Deglobalisierung der Wirtschaft, eine Internationalisierung des Steuersystems, gewaltige öffentliche Investitionen in Energie- und Verkehrssysteme, eine radikale Arbeitszeitverkürzung und eine Kultur von gemeinwohlorientierter Arbeit vor. Des Weiteren wird eine europäische Gegenmacht zum amerikanischen Imperium gefordert.
Was wird über die "Wahlinitiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit" gesagt?
Der Text argumentiert, dass die "Wahlinitiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit" weniger Zulauf habe, als der Frust eigentlich hergebe, weil sie vor den notwendigen "quasirevolutionären Veränderungen" zurückschrecke. Der Text plädiert für eine parlamentarische Vertretung, die eine Alternative ausarbeitet und vertritt, die der Radikalität ihrer ökonomischen und ökologischen Analysen entspricht.
Was wird in Bezug auf die Gründung der Grünen Partei gesagt?
Der Text zieht eine Parallele zur Gründung der Grünen Partei in den 1980er Jahren, deren Erfolg auf einer radikalen Analyse der Gefahren für Natur, Klima und Gesundheit beruhte. Die Grünen wurden attraktiv, weil sie Mut zu einem kulturrevolutionären Gesellschaftsentwurf hatten. Der Text impliziert, dass eine neue Partei ähnlich mutige und radikale Forderungen aufstellen muss, um erfolgreich zu sein.
Welche Autoren und Werke werden im Text zitiert oder erwähnt?
Der Text zitiert oder erwähnt unter anderem Dietrich Hoppenstedt, Friedrich Merz, Horst Afheldt, Christoph Hein, Bernd Schüngel, Heiner Geißler, Mathias Greffrath, Gertrud und Walter Grode sowie Robert Michels. Es werden auch verschiedene Artikel und Essays der genannten Autoren aufgeführt.
Details
- Titel
- Eine andere Welt ist möglich - Für einen langfristigen Aufbruch zu Wohlstand und Demokratie
- Autor
- Dr. phil. Walter Grode (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 5
- Katalognummer
- V109436
- ISBN (eBook)
- 9783640076178
- Dateigröße
- 338 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Eine Welt Aufbruch Wohlstand Demokratie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Walter Grode (Autor:in), 2005, Eine andere Welt ist möglich - Für einen langfristigen Aufbruch zu Wohlstand und Demokratie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/109436
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-