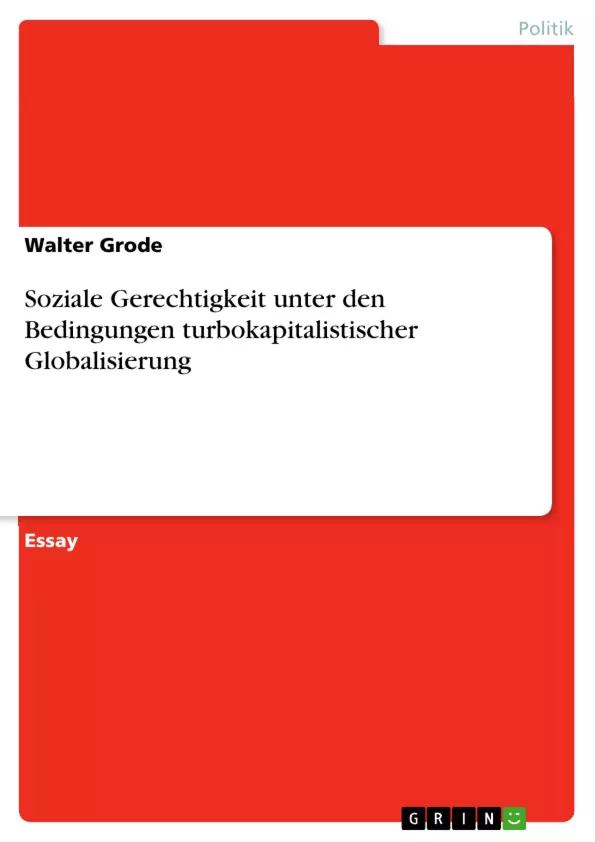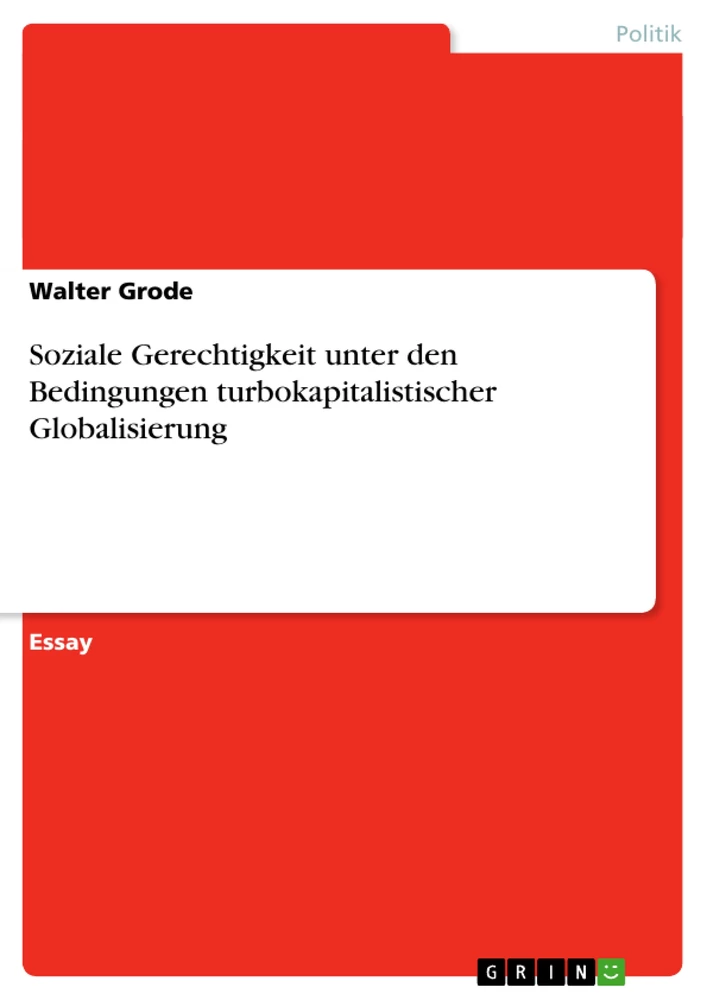
Soziale Gerechtigkeit unter den Bedingungen turbokapitalistischer Globalisierung
Essay, 2004
4 Seiten
Leseprobe
Walter Grode
Soziale Gerechtigkeit unter den Bedingungen turbokapitalistischer Globalisierung
In: Walter Grode, Aufsätze und Essays, Rezensionen und Kommentare, Hannover 2004
Notiz: "Aufstehen für soziale Gerechtigkeit" lautet der gemeinsame Nenner, unter dem 2004 Hunderttausende in ganz Europa gegen die Politik ihrer eigenen Regierungen demonstrierten. Doch diese sind nur bedingt der richtige Adressat. Denn selbst die Neoliberalsten unter ihnen, wie die in Bratislava oder Rom, sind nur die willigen Spielbälle der sozialen Ungerechtigkeit, die keine größere Angst kennen, als vom Sturm des Turbokapitalismus ins Aus befördert zu werden. Soziale Gerechtigkeit wird unter den Bedingungen kapitalistischer Globalisierung, wie es scheint, zur einer vernachlässigbaren Restgröße.
Natürlich, so Erhard Eppler (2004), ist es ungerecht,, wenn ein Manager das 200fache eines Facharbeiters, das Vierzigfache eines Bundesministers verdient. Natürlich ist es obzön, wenn ein gescheiterter Manager als Abfindung eine Summe bekommt, von deren Zinsen er sich ein halbes Dutzend Bundeskanzler halten könnte.
Ist es etwa gerecht, daß ein Wirtschaftsboß erfolgreich ist, wenn er den Shareholder-Value durch tausend Entlassungen steigert, während ein Kanzler erfolgreich sein soll, indem er die Arbeitslosigkeit beseitigt? Ist es gerecht, wenn die Bahn ihre Schalter schließt, Personal entläßt, während ältere Bahnkunden hilflos vor komplizierten und oft auch defekten Automaten stehen?
Ist es gerecht, wenn Konzerne durch Zukauf verlustträchtiger Unternehmen nicht nur der Körperschaftssteuer entgehen, sondern auch ganze Städte in den Ruin treiben können, weil sie keine Gewerbesteuer mehr zahlen? Ist es gerecht, wenn in einer Zeit, in der immer größere Vermögen an immer weniger Erben fallen, eine neue Schicht von Menschen entsteht, die mit der Verwaltung und Nutzung des Ererbten voll ausgelastet ist?
Manche Politiker, darunter auch (einige Grüne und viele) Sozialdemokraten meinen einen Ausweg darin zu finden, daß sie definieren: "Gerecht ist, was Arbeitsplätze schafft!". Das wäre wohl gar nicht so falsch, wenn klar wäre, was das ist. Wenn heute noch, wie vor dreißig Jahren, in der Wirtschaft die Devise gälte, große Umsätze bei kleinen Gewinnen seien akzeptabel, ja erwünscht, so würde dies Arbeitsplätze schaffen. Aber kein Minister kann dies dekretieren, kein Parlament es erzwingen.
"Steuersenkungen schaffen Arbeitsplätze" gilt heute als Gemeinplatz. Wer aber addiert die Stellenstreichungen in den Kommunen, bei Bibliotheken, Schwimmbädern, Theatern, Stadtgärtnereien, die durch Steuersenkungen nötig wurden? Wer zwingt die Leute, wenn sie mehr Geld in der Tasche haben, mehr einzukaufen? Und vor allem, wer zwingt Unternehmer, Steuerersparnisse zu investieren?
Seit beinahe 30 Jahren nähern wir uns immer rascher dem Ende der Arbeitsgesellschaft (Grode/Grode 2000). Und seit 30 Jahren haben wir am Ende eines jeden Konjunkturzyklus mehr Arbeitslose. Wer regiert ist dabei unerheblich. Dabei bestätigt sich immer deutlicher die These, die Horst Afheldt vor mehr als zwanzig Jahren aufgestellt hat: Wachstum verläuft immer linear, nicht exponentiell, das heißt, je größer das Sozialprodukt, desto geringer werden die prozentualen Wachstumsraten. Damit mehr Arbeitsplätze entstehen als vernichtet werden, braucht es aber beinahe drei Prozent.
Als vor 20 Jahren über die Zukunft der Arbeit diskutiert wurde, folgte man einem - inzwischen vergessenen - politischen Ansatz: Wo braucht diese Gesellschaft noch zusätzliche Arbeit, um die Bedingungen für Lebensqualität zu steigern? >Innehalten und Schauen< hieß die Devise (Beckmann / Grode 1997) Dabei verwiesen viele auf Kultur, Bildung, Medien, Kinderbetreuung, Gesundheitswesen, ökologische Landwirtschaft, Landschaftspflege. Dann wurde gefragt, wie sich dies finanzieren lasse, privat und öffentlich.
Heute erwarten wir Wunder von Wachstumsraten, ohne zu fragen, wo denn die neuen Arbeitsplätze entstehen sollen - wenn nicht nur die Industrie, sondern auch die klassischen Dienstleistungen wie Banken, Handel, Bahn und Post mit immer weniger Menschen auskommen auskommen wollen (Grode/Grode 2000)
Kein Finanzminister kann einfach aussteigen aus dem Wettbewerb um die niiedrigsten Unternehmenssteuern, zu dem das global agierende Kapital die National- (und damit auch die Sozialstaaten)gezwungen hat. Heute berechnen Experten im Finanzministerium, was ein >konkurrenzfähigerc Spitzensteuersatz wäre. Gemeint ist ein Satz, der nicht zur Kapitalflucht führt. Kapital kann schließlich auswandern in Billiglohnländer (Grode 1996), Arbeiter können das nicht.
Auch hier, wie bei den Managervergütungen sind die Schamgrenzen gefallen. Interessenvertreter der Industrie rufen zu Investitionen in Osteuropa auf, weil die amtierende Regierung nicht alle ihre Wünsche erfüllt. Die Bosse, die im Staat nur ein Hindernis für Märkte sehen, haben das beste Gewissen, wenn sie den Staat - und mit ihm die auf Sozialtranfers angewiesenen Menschen - aushungern. Im Duell zwischen globalem Kapital und nationalem Staat gibt es, wie Erhard Eppler feststellt, keine Waffengleichheit: Hat die eine Seite eine Kalaschnikow, so droht die andere mit einem Brieföffner. Damit kann man theoretisch auch Menschen töten. Aber wer Regierungen auffordert, mit dem Brieföffner gegen die Kalaschnikow anzugehen, rät zum Selbstmord. Verweigerung und Verlagerung von Investitionen mit der Folge steigender Arbeitslosigkeit sind eine wirksamere Waffe als Steuern, denen man sich allzu leicht entziehen kann.
Der Verteilungsgerechtigkeit, die die Neoliberalen seit jeher zur Ursache allen Übels erklärt haben, sind daher momentan enge Grenzen gesetzt. Rot-Grün versucht innerhalb dieser Grenzen die Lasten gerecht zu verteilen. Das ist notwendig unbefriedigend, ganz abgesehen davon, daß die schmerzhafte Umverteilung zwischen den Alten und den Jungen von der Globalisierung der Kapitalströme unabhängig ist. Doch mittelfristig gibt es durchaus Hoffnung: Das größere Europa könnte ein Wirtschaftsraum werden, in dem nicht nur der berechtigte Protest, sondern auch die Politik wieder eine Chance bekommt,.
Die Wiederkehr des Politischen
Seit geraumer Zeit erscheinen uns die europäischen Sozialstaaten der achziger Jahre und der Gedanke an eine soziale Kultur des Zusammenlebens wie eine schöne, jedoch naive Erinnerung (Grode 1996). Denn die Welt der Wirtschaft und die des Sozialen entwickeln sich mit wachsender Geschwindigkeit immer weiter auseinander, und der Staat, der beide Welten durch Regulierung und nicht, wie uns heute suggeriert wird, durch De-regulierung zusammenhielt und damit beiden diente, kann dies heute nicht mehr.
Es mag ja sein, daß diese Entwicklung tatsächlich unvermeidlich und daher nicht mehr aufzuhalten ist und eine Gesellschaft, die sich am Abbau sozialer Ungleichheit als schöne Utopie erscheint. Was jedoch momentan geschieht ist mehr als der Abschied von Visionen. Es ist das ängstliche Zurückweichen des Politischen, des Rechtlichen und des Moralischen vor den Kräften des Marktes.
Denn Moral, die über individuelle Beziehungen hinausreichen soll, kann - gegen arbeitsteilige Prozesse und ihre Resultate - nur als Recht verwirklicht werden. Der Kampf um Recht aber ist Politik.
Der Markt jedoch setzt sich soziale Ziele oder das Ziel der Erhaltung der Umwelt nicht von selbst. Solche marktfremden Kriterien müssen ihm von außen, also politisch vorgegeben werden. Damit aber der Markt auch auf diese Ziele hinarbeiten kann, müssen sie für alle Marktteilnehmer gleichmäßig gelten. Nur wenn das sichergestellt ist, kann der einzelne Unternehmer zum Beispiel Umweltschutzkosten oder Behinderungen aus sozialen oder kulturellen Gründen wie das Verbot der Sonntagsarbeit akzeptieren, ohne im Konkurrenzkampf zu unterliegen.
Das bedeutet aber: Die politische Macht, die dem Markt die Ziele setzt, muß ebenso weit reichen wie der Markt selbst. Wird der Markt weltweit, kann deshalb nur eine Weltregierung ökologischer und sozialer Regulator des Marktes sein. Eine Weltregierung von 150 bis 200 Staaten völlig unterschiedlicher Interessen ist jedoch eine Illusion. Die meisten Nationalstaaten andererseits sind heute für diese Regulator-Rolle längst zu klein geworden.
Wie in Frankreich sollten wir deshalb auch in der Bundesrepublik diskutieren, ob nicht große Wirtschaftsräume wie zum Beispiel Europa als selbständige Märkte behandelt werden müßten, für die eine politische Instanz der Wirtschaft die sozialen und ökologischen Ziele vorgibt. Zu einer solchen Politik der Großregionen gehören auch Regelungen des Marktzugangs für Importe von außerhalb, Schutzzölle sowohl gegen soziales wie ökologisches Dumping. Denn generationen- und gruppenübergreifend haben alle Bürger - die Mobilen und die Seßhaften, die Beweglichen und die Beschränkten - ein gemeinsames Interesse daran, daß der entfesselte Weltmarkt den "European Way of Life" nicht schleift. Grundlage dieses kulturellen Gefüges ist ein spezifisch europäisches Denken, das vom Spannungsverhältnis von individueller Freiheit und gesellschaftlicher Gleichheit lebt. Autoritäre "Lösungen" dieses Widerspruchs führen speziell für soziale Minderheiten unweigerlich in die Katastrophe. (Grode 1994)
Beckmann, Jörgen / Grode, Walter (1997), >Wanderer, wähle Deinen Weg<. Die Gärten von Wörlitz: Innehalten und Schauen, in: >Lutherische Monatshefte<. Kirche im Dialog mit Kultur, Wissenschaft und Politik, Heft 10.
www.wissen24.de/vorschau/21466.html
Eppler, Erhard, (2004), >Wiederkehr der Politik<. Wenn linke Sozialdemokraten sagen, in dieser Republik gehe es ungerecht zu, so haben sie Recht. Aber trotz Turbokapitalismus und Globalisierung besteht Anlass zur Hoffnung, in: die taz, 1. April 2004.
Grode, Walter (1994), Die NS-Sozialpoltik und der Genozid, in: >Nationalsozialistische Moderne<. Rassenideologische Modernisierung durch Abtrennung und Zerstörung gesellschaftlicher Peripherien, Frankfurt a.M.
www.wissen24.de/vorschau/19271.html
Grode, Walter (1996), >Billig wie eine leere Cola-Dose<. Falsche Dogmen vom freien Welthandel, in: >Lutherische Monatshefte<. Kirche im Dialog mit Kultur, Wissenschaft und Politik, Heft 6.
Grode, Gertrud / Grode, Walter (2000), >Das Ende der Arbeitsgesellschaft<. Benötigen wir mehr oder weniger Beschleunigung?, in: >Die Zeichen der Zeit / Lutherische Monatshefte<, Heft 9
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Walter Grodes "Soziale Gerechtigkeit unter den Bedingungen turbokapitalistischer Globalisierung"?
Der Aufsatz behandelt die Frage der sozialen Gerechtigkeit in einer Welt, die von turbokapitalistischer Globalisierung geprägt ist. Er argumentiert, dass soziale Gerechtigkeit unter diesen Bedingungen zu einer vernachlässigbaren Größe wird, da Nationalstaaten durch global agierendes Kapital in einen Wettbewerb um niedrige Unternehmenssteuern gezwungen werden.
Welche Kritik übt Grode an der aktuellen Wirtschaftspolitik?
Grode kritisiert, dass Politiker oft fälschlicherweise glauben, "Gerecht ist, was Arbeitsplätze schafft!", ohne zu definieren, was das genau bedeutet. Er argumentiert, dass Steuersenkungen, die angeblich Arbeitsplätze schaffen, oft zu Stellenstreichungen in öffentlichen Einrichtungen führen. Er bemängelt auch, dass Unternehmen durch Zukäufe verlustträchtiger Unternehmen Steuern vermeiden und ganze Städte in den Ruin treiben können.
Was sagt Grode über das Ende der Arbeitsgesellschaft?
Grode verweist auf die These von Horst Afheldt, dass Wachstum immer linear, nicht exponentiell verläuft, was bedeutet, dass mit zunehmendem Sozialprodukt die prozentualen Wachstumsraten sinken. Er argumentiert, dass dies dazu führt, dass am Ende jedes Konjunkturzyklus mehr Arbeitslose vorhanden sind, unabhängig von der regierenden Partei.
Welche Lösungsansätze schlägt Grode vor?
Grode erinnert an einen früheren politischen Ansatz, bei dem gefragt wurde, wo die Gesellschaft noch zusätzliche Arbeit benötigt, um die Lebensqualität zu steigern (z.B. in Kultur, Bildung, Gesundheitswesen). Er kritisiert, dass heute Wunder von Wachstumsraten erwartet werden, ohne zu fragen, wo die neuen Arbeitsplätze entstehen sollen. Er schlägt vor, dass große Wirtschaftsräume wie Europa als selbständige Märkte behandelt werden sollten, für die eine politische Instanz der Wirtschaft soziale und ökologische Ziele vorgibt.
Was versteht Grode unter der "Wiederkehr des Politischen"?
Grode argumentiert, dass sich die Welt der Wirtschaft und die des Sozialen immer weiter auseinanderentwickeln und der Staat, der beide Welten durch Regulierung zusammenhielt, dies heute nicht mehr kann. Er sieht ein ängstliches Zurückweichen des Politischen, des Rechtlichen und des Moralischen vor den Kräften des Marktes. Er betont, dass soziale Ziele und Umweltschutz dem Markt von außen, also politisch, vorgegeben werden müssen.
Welche Rolle spielt der "European Way of Life" in Grodes Argumentation?
Grode betont, dass alle Bürger ein gemeinsames Interesse daran haben, dass der entfesselte Weltmarkt den "European Way of Life" nicht schleift. Grundlage dieses kulturellen Gefüges ist ein spezifisch europäisches Denken, das vom Spannungsverhältnis von individueller Freiheit und gesellschaftlicher Gleichheit lebt.
Details
- Titel
- Soziale Gerechtigkeit unter den Bedingungen turbokapitalistischer Globalisierung
- Autor
- Dr. phil. Walter Grode (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 4
- Katalognummer
- V109442
- ISBN (eBook)
- 9783640076239
- Dateigröße
- 409 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Erschienen in: Walter Grode, Aufsätze und Essays, Rezensionen und Kommentare, Hannover 2004
- Schlagworte
- Soziale Gerechtigkeit Bedingungen Globalisierung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Walter Grode (Autor:in), 2004, Soziale Gerechtigkeit unter den Bedingungen turbokapitalistischer Globalisierung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/109442
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-