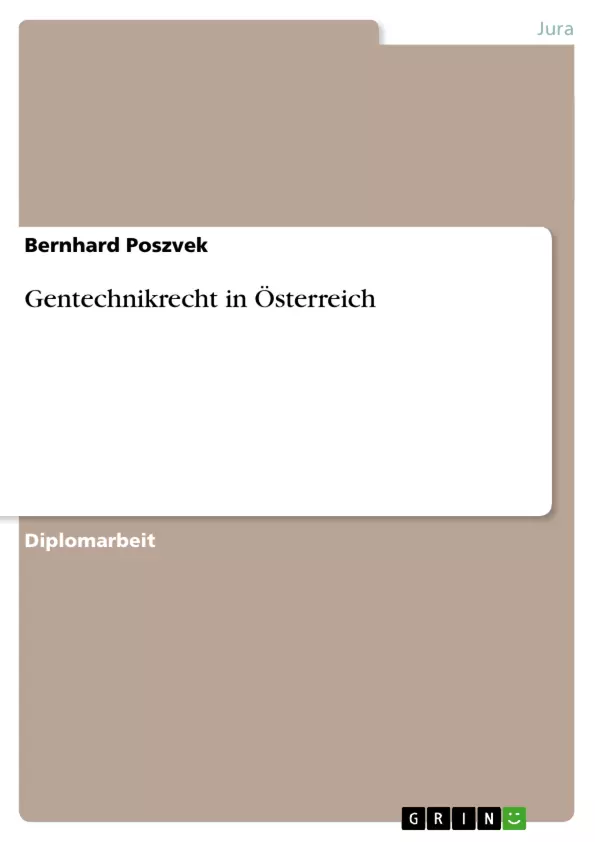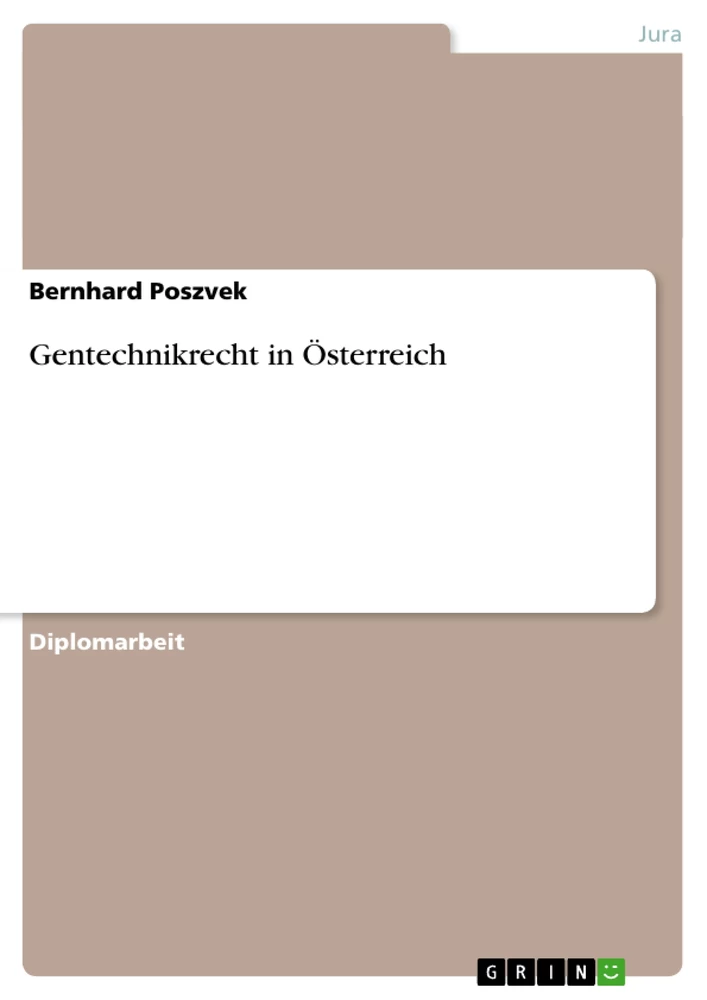
Gentechnikrecht in Österreich
Diplomarbeit, 1996
134 Seiten, Note: Sehr Gut
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
1. Kapitel – Einführung in die Biotechnologie
1.1 – Begriffsabgrenzung
1.2 – Geschichte der Biotechnologie
1.3 – Anwendung der Gentechnik
1.3.1 – Möglichkeiten der Gentechnik
1.3.2 – Wirtschaftliche Relevanz der Gentechnik
1.4 – Grundlagen der Biotechnologie
2. Kapitel – Grundzüge der Gentechnikregelung
2.1 – Entwicklung internationaler (unverbindlicher) Gentechnikregelungen
2.2 – Das österreichische Gentechnikgesetz (GTG)
2.2.1 – Geschichte des GTG
2.2.1.1 – Gesetzgebungskompetenz, Rechtssicherheit und Abwanderungsproblematik
2.2.2 – Aufbau des GTG
2.2.3 – Allgemeines (§§ 1-4 u 100 f)
2.2.3.1 – Geltungsbereich
2.2.3.2 – Ziele des GTG
2.2.3.3 – Grundsätze des GTG
2.2.3.4 – Vollziehungskompetenz
2.2.3.5 – Kontrollrechte der Behörde
2.2.3.6 – Stand der Technik
2.2.4 – Gentechnikkommission und wissenschaftliche Ausschüsse (§§ 80-99)
2.2.5 – Arbeiten mit GVO in geschlossenen Systemen (§§ 5-35)
2.2.5.1 – Pflichten des Betreibers einer gentechnischen Anlage
2.2.5.2 – Klassifizierungen im GTG
2.2.5.3 – Anmeldung und Genehmigung von gentechnischen Arbeiten
2.2.5.4 – Gentechnische Anlagen
2.2.6 – Genanalyse und Gentherapie am Menschen (§§ 64-79)
2.2.6.1 – Somatische Gentherapie
2.2.6.2 – Genanalyse
2.2.7 – Exkurs: Forschungsfreiheit und Grundrechte
3. Kapitel – Freisetzung und Inverkehrbringen von GVO
3.1 – Freisetzung von GVO (§§ 36-53)
3.1.1 – Geschichte der Freisetzung
3.1.2 – Exkurs: „Freisetzungsmoratorium“
3.1.3 – Gesetzliche Regelung der Freisetzung
3.1.3.1 – Genehmigungsverfahren
3.1.3.2 – Exkurs: Anhörung
3.1.3.3 – Stufenprinzip
3.1.3.4 – Pflichten des Antragstellers und späteren Betreibers
3.1.4 – Weitere Aspekte der Freisetzung
3.1.4.1 – Risikobeurteilung
3.1.4.2 – Überlebens- und Ausbreitungsverhalten
3.1.4.3 – Gentransfer
3.1.4.4 – Unterschiede zwischen Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren
3.1.5 – Zusammenfassung
3.2 – Inverkehrbringen von Erzeugnissen (§§ 54-63)
3.2.1 – Gesetzliche Regelung des Inverkehrbringens
3.2.1.1 – Genehmigungsverfahren
3.2.1.2 – Verpackung und Kennzeichnung
3.2.2 – Kennzeichnungsverordnungen
3.2.2.1 – Gentechnikkennzeichnungsverordnung
3.2.2.2 – Gentechnik-Erzeugnis-Kennzeichnungsverordnung
3.2.2.3 – „Novel-Food“-Regelung
3.2.2.4 – Zulassungs- versus Kennzeichnungsregime
3.2.3 – EU-Zulassungen 1996
4. Kapitel – Haftpflicht und Patentierung
4.1 – Haftpflicht
4.1.1 – Verschuldensabhängige Haftung
4.1.1.1 – Schutzgesetze
4.1.1.2 – Geschützte Rechtsgüter
4.1.2 – Gefährdungshaftung
4.1.2.1 – Produkthaftung
4.1.2.2 – Gesamtanalogie aus anderen Gefährdungshaftungsgesetzen
4.1.2.3 – Gefährdungshaftung für Anlagen
4.1.2.4 – Gefährdungshaftung im deutschen Gentechnikrecht
4.1.3 – Zivilrecht statt Ordnungsrecht?
4.1.4 – Resumee
4.2 – Patentierung
4.2.1 – Allgemeine Voraussetzungen
4.2.2 – Spezielle Voraussetzungen und Sittenklausel
4.2.3 – Volkswirtschaftlicher Nutzen der Patentierung
5. Kapitel – Kritik und Ausblick
5.1 – Kritik
5.2 – Ausblick
Verzeichnis der verwendeten Literatur
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einleitung
„Die Gentechnologie ist eine relativ junge wissenschaftliche Methode, die in ihren vielfältigen Anwendungen in zunehmender Geschwindigkeit unsere gesellschaftliche Entwicklung beeinflußt“ (Regierungsvorlage zum Gentechnikgesetz, Nachdruck vom 11. 3. 1994, p 41).
Spätestens seit dem Frühjahr 1996 beschäftigt sich die Öffentlichkeit mit dem Thema Gentechnologie. Bis dahin haben viele nichts davon gewußt oder nur Gerüchte über die Möglichkeiten der Gentechnologie gehört. Nun ist es aber klar, daß diese Möglichkeiten und auch die damit verbundenen Gefahren wirklich existieren, wenngleich die Entwicklung der Gentechnologie in Österreich im internationalen Vergleich noch in den Kinderschuhen steckt.
Diese Arbeit möchte die gesetzliche Regelung der Gentechnologie und den Einfluß bestimmter, allgemeiner Regelungen auf die Gentechnologie durchleuchten, und zwar zuerst allgemein und dann speziell in bezug auf Freisetzung und Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Organismen (GVO). Parallel zur rechtlichen Situation in Österreich werden laufend auf die europäische Rechtslage (System- und Freisetzungsrichtlinie) und die deutschen Gentechnikbestimmungen, insb das deutschen Gentechnikgesetz, das dem österreichischen GTG ganz offensichtlich als Vorbild diente, Bezug genommen und Vergleiche angestellt.
Dabei sollen auch Themenkomplexe wie zB Schadenersatz, Patentierung, Forschungsfreiheit und Kennzeichnung von Gentechnik-Produkten angesprochen werden, wobei aktuelle Entwicklungen eingearbeitet sind
Ein besonderes Anliegen ist die mehr oder weniger systematischen Darstellung der Materie, da seit den Gutachten der Vorbereitungsphase des Gentechnikgesetzes (GTG), insbesondere in den nun bald zwei Jahren seit seinem Inkrafttreten, keine umfassenden Arbeiten zum GTG veröffentlicht wurden. Auch diese Arbeit kann nicht alle Aspekte des GTG umfassen, soll aber einen ersten Einblick in die Wechselwirkungen zwischen Technik, Wirtschaft und Recht unter den nun gegebenen Rahmenbedingungen ermöglichen.
1. Kapitel – Einführung in die Biotechnologie
1.1 – Begriffsabgrenzung
Während Biotechnologie Einsatz wissenschaftlicher und technischer Prinzipien zur Herstellung und Bearbeitung von Stoffen durch lebende Organismen, um auf diese Weise Güter und Dienstleistungen bereitzustellen, bedeutet, ist mit Gentechnik, quasi als Teildisziplin der Biotechnologie, jenes Verfahren angesprochen, das zur Identifizierung, Isolierung, Vermehrung und Nutzung genetischen Materials dient. Während sich also die Gentechnik mit Vermehrung, Nutzung etc gentechnisch modifizierter Organismen beschäftigt, umfaßt die Biotechnologie die Nutzung von allen Organismen, also sowohl gentechnisch veränderten als auch konventionellen.
Etwas weiterreichend ist der Terminus Gentechnologie, der neben dem rein technischen Aspekt auch soziale, ethische wie ökonomische Fragestellungen einschließt. Trotz dieser ziemlich klaren Terminologie werden die Begriffe oft vertauscht: „Everyone has a slightly different definition of what biotechnology actually means“[1]. Auch in der Legistik sind die im großen und ganzen anerkannten Definitionen korrekt anzuwenden, um Verwirrungen vorzubeugen.
1.2 – Geschichte der Biotechnologie
Biotechnologische Verfahren wurden schon vor ca 5.000 Jahren angewandt, zB zur Herstellung von Bier oder Brot. Weiters wurden bereits im Altertum Essigsäure- und Milchsäurebakterien kultiviert, freilich ohne Wissen um die Bakterien. Deren Existenz wurde erst im 17. Jahrhundert von Antoni van Leeuwenhoek, dem Begründer der Mikrobiologie (Lehre von den Mikroben, den Mikroorganismen), nachgewiesen. 1857 bewies dann Louis Pasteur, daß an jeder Gärung gährungsspezifische Bakterien beteiligt sind und die Gärung somit nicht rein anorganischer Natur ist. Aus dieser Erkenntnis entwickelte sich die Biochemie, die Lehre von der chemischen Zusammensetzung der Lebewesen und von den chemischen Vorgängen in den Lebewesen. Ebenfalls im 19. Jahrhundert entdeckte Gregor Mendel grundlegende Gesetze der Vererbungslehre, deren Tragweite erst zur Jahrhundertwende erkannt wurde.
Auf diesen drei Wissenschaften, der Mikrobiologie, der Biochemie und der Genetik baut die Gentechnik auf.
1973 gelang es dann Cohen et al ein Plasmid gentechnisch zu manipulieren – die Geburt der angewandten Gentechnik.[2]
Heute bereits erreichte und noch geplante Anwendungsgebiete lassen sich unter den Schlagwörtern Bio-leaching (Erzlaugung durch Mikroorganismen), Antimatsch-Tomate, Onko-Maus und Aids-Heilung bloß auszugsweise zusammenfassen.
1.3 – Anwendung der Gentechnik
1.3.1 – Möglichkeiten der Gentechnik
Bereits im ersten Weltkrieg wurden mittels der Biotechnologie (Fermentierung) Glycerin für die Sprengstofferzeugung hergestellt. Bekanntes Beispiel für die Anwendung der Biotechnologie ist die Herstellung des Penicillin, das erstmals in den 40er Jahren aus dem Pilz Penicillium chrysogenum gewonnen wurde, der von Alexander Fleming ca zehn Jahre zuvor entdeckt worden war. Mit dem großen Anwendungsgebiet dieses Antibiotikums war auch eine beginnende wirtschaftliche Relevanz der Biotechnologie verbunden. Seit den vierziger Jahren ist die Produktivität der Penicillin-Stämme um den Faktor 1000 gestiegen.[3]
Vor allem in der Pharmazie und später auch in der Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung hat sich die Gentechnik mehr oder weniger weit etabliert. Auch der relativ neue Zweig der Umweltbiotechnolgie erlangte erst durch die Gentechnik Bedeutung. Im Bereich der Medizin wird die Anwendung der Gentechnik zum großen Teil noch vermieden oder gar verboten.
Bekannte Beispiele aus dem Pharmabereich sind das Humaninsulin und das Penicillin. Während letzteres nicht gentechnisch hergestellt wird, wird Humaninsulin als erstes gentechnisch herstellbares Medikament[4] mittels eines in das Genom von Mikroorganismen eingeschleusten Gens aus der menschlichen Bauchspeicheldrüse erzeugt. Die an dieses Verfahren gestellten Erwartungen sind jedoch bei weitem zu hoch gegriffen gewesen. Die Kosten sind nicht dramatisch gesunken, in manchen Fällen sind sie sogar gestiegen.[5] Dennoch ist zu erwähnen, daß Humaninsulin wesentlich reiner ist und in den meisten Fällen besser vertragen wird als tierisches. Den Nebenwirkungen von konventionell erzeugtem Insulin stehen andere Nebenwirkungen des Humaninsulins gegenüber.[6]
Als Beispiel aus der Landwirtschaft soll das Rinderwachstumshormon BST (Bovines Somatotropin) angeführt werden, das in Österreich von der Biochemie Gmbh im Auftrag der Firma Monsanto (USA) hergestellt wird.[7] Die Wirkung von BST, das in Österreich nicht zugelassen ist, ist vor allem eine Steigerung der Milchleistung von sog „Turbokühen“ um ca 10-20% (lt Befürwortern).[8]
Pflanzen können hitze- und dürretoleranter gestaltet werden (Stichwort „Wüstensoja“), herbizidresistent oder resistent gegen Insekten gemacht werden. Mikroorganismen können Luftstickstoff an Pflanzenwurzeln fixieren.[9] Pflanzen und Tiere können auch schwermetallresistent gemacht werden. Setzt man diese Organismen nun Umweltbedingungen aus, die eine höhere Schwermetallbelastung aufweisen, so nehmen sie allerdings auch mehr Schwermetalle auf, was die Nahrungskette stark beeinflussen kann.
Der Lebensmittelmarkt als Spielwiese der Gentechnik ist im Moment heiß umstritten. Neben der grundsätzlichen Frage nach dem Nutzen stellt sich vor allem jene nach den Langzeitfolgen von rekombinanten Organismen oder Teilen von rekombinanten Organismen, die mit der Nahrung aufgenommen werden.
Es kann direkt in der Landwirtschaft angesetzt werden und die Pflanze – zB Kakao – zB mit Süßstoffgenen versehen werden, es kann aber auch erst später im Prozeß eingegriffen werden. So gab es die „schnelle Bäckerhefe“ in Großbritannien, das Brot, das auch am fünften Tag wie frisch vom Bäcker schmeckt, in Dänemark und die Anti-Matsch-Tomate („FlavrSavr®“[10] ) in den USA.[11] So gibt es „Bio-Konsvervierung“ der Milch und das Joghurt entsteht erst im Becher aus der Milch und erhält zB Erdbeeraroma.
Auch auf dem Bereich der Umweltbiotechnologie ist die Gentechnik vertreten. Bisher wurden vor allem konventionelle Mikroorganismen zB zur biologischen Abwasserreinigung verwendet. Nach gentechnischen Eingriffen können Mikroorganismen verbreitet zur Abfallverwertung aus diversen Medien, zB auch zur Zerlegung von Ölrückständen im Wasser[12], aber auch zB zur Erzlaugung (Bioleaching)[13] eingesetzt werden.
In der Medizin konzentriert sich die Anwendung der Gentechnik auf die Genanalyse und die Gentherapie. Damit könnten Krankheiten vermieden resp geheilt oder zumindest behandelt werden.
Auch in der Kriminalistik kann die Gentechnik eingesetzt werden. So sind sog „genetische Fingerabdrücke“ (DNA-Fingerprinting) ein sehr sicheres aber dennoch umstrittenes Identifizierungsinstrument, das allerdings bei eineiigen Zwillingen versagt.[14]
Wie man sieht, sind der Anwendung der Gentechnik prinzipiell kaum Grenzen gesetzt. Jedoch stehen ihr in einigen Bereichen einerseits Sinnhaftigkeitsüberlegungen entgegen, andererseits ethische Bedenken.
1.3.2 – Wirtschaftliche Relevanz der Gentechnik
Die wirtschaftliche Relevanz von Biotechnologie und Gentechnik läßt sich am Beispiel Interferon besonders eindrucksvoll belegen: Waren früher für die konventionelle Erzeugung von einem Gramm Interferon ca 200.000 Liter Blut nötig, bedarf die Herstellung mit Hilfe der Gentechnik heutzutage keines Blutes, sondern lediglich einer Nährlösung mit transgenen Bakterien.[15]
Der Weltmarkt für Biotechnologie wird von der Senior Advisory Group Biotechnology (Brüssel) für die Jahrtausendwende auf ca eine Billion Schilling[16] geschätzt, zwei Millionen neue Arbeitsplätze werden in der EU erwartet.[17] Bei beiden Schätzungen entfällt ein Großteil auf die prominenteste Disziplin der Biotechnologie, die Gentechnik.
Förderungen für die Biotechnologie in den USA beliefen sich Anfang der Neunziger auf runde 60 Mrd Schilling jährlich. In Europa ist die Förderung etwas bescheidener, aber immerhin noch mit etwa 900 Mill Schilling in derselben Zeit dotiert.[18] [19]
1.4 – Grundlagen der Biotechnologie
Das Prinzip der genetischen Veränderung, der Mutation, ist an sich nichts Widernatürliches. Mutationen kommen laufend in der Natur vor, sonst gäbe es keine Evolution. Mit der Genetik, mit der Gentechnik noch viel mehr, kann man im Gegensatz zur natürlichen Mutation die Richtung der Veränderung bestimmen und vor allem auch die Häufigkeit.
Veränderungen können sowohl bloß an den Körperzellen (somatische Zellen oder Somazellen) vorgenommen werden, was keine Auswirkungen auf die Nachkommenschaft hat, als auch an den Keimzellen, wobei diese Änderungen dann weitervererbt werden.
Die genetische Information eines Organismus (das Genom) liegt auf einer gewissen Anzahl von Chromosomen. Chromosomen bestehen vor allem aus Desoxyribonukleinsäure (DNA). Auf dem DNA-Strang eines Chromosoms liegen mehrere Gene. Gene bestehen wiederum aus Kombinationen von bestimmten Basen. Es gibt vier Basen: Adenin (A), Thymin (T), Cytosin (C) und Guanin (G), diese binden sich immer nur paarweise: A–T, T–A, C–G und G–C. Es gibt somit nur 4 Kombinationsmöglichkeiten dieser Basenpaare. Um die ca 20 existierenden Aminosäuren eindeutig codieren zu können, bedarf es also dreier Basenpaare (43=64). Eine Vielzahl solcher Drei-Basenpaar-Verbindungen (sog Basentripletts oder Codogene) bilden ein Gen. Gene enthalten somit einen „Bauplan“ für Verbindungen von Aminosäuren und somit für alle organischen Verbindungen die der Organismus braucht, vor allem die Proteine. Diese Verbindungen werden wie gesagt aus bloß 20 verschiedenen Aminosäuren gebaut. Wichtig ist, daß der „Bauplan“ für die Aminosäuren, der genetische Code, universell ist, also für alle Organismen gilt. Dadurch ist es erst möglich, Gene in anderen Organismen zur Expression, also zum Aufbau von Proteinen, zu bringen.
Man muß bedenken, daß jede einzelne Zelle eines Organismus die gesamte Erbinformation in sich trägt. Jede somatische Zelle des menschlichen Körpers hat idR 46 Chromosomen (doppelter oder diploider Chromosomensatz). Nur die Keimzellen haben bloß den einfachen (haploiden) Chromosomensatz, also 23 Chromosomen. Das bedeutet, daß in jeder Zelle sämtliche Gene, die der Organismus zur Proteinsynthese benötigt, vorhanden sind. Verwendet werden aber in den jeweiligen Zellen bloß jene Gene, die für die Erzeugung der für sie typischen Proteine notwendig sind. Bis zu einem gewissen Stadium der embryonalen Entwicklung sind die Zellen noch nicht spezialisiert. Diesen Zustand der vorläufigen „Unspezialisiertheit“ nennt man Totipotenz. Die spätere Entwicklung der Zellen hängt von ihrem Platz im Organismus ab. Entnimmt man noch nicht differenzierte Zellen, kann man sie an einer beliebigen anderen Stelle wieder einpflanzen und sich dort analog zu den anderen ansässigen Zellen entwickeln lassen. Die Funktion einer Zelle wird also nicht bloß durch ihre DNA, sondern auch durch ihre Lage im Organismus bestimmt.
Nach dieser Methode werden auch sog „Chimären“ [20] erzeugt, das sind Tierkombinationen, die entweder von vier Eltern oder aus zwei Arten stammen. Als Beispiele wären zu nennen der Forpfen (Forelle-Karpfen), die Tom(t)offel (Tomate-Kartoffel)[21] oder die Schafziege. Eine rekombinante DNA besteht zumeist aus DNA-Stücken verschiedener Organismen und heißt in diesem Fall „ chimäre DNA “.
In jeder einzelnen Zelle wird also je nach Aufgabe der Zelle bloß ein Teil der Gene exprimiert, dh zur Proteinsynthese kopiert. Damit ein Gen exprimiert wird, muß zuerst sein Promotor aktiviert werden. Die Kontrolle über solche Promotoren, sie zu induzieren, ist ziemlich schwierig.[22]
Vereinfacht gesagt kann man, wenn man jenes Gen sucht, das Insulin erzeugen soll, aus einer insulinerzeugenden Zelle der Bauchspeicheldrüse diese Kopien, sog Messenger-Ribonukleinsäuren (m-RNA) mittels chemisch-physikalischer Methoden erhalten. Da die besagte Zelle aber auch noch andere Stoffe erzeugt, erhält man verschiedene m-RNA. So wie auch der vorgenannte Schritt nicht so leicht ist, wie er klingt, ist auch das Herausfinden des richtigen Gens aus einer Menge von isolierten m-RNA das Ergebnis von zahlreichen Tests.
Ist das gesuchte Gen einmal isoliert, kann es auf einen anderen Organismus übertragen werden. Zur Einpflanzung in einen anderen Organismus bedient man sich sog Vektoren. Eine Art von Vektoren sind sog Plasmide. Plasmide sind DNA-Ringe, die vor allem bei Bakterien vorkommen und außerhalb des Zellkerns frei im Zellplasma liegen. In diese Plasmide wird das einzupflanzende Gen eingesetzt und das veränderte Plasmid wird wieder in die Wirtszelle gebracht. Dort vermehrt sich das Gen als Bestandteil der Erbinformation weiter.
Unter Amplifikation versteht man, daß eine Zelle das Plasmid mit der eingefügten Passagier-DNA öfter als nur einmal reproduziert (multi-copy-Plasmide). Dies wird durch Mehrfach-Insertion oder durch chemische Beeinflussung erreicht.[23]
Obwohl Plasmide sehr gut als Vektoren geeignet sind, stellen sie dennoch einen gravierenden negativen Aspekt der Freisetzungsproblematik dar.[24]
Obzwar der genetische Code universell ist, kann es passieren, daß DNA-Abschnitte aus höheren Organismen (vorwiegend Eukaryonten) von Bakterien (vorwiegend Prokaryonten) nicht exprimiert werden können, weil noch sog Introns [25] zwischen den relevanten Basentripletts gelagert sind. Wegen dieser und auch anderer Komplikationen kann es passieren, daß die gentechnisch veränderten Zellen, sog rekombinanten Zellen, das gewünschte Protein nicht erzeugen.
Um rasch feststellen zu können, ob die Rekombination wunschgemäß erfolgt ist, werden zusätzlich zu dem Gen, das exprimiert werden soll, Gene eingefügt, die die Zelle resistent gegen ein oder mehrere verschiedene Antibiotika machen. Nach der Einpflanzung dieser sog „Markergene“ kann dann nach Beigabe von Antibiotika eruiert werden, bei welchen Zellen die Verpflanzung erfolgreich war. Häufig wird das Antibiotikum Kanamyzin verwendet, das zwar nicht in der Humantherapie, aber bei Tieren angewandt wird. Das vieldiskutierte Problem mit den Resistenzgenen ist, daß sie auf andere Organismen überspringen könnten und sich so die Resistenz verbreiten kann.
Auch das umgekehrte Verfahren wird verwendet, wobei Markergene inaktivert oder beseitigt werden (Markerdeletion [26] ): Dazu werden Plasmide mit zwei Resistenzgenen („RGA“ und „RGB“) gegen die Antibiotika „A“ und „B“ verwendet. Das neue Gen wird genau an die Stelle von RGA des Plasmids gesetzt. Sterben die Zellen nach Beigabe des Antibiotikums „B“ ab, so enthalten sie gar kein Plasmid. Sterben sie nicht ab, so enthalten sie das rekombinante Plasmid oder aber das konventionelle Plasmid mit der Resistenz gegen beide Antibiotika.
2. Kapitel – Grundzüge der Gentechnikregelung
2.1 – Entwicklung internationaler (unverbindlicher) Gentechnikregelungen
Anfang der 1970er begann man, sich mit der Gentechnik zu beschäftigen und „drauf los zu forschen“. Man war sich vieler potentieller Gefahren nicht bewußt, bis man auf einmal ein gewaltiges Gefahrenpotential vage wahrzunehmen begann und die Arbeiten schlagartig einstellte. Man hatte realisiert, daß die Experten der Gentechnik, Genetiker und Molekularbiologen, das Gefahrenpotential ihres Wissensgebietes, der Gentechnologie, nicht abschätzen konnten. Als das Gefährdungspotential entdeckt wurde, wurde von einem Komitee der amerikanischen „National Academy of Sciences“[27] 1974 ein weltweites einjähriges Moratorium für bestimmte gentechnologische Arbeiten ausgerufen, um Medizinern und auch Epidemiologen die Möglichkeit und Zeit zu geben, sich mit der Materie vertraut zu machen und mögliche Risken abzuschätzen. Parallel dazu sollten auch Maßnahmen zum sicheren Umgang mit rekombinierten genetischen Materialien ausgearbeitet werden.[28]
Diese Bemühungen mündeten in der Konferenz von Asilomar (International Conference on Recombinant DNA Molecules, 1975). Dort wurden einige Richtlinien erarbeitet[29] und das Moratorium aufgehoben. Es wurde realisiert, daß prinzipiell nur die Gentechnologen den nötigen Sachverstand mitbringen, um sinnvolle Sicherheitsgrenzen festzulegen.[30] Der eigentlich viel wichtigere Aspekt dieser Konferenz war aber, daß dadurch dieser Zweig der Wissenschaft – wohl eher ungewollt – öffentlich zur Diskussion gestellt wurde.[31]
Weiters entstanden im Zuge dieser Bestrebungen in den USA an den National Institutes of Health (NIH) die sog NIH-Guidlines, die infolge des als hoch eingeschätzten Risikopotentials der Gentechnik relativ restriktiv ausfielen. Diese – hauptsächlich für Arbeiten im Labor konzipierten (Freisetzungen waren noch generell verboten)[32] – Richtlinien fanden international Anerkennung bewirkten, daß es – laut den Verfechtern der Gentechnologie – in zwanzig Jahren zu keinem einzigen Fall von Gefährdung der Gesundheit kam.[33] Die nun von manchen vermutete Harmlosigkeit der Gentechnik wird und wurde auch schon bald nach Asilomar als Argument in Diskussionen eingebracht, um die Lockerung der Richtlinien zu erwirken.[34] So wurde bereits 1978 das generelle Freisetzungsverbot wieder gelockert.[35]
1986 wurden von der „OECD ad hoc Arbeitsgruppe“[36] Prinzipien für den Umgang mit GVO in GS und Überlegungen zur Freisetzung (step-by-step, case-by-case) vorgelegt und von allen OECD-Mitgliedern akzeptiert.[37]
2.2 – Das österreichische Gentechnikgesetz (GTG)
2.2.1 – Geschichte des GTG
In Österreich wurde das GTG lange vorbereitet. Gem Anhang XX Punkte 24 u 25 iVm Art 74 u 7 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum waren die RL 90/219/EWG über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen (S-RL) und 90/220/EWG über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt (FS-RL) bis zum 1. 1. 1995 umzusetzen. Die durch das EWR-Abkommen bedingten Besonderheiten, die sich auch noch im GTG finden, gelten jetzt nicht mehr.[38] Eine weitere gentechnikspezifische RL, die RL 90/679/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Arbeitnehmerschutzrichtlinie) war nicht in den „acquis communautaire“ des EWR zu übernehmen. Die Verpflichtung zur Übernahme im Rahmen des Beitritts Österreichs zur EU soll hier nicht erörtert werden.
Bereits vor Abschluß des EWR-Abkommens wurde die sog Enquete-Kommission eingesetzt, die die Risken und Chancen der Gentechnik erörtern sollte und dementsprechende Anforderungen an ein GTG stellen sollte. Zahlreiche Gutachten wurden in Auftrag gegeben. Es stand ein breites Angebot an Gutachten zur Entwicklung des deutschen GenTG zur Verfügung. Die Ausschüsse hatten also sehr gute Voraussetzungen zur Erarbeitung des GTG.
Über die Regierungsvorlage zum GTG (3. Entwurf) wurde am 26. Mai 1994 im Nationalrat abgestimmt. Jedoch wurde dabei ein Abänderungsantrag übersehen (was bei der Vielzahl von Abänderungsanträgen[39] nicht verwunderlich ist), worauf das GTG als Initiativantrag 732/A erneut ins Parlament gelangte. Am 15. Juni 1994 wurde nach knapp zweistündiger Debatte erneut über das Gesetz abgestimmt und das GTG wurde in der Form des Berichtes des Gesundheitsausschusses vom 14. Juni 1994 (1730 BlgNR) beschlossen. Sämtliche Abänderungsanträge wurden im Plenum abgewiesen.
2.2.1.1 – Gesetzgebungskompetenz, Rechtssicherheit und Abwanderungsproblematik
Betrachtet man die Art 10-15 Bundesverfassungsgesetz (B-VG), so wird man darin keinen Kompetenztatbestand „Gentechnik“ finden. Auf Grund der herrschenden Auslegungsmethode der österreichischen Verfassung, der sog „Versteinerungstheorie“, kann das Gros der Kompetenztatbestände keine Legitimation des Bundes zur Regelung gentechnologischer Sachverhalte liefern. Mangels einer Bundeskompetenz, müßten gem dem Subsidiaritätsprinzip die Länder die Kompetenzen innehaben.
Im Rahmen der die Versteinerungstheorie wieder aufweichenden „intrasystematischen Interpretation“ können Kompetenzen zur Regelung der Gentechnik überall dort angenommen werden, wo schon zum Versteinerungszeitpunkt (1.10.1925) Kompetenzen zum Schutz bestimmter Güter bestanden haben.[40] Jüngere Kompetenzen, wie etwa jene für gefährliche Abfälle, sind für die Regelung der Gentechnologie auf jeden Fall relevant. Die Anknüpfung dieser komplexen Materie an die verschiedenen Kompetenztatbestände führt dazu, daß die Gentechnologie eigentlich eine Querschnittsmaterie ist, weil die Kompetenzen quer durch die über 100 Einzelkompetenzen[41] verteilt sind.
Der österreichische Gesetzgeber hat sich wohl auch auf die intrasystematische Interpretation gestützt und hat – wie schon oben angedeutet – keinen eigenen Kompetenztatbestand eingeführt. So heißt es in den Erl RV [42], daß die Gesundheit des Menschen sowohl unmittelbar beeinträchtigt als auch mittelbar über die Umwelt gefährdet werden könnte und daher die Kompetenz zur Erlassung des GTG durch den Kompetenztatbestand „Gesundheitswesen“ gegeben sei. Weitere Stützen seien die Kompetenzen zur Regelung des Gewerbes und der Industrie, des Hochschulwesens, der Abfallwirtschaft und der Luftreinhaltung sowie das Wasserrecht.
Demnach dürfte eines der Ziele des GTG, der Schutz der Umwelt, nur insoweit Grund für einen negativen Bescheid sein, als der schädliche Einfluß auf die Umwelt auch auf die Gesundheit wirkt. So ist die Frage, ob ein freigesetztes rekombinantes Bakterium sich als Pflanzenschädling erweisen könnte – mangels Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit – nicht in einem bundesrechtlichen Verfahren zu klären.[43] Mit entsprechend weit gefaßter Sichtweise kann man dieses Argument quasi gegenstandslos machen, indem man jede Schädigung der Umwelt auch als Schädigung der menschlichen Gesundheit, als Einschränkung der Regenerationsmöglichkeiten etc darstellt.
So wären nach dem sog „Kumulationsprinzip“ für ein Genehmigungsverfahren zB einer gentechnischen Arbeit verschiedene Regelungen zu beachten. Diese Regelungen werden auf Grund der sog „Gesichtspunktetheorie“ von Bund oder Ländern je nachdem kompetenzrechtlichen Gesichtspunkt erlassen.[44]
Um diesem unvorteilhaften Zustand vorzubeugen, wurde von mehreren Seiten empfohlen, einen eigenen Kompetenztatbestand einzurichten. So konstatiert zB Öhlinger [45]: „Eine umfassende gesetzliche Regelung der Gentechnik […] würde jedenfalls auch eine verfassungsgesetzliche Änderung der geltenden Kompetenzverteilung voraussetzen“.
Daher bleibt zu fragen, warum der Gesetzgeber diesen Forderungen nicht nachgekommen ist. Umso erstaunlicher erscheint dieses Sträuben gegen eine Verfassungsänderung, wenn man bedenkt, daß es seit 1920 etwa 700 Verfassungsänderungen gab.[46]
Auch das GenTG in Deutschland normiert wie das österreichische GTG eine Regelung der Gentechnik auf Bundesebene, was verglichen mit andern Ländern eine Seltenheit ist.
Die vertikale Kompetenzfrage wurde durch einen „Schwerthieb der Zentralisierung“[47], allerdings ohne durchgehende rechtliche Legitimation, „geklärt“. Aber auch zur horizontalen Kompetenzfrage findet sich in den Erl RV [48] eine ähnliche Argumentation: Im Hinblick auf das vorrangige Schutzziel der Gesundheit des Menschen und seiner Nachkommenschaft […] sei in der Vorbereitung und in der Vollziehung die federführende Zuständigkeit des BMGK sowie die Zuständigkeit des BMWVK gegeben.
Auch diesbezüglich wurde festgestellt, daß – mangels kompetenzrechtlicher Änderung – Bedacht auf die Ressortzuständigkeiten zu nehmen ist. Es wären in Teilbereichen der Gentechnologie zB der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft oder der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie[49] ebenfalls zuständig.
Innerhalb ihres, gem Bundesministeriengesetz, BGBl 76/86, zugeteilten, Wirkungsbereiches allerdings können die oben angesprochenen Verwaltungsbehörden – „ohne daß es einer weiteren einfachgesetzlichen Ermächtigung hiezu bedürfe“[50] – auf Grund der Gesetze Durchführungsverordnungen erlassen. Das bedeutet, daß auch andere BM als der BMGK und der BMWVK innerhalb ihrer Kompetenzbereiche Durchführungsverordnungen zum GTG erlassen können.
In dieser Betrachtung sollen auch die Kompetenzen der EU jenen des österreichischen Gesetzgebers gegenübergestellt werden. Das in Art 3b S 2 EGV normierte Subsidiaritätsprinzip legt fest, daß die EU in bestimmten Bereichen nur dann tätig wird, wenn die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend und daher besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können (sog „Besser-Klausel“).[51]
Diese „bestimmten Bereiche“ stellen aber das Problem dar. Es handelt sich nämlich nur um jene Bereiche, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft fallen. Ausschließliche Kompetenzen der Gemeinschaft sind nach gefestiger Meinung Handels-, Fischerei- und Agrarpolitik. Allerdings wird auch die Auffassung vertreten, daß die Binnenmarktkompetenz (Kompetenz zur Herstellung des Binnenmarktes im Sinne von Art 100a EGV) ebenfalls eine ausschließliche Kompetenz der Gemeinschaft darstellt.[52] Demnach wäre die FS-RL und die Novel-Food-Verordnung, die beide auf Art 100a gestützt sind, vom Anwendungsbereich der Besser-Klausel ausgeschlossen.[53]
Die Erlassung eines übergreifenden Gentechnikgesetzes statt einer sog Streunormierung entspricht der mehrheitlichen Forderung nach Rechtssicherheit. [54] Die Flexibilität soll durch die Technikklauseln [55] und die zahlreichen Verordnungsermächtigungen gewährleistet werden.
Oft taucht das Argument auf, daß im internationalen Vergleich verhältnismäßig strenge Regulierungen, aber auch das gesellschaftliche Klima[56] die Standortwahl in einer von wirtschaftlicher Seite betrachteten negativen Weise beeinflussen oder gar zur Abwanderung bereits etablierter Unternehmen mit deren Forschungs- und Produktionsstäten führen.[57] So wurde – insb vor der Erlassung des GenTG in Deutschland – seitens der Industrie davon gesprochen, daß das geplante Gesetz das Ende der Gentechnologie im jeweiligen Lande bedeuten würde.[58] In Österreich warnte man vor der Verabschiedung vor „[d]eutsche[n] Zustände[n]“[59] und berief sich auf schwerwiegende negative Folgen der strengen Regelung[60].
Diese Aussagen mögen auf den ersten Blick durchaus plausibel und daher auch richtig erscheinen, jedoch dürfte – den Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung zufolge – dieser Schein trügen. Die Quintessenz dieses Gutachtens ist nämlich, daß die nationale Regulierungspraxis keinen ausschlaggebenden Einfluß auf die Entscheidung über Standorte für gentechnische Produktionsbetriebe hat.
Die Abwanderung in die USA, auf die von Regelungskritikern oft verwiesen wird, und die nachzuweisen ist, ist nach dieser Studie nicht auf das gerne angeführte Vorhandensein einer mäßigen Regulierungspraxis der Gentechnologie zurückzuführen. Die angeblich vorteilhafte geringe Rolle des Ordnungsrechts in den USA wird nämlich von den dort ansässigen Firmen schwer kritisiert. Von ihnen würde das eher gleichmäßige, Rechtssicherheit gewährende Ordnungsrecht dem vorherrschenden, viel mehr unberechenbaren Haftungsrecht vorgezogen. werden. Dies läßt sich damit erklären, daß ein Betrieb danach strebt, seine Kosten möglichst genau planen zu können. Nur unter rigiden und zuverlässigen Regulierungen kann eine hohe langfristige Planungssicherheit erreicht werden. Weniger strenge Regulierungen, die mehr auf der Regelung durch die Gerichte des Privatrechts aufbauen, erlauben nur eine dementsprechend geringere Planungssicherheit.
Ein weiterer Punkt, der gegen die Ausweitung des Schadenersatzrecht zu Lasten des Ordnungsrechts spricht, ist die mit einem strikteren Zulassungsverfahren einhergehende höhere Produktakzeptanz seitens der Bevölkerung.[61]
Die Vorteile, die der Standort USA offensichtlich bietet, scheinen andere Ursachen zu haben. In diesem Zusammenhang wird insb auf die Möglichkeiten des direkten Wissenstransfers und auf das Rekrutierungspotential für hochqualifizierte Fachkräfte verwiesen, welche im Umfeld führender internationaler gentechnischer Forschungszentren an der amerikanischen West- und Ostküste gegeben sind.[62] Eine Abwanderung heimischer Firmen zu diesen Zentren sollte daher nicht als Auswanderung vermeintlich leichterer Genehmigungsbedingungen wegen mißverstanden werden.[63]
Vermeintlich leichtere Bedingungen deshalb, weil zwar die Zulassungskriterien in den USA etwas lockerer sein mögen, aber für die Genehmigungsverfahren auf Grund der unübersichtlichen Rechtslage erheblicher bürokratischer Aufwand getrieben werden muß. Es ist in den USA auf Grund der zerplittert-föderalistischen Regelung, manchmal auch überschneidenden Zuständigkeitsbereiche der Behörden und einer dementsprechenden Vielzahl von nötigen Anträgen, Gutachten und Genehmigungen dazu gekommen, daß idR ein erfahrener Rechtsanwalt mit der Abwicklung der Formalitäten betraut werden muß.[64] 1986 wurde das „Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology“ publiziert, es wurde sogar ein Komitee zur Koordination der Biotechnologie (BSCC) eingerichtet.[65] Sog „Road-maps“ sollen den Weg vom Vorhaben über den Behördenweg bis zur Durchführung des Vorhabens schildern.[66]
Zum Schluß sei noch angemerkt, daß sich die Option der Ansiedelung in internationalen Forschungszentren – um den Begriff „Abwanderung“ bewußt zu vermeiden (vgl oben) – vor allem nur für große, multinational agierende Konzerne anbietet.
2.2.2 – Aufbau des GTG
Das GTG 1994 hat folgenden Aufbau:
Artikel I – Gentechnikgesetz
1. Abschnitt – Allgemeine Bestimmungen (§§ 1-4)
Darunter fallen: Ziele, und Grundsätze, Geltungsbereich des Gesetzes und detaillierte Legaldefinitionen.
2. Abschnitt – Arbeiten mit GVO in geschlossenen Systemen (§§ 5-35)
3. Abschnitt – Freisetzen von GVO und Inverkehrbringen von Erzeugnissen (§§ 36-63)
Teil A – Freisetzung von GVO (§§ 36-53)
Teil B – Inverkehrbringen (§§ 54-63)
4. Abschnitt – Genanalyse und Gentherapie am Menschen (§§ 64-79)
5. Abschnitt – Gentechnikkommission und Gentechnikbuch (§§ 80-99)
6. Abschnitt – Behördenzuständigkeit und Kontrollen (§§ 100-101)
7. Abschnitt – Sicherheitsforschung (§ 102)
8. Abschnitt – Vorläufige Zwangsmaßnahmen (§ 103)
9. Abschnitt – Erlöschen der Berechtigung (§ 104)
10. Abschnitt – Vertraulichkeit von Daten und Datenverkehr (§§ 105-106)
11. Abschnitt – Internationaler Informationsaustausch (§ 107)
12. Abschnitt – Übergangs-, Straf- und Schlußbestimmungen (§§108-111)
Artikel II – Änderung des Produkthaftungsgesetzes
Artikel III – Inkrafttreten
2 Anlagen, wovon die erste die Unterlagen für die Anmeldung resp den Antrag gentechnischer Arbeiten gem §§ 19 u 20, die zweite ein Formblatt zur Meldung von Genanalysen gem § 73 enthält.
2.2.3 – Allgemeines (§§ 1-4 u 100 f)
2.2.3.1 – Geltungsbereich
Der Geltungsbereich erstreckt sich lt § 2 auf gentechnische Anlagen, Arbeiten mit GVO, Freisetzungen von GVO, Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die aus (ganzen) GVO bestehen, Kennzeichnen von Erzeugnissen, die in Verkehr gebracht wurden[67], und die Genanalyse und Gentherapie.
Gentechnische Anlagen sind lt § 4 Z 6 örtlich gebundene Einrichtungen, die zur Durchführung von Arbeiten mit GVO in geschlossenen Systemen bestimmt sind. Sie werden im GTG nur indirekt geregelt; es gibt für sie kein eigenes Zulassungsregime.[68]
Arbeiten mit GVO sind lt § 4 Z 4 lit a-c Herstellung, Verwendung und Vermehrung, Lagerung, Zerstörung und Entsorgung von GVO, sowie der innerbetriebliche Transport von GVO, sofern noch keine Genehmigung für Freisetzung oder Inverkehrbringen der GVO vorliegt. Diese Definition stimmt im wesentlichen mit der der S-RL überein und deckt sich mit der deutschen Definition. Beim innerbetrieblichen Transport ist lt § 4 Z 5 der Betreiber (zB einer gentechnischen Anlage; vgl § 4 Z 13) zugleich Absender und Empfänger. Außerdem darf der Transport nur innerhalb des Betriebsgeländes oder auf kurzen Strecken und unter ständiger Bewachung außerhalb des Betriebsgeländes durchgeführt werden.
Während die S-RL und auch die FS-RL von genetisch veränderten (Mikro-) Organismen sprechen, ist im GTG immer von gentechnisch veränderten Organismen die Rede. Es sind daher folgende zwei Aspekte zu klären:
1. Die S-RL gilt nur für GVM (Art 1 S-RL). Arbeiten mit höheren GVO sind ausgespart, was diesbezügliche nationale Regelungen ermöglicht.[69]
2. Der Begriff „genetisch" an sich beschreibt den Zustand zB eines GVO. Demgegenüber weist der Begriff „gentechnisch“ einen Bezug auf das Verfahren hin, an dessen Ende ein genetisch veränderter Organismus. Demanch ist im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff des genetisch veränderten Organismus der weitere, weil er eben jeden genetisch veränderten Organismus umfaßt, egal ob die genetische Veränderung mittels gentechnischer Methoden oder anderer Verfahren bewirkt wurde. Die Definitionen des Genetisch veränderten Organismus in Art 2 lit b S-RL und in Art 2 z 2 FS-RL beziehen sich allerdings beide auf die gleichen Verfahren (jeweils Anhang I A Teil 1 Z 1-3), die sich auch in der demonstrativen Enumeration von gentechnischen Verfahren des § 4 Z 3 lit a-c finden. Die beiden Begriffe „ genetisch “und „ gentechnisch “ sind in diesem Sinne also vollkommen gleichwertig.[70]
Freisetzung von GVO ist das absichtliche[71] Ausbringen von GVO, von Kombinationen von GVO oder Kombinationen von GVO und herkömmlichen Organismen, sofern eine Genehmigung für deren Inverkehrbringen noch nicht vorliegt.[72]
Inverkehrbringen von GVO ist lt § 4 Z 21 die Abgabe von Erzeugnissen aus oder mit GVO an Dritte oder das Einführen von solchen Erzeugnissen. Davon ausgenommen sind Erzeugnisse, die zu Arbeiten mit GVO in gentechnischen Anlagen und somit in geschlossenen Systemen bestimmt sind, oder die für eine Freisetzung oder wissenschaftliche Zwecke bestimmt sind.
Unter Kennzeichnung von in Verkehr gebrachten Erzeugnissen fallen lt § 62 Abs 2 unter anderem die Bezeichnung des Erzeugnisses und der darin enthaltenen GVO, die Angabe der besonderen Eigenschaften des Erzeugnisses und die Anleitung zur Lagerung und Handhabung.
Unter Genanalyse versteht das GTG eine Untersuchung am Menschen zur Feststellung von Mutationen (§ 4 Z 23); unter Gentherapie die Übertragung von Genen auf Zellen im Menschen.
2.2.3.2 – Ziele des GTG
Es wird hier prima vista eine gewisse Zweckambivalenz bei der Zielsetzung ersichtlich: Zum einen soll die Gesundheit geschützt werden, zum anderen soll die Anwendung der Gentechnik, die diese Schutzbemühungen potentiell unterläuft, gefördert werden (vgl § 1 Z 2). Bei Betrachtung der Erl RV (zu § 1) und der Auslegung durch das BMGK scheint der Schutz der Gesundheit die Forschungsfreiheit und -förderung zu überwiegen.
Ziel des GTG lt § 1 ist der Schutz der Gesundheit des Menschen [73] und seiner Nachkommenschaft vor unmittelbar aber auch mittelbar durch die Anwendung der Gentechnik entstehenden Schäden. Dieses – lt Erl RV vorrangige – Ziel ist insofern sehr weitreichend, als auch die mittelbaren (indirekten) Auswirkungen darin berücksichtigt sind. Außerdem kann man im Schutz der Gesundheit der Nachkommenschaft[74] den Ansatz eines Nachhaltigkeitspostulats sehen.
Ein weiteres Ziel ist der Schutz der Umwelt vor schädlichen Auswirkungen von GVO. Dabei wird besondere Aufmerksamkeit auf die Ökosysteme gelegt, was sich mit dem beabsichtigten Schutz vor mittelbaren Auswirkungen erklären läßt. „Der Schutz der Umwelt ist von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit des Menschen, da die Existenz und das Wohlergehen des Menschen entscheidend von seiner Umwelt abhängig sind“ (Erl RV zu § 1).
Als letztes Ziel soll die Anwendung der Gentechnik durch die Gestaltung eines rechtlichen Rahmens für ihre Erforschung gefördert (und nicht bloß gewährleistet) werden. Insb die Sicherheitsforschung war ein besonderes Anliegen, dem man sogar einen eigenen Paragraphen (§ 102) widmete. Die Forschung auf dem Gebiet der Sicherheit der Anwendungen der Gentechnik soll gefördert werden. So sollen lt Erl RV zu § 102 zB biologische Sicherheitsmaßnahmen oder die Interaktion freigesetzter GVO mit der Umwelt erforscht werden. Ein Beispiel für die geförderte Sicherheitsforschung ist der Auftrag an das Forschungszentrum Seibersdorf. Es sollten im Auftrag des Gesundheits- (BMGK) und des Wissenschaftsministeriums (BMWVK) Sicherheitsaspekte der Freisetzung erforscht werden.[75] Der Antrag wurde trotz erheblicher für den Staat bereits angelaufener Kosten aus politischen Gründen abgewiesen.
2.2.3.3 – Grundsätze des GTG
Die Grundsätze des GTG sind lt § 3: Vorsorge-, Zukunfts-, Stufen-, demokratisches und ethisches Prinzip.
Das Vorsorgeprinzip in § 3 Z 1 besagt, daß Arbeiten mit und Freisetzungen von GVO nur zulässig sind, wenn dadurch keine nachteiligen Folgen für die Sicherheit zu erwarten sind. Auf das Wort „Sicherheit“ folgt im GTG immer wieder ein Verweis auf § 1 Z 1. Damit ist die „Sicherheit für den Menschen und die Umwelt“ gemeint, welche das Resultat der Ziele des GTG (Schutz der Gesundheit des Menschen und seiner Nachkommenschaft und der Umwelt) darstellen soll.
Das Vorsorgeprinzip bezieht sich nach dem Wortlaut des GTG bloß auf Arbeiten mit GVO und Freisetzungen, denn nur diese beiden sind genannt[76]. Für andere, in den Bereich des GTG fallende Handlungen, insb das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, ist das Vorsorgeprinzip nicht normiert. Diese Formulierung widerspricht prima vista Art 4 Abs 1 FS-RL, welche das Vorsorgeprinzip – allerdings nicht namentlich – für Freisetzung und Inverkehrbringen normiert.[77] Jedoch wird im GTG der Inhalt des Vorsorgeprinzips, wie auch bei den gentechnischen Arbeiten und der Freisetzung, beim Inverkehrbringen extra normiert (§ 58 Abs 4 Z 3; vgl auch §§ 23 Abs 1 Z 2 u 40 Abs 1 Z 2).
Das sog Zukunftsprinzip (§ 3 Z 2) umfaßt einen schwierig abzuwägenden Interessenskonflikt zwischen zwischen Ethik und Forschung. Es wird hier klar gestellt, daß die Forschung nicht in unangemessener Weise beschränkt werden darf. Unangemessene Behinderungen, wie zB lange Bewilligungsfristen sollen vermieden werden[78]. Auch ethische Bedenken könnten somit als unangemessen abgetan und „wegargumentiert“ werden. Es ist nach ausgiebigem Abwägen ein Ausgleich der Interessen zu finden.[79]
Das Stufenprinzip (§ 3 Z 3) besagt, daß bei der Freisetzung die „Einschließung“[80] der GVO (dh soviel wie die Kontrolle über die GVO) nur stufenweise gelockert werden darf. Es soll also nach jeder Freisetzung überprüft werden, ob die nachfolgende Stufe ohne Gefahr für Mensch und Umwelt eingeleitet werden kann.
Das demokratische Prinzip (§ 3 Z 4) soll die Öffentlichkeit in die Vollziehung einbinden, um deren Information und Mitwirkung sicherzustellen. Allerdings soll diese Einbindung nur nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes erfolgen, also nur dort, wo Mitwirkung vorgesehen ist. In S-RL und FS-RL[81] ist den Mitgliedstaaten[82] die Möglichkeit eingeräumt, Anhörungsrechte vorzuschreiben.
Verschiedentlich wird jedoch kritisiert, daß im GTG – den RL entsprechend –
1. die „Einbindung in die Vollziehung“ bloß ein Anhörungsrecht[83] ist (vgl §§ 28 u 43),
2. das Anhörungsrecht beim Verfahren zum Inverkehrbringen nicht verfügbar ist,
3. das Anhörungsrecht zu Arbeiten im geschlossenen System nur in bestimmten Fällen[84] gegeben ist.
Daraus folgt, daß das, was in § 3 Z 4 als demokratisches Prinzip präsentiert wird, durch die „Maßgabe dieses Bundesgesetzes“ nicht generell im Rahmen der Vollziehung des GTG, sondern nur in taxativ aufgezählten Fällen Vollziehungsprinzip ist. Näheres dazu vgl unten, 3.1.3.2 – Exkurs: Anhörung.
Das ethische Prinzip (§ 3 Z 5) ist wie das Zukunftsprinzip ein österreichisches Spezifikum. Dies rührt wohl daher, daß die Humangenetik in das GTG integriert wurde und damit die ohnehin schon sehr weit zurückgedrängte Schmerzgrenze der Ethik überschritten werden könnte. Das ethische Prinzip ist lt § 3 Z 5 zweigeteilt. Es postuliert nicht nur die Wahrung der Menschenwürde im Rahmen von Genanalyse und Gentherapie, sondern es besagt auch, daß „der Verantwortung des Menschen für Tier, Pflanze und Ökosystem [...] Rechnung zu tragen“ ist (§ 3 Z 5). Darauf könnte eine Argumentation aufbauen, die den Schutz der Gesundheit von Tieren und Pflanzen verlangt, wie das in einem Abänderungsantrag auch schon explizit vorgesehen war. Zwar wird in § 1 Z 1 ohnehin der Schutz der Ökosysteme als ganze vorgegeben, jedoch ist die Formulierung des ethischen Prinzips weniger abstrakt, sondern direkt auf Tiere und Pflanzen bezogen, und außerdem ist sie eine direkte Handlungsaufforderung, während das Ziel des Gesetzes bestenfalls eine mittelbare sein kann.
Im gentechnispezifischen EU-Recht[85] ist die Humangenetik (noch) ausgespart, daher fehlt auch der Schutz der Menschenwürde. Aber auch die Festlegung der Verantwortung des Menschen für Tier, Pflanze und Ökosystem fehlt im europäischen Gentechnikrecht; es ist in dem Zusammenhang bloß pauschal vom Schutz der Umwelt (Art 1 S-RL, Art 1 FS-RL) die Rede.
Die Integration der Humangenetik in das GTG, aber auch andere ethische Aspekte, stellen Ansätze einer über den Bereich des bloß (Gen-)Technischen hinausreichenden Regelung, einer gentechnologischen Regelung dar.
2.2.3.4 – Vollziehungskompetenz
Gem § 100 Z 2 ist die zuständige Behörde der BMGK. Nur für Arbeiten in GS und für Freisetzungen[86] – jeweils[87] in oder von wissenschaftlichen Hochschulen oder anderen wissenschaftlichen Einrichtungen des Bundes, die in seinen Ressortbereich fallen – ist der BMWVK zuständig.
Da die letzte Instanz der unmittelbaren Bundesverwaltung der zuständige BM ist, ist der BM zugleich erste und letzte Instanz. Dh, es existiert mangels übergeordneter Behörde im Instanzenzug keine Möglichkeit eines Rechtsmittelverfahrens gegen die Bescheide. Es ist daher nur eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) möglich. In Frage kommen vor allem die Bescheidbeschwerde, wenn sich die Partei in ihren subjektiven Rechten verletzt fühlt (binnen 6 Wochen ab Ausstellung des angefochtenen Bescheides), und die Säumnisbeschwerde, wenn die Behörde ihre Entscheidungspflicht[88] verletzt.
Voraussetzung ist im zweiten Fall ist allerdings, daß seit dem Einlangen des Bescheides bei der Behörde eine sechsmonatige Frist verstrichen ist. Danach erhält die zuständige Behörde eine obligatorische Nachholfrist von maximal drei Monaten. Erst dann ist der VwGH zuständig und hat ausnahmsweise in der Sache selbst zu entscheiden.[89]
Wie man sieht kann die Verfahrensdauer von gem GTG maximal 90 Tagen um das Doppelte überschritten werden – das Entscheidungsverfahren vor dem VwGH noch nicht eingerechnet.
2.2.3.5 – Kontrollrechte der Behörde
Die Behörde, resp ihre Organe, sind befugt, die Einhaltung der Vorschriften des Gentechnikrechts zu überprüfen. Sie können dabei Proben durchführen oder Einblick in die Aufzeichnungen (§§ 34 u 52) nehmen. Diese Überprüfungen können dort durchgeführt werden, wo Grund zur Annahme besteht, daß gentechnische Arbeiten oder Freisetzungen[90] durchgeführt werden, Erzeugnisse in Verkehr gebracht werden oder Genanalysen oder Gentherapien durchgeführt werden. Es dürfen Kontrollen also nicht nur bei bewilligten Arbeiten, Freisetzungen etc vorgenommen werden, sondern auch dort, wo der begründete Verdacht besteht, daß solche ohne Bewilligung und daher illegal vorgenommen werden.
2.2.3.6 – Stand der Technik
Der Stand der Technik ist in § 4 Z 8 – wie in einigen anderen Technikgesetzen auch – definiert als: „der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen“.
Der Stand der Technik ist ein dynamischer Begriff und soll dem raschen Fortgang der Entwicklungen auf dem Gebiet der Gentechnik entsprechend „mitwachsen“. Es ist üblich, in Technikgesetzen durch die Technikklausel das Regelwerk flexibel zu gestalten und zugleich der Rechtssicherheit Rechnung zu tragen, es also nicht laufend ändern zu müssen und so einen gewaltigen Verfahrensaufwand zu vermeiden. Ebenso ist es üblich, dennoch notwendige Änderungen im Rahmen von Verordnungen vorzunehmen und dazu entsprechende Verordnungsermächtigungen im Gesetz zu verankern.[91]
Der Stand der Technik „folgt dem jeweiligen Erkenntnisstand der Wissenschaft und kennt daher auch keine regionalen Grenzen“[92]. Es ist also der Wissensstand der gesamten Menschheit gemeint. Bei der Ermittlung der technischen Standards, der Bewertung eines Verfahrens, sind „technische und außertechnische Gesichtspunkte“ zu beachten, woraus folgt, daß es dafür „keine exklusive Kompetenz der Techniker“ gibt.[93]
Oft wird die Technikklausel relativiert, es wird der Aufwand zu dem angestrebten Erfolg in Beziehung gesetzt. Dies geschieht auch im deutschen GenTG (§ 16 Abs 1 Nr 3 u Abs 2 GenTG), nicht jedoch im GTG. Dennoch ist darauf hinzuweisen, daß der Grundsatz der Risikoproportionalität einzuhalten ist und daher technische Standards für unterschiedliche Anlagen (Unterscheidungskriterien zB: Größe, Rohstoffe (GVO) etc) differenziert festgelegt werden müssen[94] und auch werden (vgl § 6 Abs 2).
2.2.4 – Gentechnikkommission und wissenschaftliche Ausschüsse (§§ 80-99)
Beim BMGK war gem § 80 ein Stab von Experten, bestehend aus der sog Gentechnikkommission und drei wissenschaftlichen Ausschüssen, einzurichten.
Die Gentechnikkommission hat folgende Aufgaben: Sie soll die Behörde in grundsätzlichen Fragen der Gentechnik beraten (§ 84 Z 1), über den Stand der Entwicklung der Gentechnik dem Nationalrat berichten (§ 99 Abs 1) und an der Erstellung des Gentechnikbuches mitwirken (§ 99 Abs 3), welches ein Bericht über den Stand von Wissenschaft und Technik ist.
Die Gentechnikkommission setzt sich aus 29 ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb1: Zusammensetzung der Gentechnikkommission gem § 81.
Im Vergleich mit Deutschland mag die Anzahl der Mitglieder relativ hoch erscheinen – immerhin beträgt sie fast das Doppelte. Sie läßt sich jedoch mit dem demokratischen Prinzip rechtfertigen. Die Mitglieder werden vom BMGK den Vorschlägen entsprechend auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Für dieselbe Dauer und nach demselben Modus wird für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied bestellt.
Den Vorsitz der Gentechnikkommission hat der Vertreter des BMGK inne, sein Stellvertreter ist der Vertreter des BMWVK (§ 82). Stimmrecht haben alle Mitglieder (§ 83 Abs 2). Ersatzmitglieder üben das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Mitglieder aus, wenn diese selbst nicht an der Abstimmung teilnehmen können. Dies gilt für Abwesende wie auch für den Vorsitzenden, der nämlich kein Stimmrecht, sondern lediglich ein Dirimierungsrecht hat (§ 83 Abs 2 letzter S).
Das Präsenzquorum ist die Hälfte aller Mitglieder (also 15 Mitglieder oder deren Ersatzmitglieder), wobei zugleich mindestens die Hälfte der in Abb 1 fett gedruckten Mitglieder[95] (also neun von diesen Mitgliedern) anwesend sein muß (§ 83 Abs 1). Als Konsensquorum ist die einfache Mehrheit vorgesehen.
Der BMGK muß drei wissenschaftliche Ausschüsse (§§ 85 ff) einrichten, einen für Arbeiten mit GVO im GS, einen für Freisetzungen und Inverkehrbringen und einen für Genanalyse und Gentherapie. Auch deren Mitglieder werden vom BMGK auf Grund von Vorschlägen (häufig der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, direkt oder indirekt) für fünf Jahre bestellt (§ 85 Abs 2).
Die Aufgaben der wissenschaftlichen Ausschüsse sind die Abgabe von Stellungnahmen, die Erstellung von Gutachten und Mitwirkung an der Erstellung des Gentechnikbuches.
2.2.5 – Arbeiten mit GVO in geschlossenen Systemen (§§ 5-35)
Zunächst stellt sich die Frage, was Arbeiten mit GVO sind. Die Erklärung wurde schon oben bei der Darstellung des Geltungsbereichs gegeben. Als nächstes sind die geschlossenen Systeme (GS) zu definieren. Ein geschlossenes System muß lt § 4 Z 7 mittels physischer Schranken, gegebenenfalls zusätzlicher biologischer und/oder chemischer Schranken, in der Lage sein, den Kontakt des GVO mit der Außenwelt zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Die Anforderungen an die Schranken hängen von der Risikoklassifizierung des GVO ab.
Während die S-RL in Art 2 lit c nur die möglichen Arten von Schranken zur Vermeidung von Außenkontakt aufführt, wird im deutschen GenTG (§ 3 Z 4) mit dem Wort „gegebenenfalls“ implizit auf die Differenzierung entsprechend den Sicherheitsstufen verwiesen. In Österreich wird diese Differenzierung in § 4 Z 7 explizit zur Beschreibung der Schranken des GS „entsprechend den Erfordernissen der jeweiligen Sicherheitsstufe“ angeführt.
Interessant ist auch das Verhältnis des GS zur gentechnischen Anlage (§ 4 Z 6). Eine gentechnische Anlage dient zur Durchführung von gentechnischen Arbeiten in geschlossenen Systemen, woraus folgt, daß der Begriff der gentechnischen Anlage den des GS miteinschließt.
Laut den Explanatory Notes zur S-RL können bereits die Wände einer gentechnischen Anlage unter Umständen als physische Schranken gelten. Dies wird zum Beispiel bei Arbeiten mit gentechnisch veränderten Pflanzen oder Tieren der Fall sein. Als biologische Schranken kommen zB Aminosäureauxotrophien[96] oder sog Selbstmordgene[97] in Frage. Anzumerken ist aber, daß auch diese nicht hundertprozentig sicher sind.[98]
Problematisch ist die Definition des GS in Zusammenhang mit transgenen Tieren. Ist die Kuh auf der Weide noch innerhalb des GS oder bereits außerhalb?[99] Näheres dazu aber im 3. Kapitel.
2.2.5.1 – Pflichten des Betreibers einer gentechnischen Anlage
Der Betreiber einer gentechnischen Anlage muß lt § 13 Abs 1 die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gem § 10 treffen und für ihre Einhaltung sorgen. Mit Sicherheitsmaßnahmen sind Maßnahmen gemeint, die – dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend – die Sicherheit lt § 1 Z 1 gewährleisten. Damit ist auch die Dekontaminierung von Abfällen, Abwässern und Abluft angesprochen (§ 10 Abs 2). Diese sind auch in der S-RL in Erwägungsgrund 4, Art 7 Abs 3 resp Anhang V (Teil D lit e) und im Anhang IV (Spezifikationen 2. und 6. f, g und 7.) angeführt.[100]
Der Betreiber muß alle Arbeiten mit GVO aufzeichnen und diese Aufzeichnungen aufbewahren (§ 35). Sowohl der Detaillierungsgrad als auch die Aufbewahrungsfristen (drei oder fünf Jahre) sind den unterschiedlichen Gefährlichkeitsniveaus entsprechend grob abgestuft.
Es ist vom Betreiber ein der Gefährlichkeit der jeweiligen gentechnischen Arbeit Rechnung tragender Notfallplan zu entwerfen. Kommt es zu einem Unfall, so sind die Behörde(n) und möglicherweise von einem Risiko für die Gesundheit betroffene Personen unverzüglich über den Unfall und – im Fall der genannten Personen – über geeignete Verhaltensmaßnahmen in Kenntnis zu setzen (§ 11).
Damit der hohe Schutzstandard gewährleistet werden kann, müssen zusätzlich zu den externen Kontrollen durch die Behörde noch interne Kontrollapparate eingerichtet werden: der Beauftragte für die biologische Sicherheit, der Projektleiter und das Komitee für (die) biologische Sicherheit. Mit ihnen hat sich der Betreiber in allen Sicherheitsfragen zu beraten, ohne damit seiner gesetzlichen Verantwortung entbunden zu werden (§ 13 Abs 2 u 3).
Mit gesetzlicher Verantwortung ist die verwaltungsrechtliche Verantwortung im Rahmen des GTG gemeint. Die genannten drei Institutionen müssen den Betreiber bestmöglich unterstützen, damit dieser seiner Verantwortung nachkommen kann. Jedoch besteht für den Betreiber die Möglichkeit, verantwortliche Personen der Behörde zu melden. Er kann damit gem § 9 Abs 2 VStG für bestimmte räumlich oder sachlich klar abgegrenzte Bereiche (aber auch für das ganze Unternehmen) seine Verantwortung übertragen. Der somit „ verantwortliche Beauftragte “ muß aber klarerweise (nachweislich) zustimmen und mit entsprechenden Anordnungsbefugnissen ausgestattet werden.
Die Einrichtung der im einzelnen Fall erforderlichen der drei obengenannten Institutionen muß der Behörde bei der Anmeldung oder Beantragung erstmaliger Arbeiten in einer gentechnischen Anlage gemeldet werden. Neben den Namen sind meistens auch die notwendigen Qualifikationen der einzelnen Personen anzugeben. Auch ein Ausscheiden oder ein Wechsel von besagten Personen ist der Behörde unverzüglich kundzutun – im Fall des Wechsels unter Anschluß von Name und Qualifikation der in der Position nachfolgenden Person.
Die erforderlichen Qualifikationen können in einer Verordnung des BMGK näher geregelt werden.
Der Beauftragte für die biologische Sicherheit und sein(e) Stellvertreter werden für jede gentechnische Anlage (einvernehmlich) bestimmt und der örtlichen Feuerwehr bekanntgegeben. Sie müssen über einschlägige, zweijährige Praxiserfahrung verfügen und zum Betreiber in einem Dienstverhältnis stehen. Jeweils[101] einer von ihnen muß bei Arbeiten in höheren Sicherheitsstufen (im kleinen Maßstab[102]: Stufen 3 und 4; im großen Maßstab: Stufen 2-4) anwesend oder kurzfristig erreichbar[103] sein. Die wohl wichtigste Aufgabe des Beauftragten ist die regelmäßige Überwachung der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen. Mängel sind sofort dem Betreiber und dem zuständigen Projektleiter zu melden. Weitere Aufgaben sind: die Überprüfung des Notfallplans und Organisation der Mitarbeiterausbildung in Sachen Sicherheit. Außerdem muß der Beauftragte für die biologische Sicherheit schriftliche Aufzeichnungen über seine Tätigkeit führen.
Der Projektleiter ist gem § 15 für jede Arbeit mit GVO in den Sicherheitsstufen 2, 3 oder 4[104] resp für jede Arbeitsreihe (wohl einvernehmlich) zu bestellen. Unter einer Arbeitsreihe sind zusammenhängende Arbeiten mit GVO im kleinen Maßstab der Sicherheitsstufe 2 zu verstehen (§ 4 Z 4 lit a). Für bloße Lagerung oder bloßen innerbetrieblichen Transport von GVO bedarf es jedoch keines Projektleiters.
Als Qualifikation wird „ausreichende praktische Erfahrung“ mit den betreffenden Arbeiten verlangt.[105] Der Projektleiter hat die Arbeiten, für die er bestellt ist, zu planen, leiten und zu beaufsichtigen. Er schlägt dem Betreiber die Sicherheitseinstufung vor, klärt die Mitarbeiter über Risken und Sicherheitsmaßnahmen auf und sorgt für die Einhaltung der letzteren.
Wie schon oben erwähnt, ist das Ausscheiden oder der Wechsel der Person des Projektleiters unverzüglich der Behörde zu melden. Ein neuer Projektleiter ist unverzüglich zu bestellen. Mit dieser Formulierung schießt das Gesetz aber über das Ziel hinaus, denn es kann ja gerade in diesem Fall zum Ausscheiden des Projektleiters (durch Widerruf des Betreibers) kommen, für den das Gesetz gar keinen Projektleiter vorsieht (zB wenn Arbeiten mit höherer Einstufung als Stufe 1 ausgesetzt werden oder GVO nur noch gelagert werden). Es ist nicht einzusehen, daß von zwei Betreibern, die beide nur Arbeiten in der Sicherheitsstufe 1 durchführen, der eine keinen Projektleiter vorweisen muß, der andere jedoch schon, bloß weil er früher einmal für höherstufige Arbeiten einen Projektleiter bestellen mußte.
Das Komitee für biologische Sicherheit ist lt § 16 für jede gentechnische Anlage vom Betreiber einzurichten. Dies gilt nicht, wenn die Arbeiten nur in der Lagerung oder im innerbetrieblichen Transport bestehen. Das Komitee setzt sich zusammen aus dem Beauftragten für die biologische Sicherheit und (im Fall von Arbeiten ausschließlich im kleinen Maßstab) zwei weiteren Mitgliedern resp (im Fall von Arbeiten im großen Maßstab) 5 weiteren Mitgliedern. Mindestens ein resp zwei Mitglieder dürfen nicht in einem Dienstverhältnis zum Betreiber stehen; also mindestens ein Drittel der Komiteemitglieder muß von „außerhalb“ kommen. Im Falle der Arbeiten im großen Maßstab muß eines der sechs Komiteemitglieder vom Betriebsrat oder dem Dienststellenausschuß entsandt werden.
An Qualifikationen werden von jedem Mitglied „Kenntnisse[106] auf dem Gebiet des Arbeitens mit GVO“ verlangt (§ 16 Abs 3). Außerdem muß zumindest ein Mitglied Kenntnisse über Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit GVO haben, wenn auch im großen Maßstab gearbeitet wird. Die einzelnen Mitglieder sollen sich in ihren Qualifikationen dermaßen ergänzen, daß das Komitee als ganzes in der Lage ist, die anlagen- und arbeitsspezifischen Risken abzuschätzen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb2: Zusammensetzung und erforderliche Qualifikationen des Komitees für biologische Sicherheit
Das Komitee hat die vom Betreiber vorgenommene Sicherheitseinstufung geplanter gentechnischer Arbeiten zu überprüfen. Kommt es zu der Überzeugung, daß die Einstufung korrekt ist und die vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen ausreichen, gibt es die Arbeit intern frei. Weitere Arbeiten mit transgenen Pflanzen und Tieren (ausgenommen Wirbeltiere) und weitere Arbeiten des Typs A, jeweils in der Sicherheitsstufe 1 bedürfen keiner behördlichen Bewilligung[107] und können daher sofort nach der internen Freigabe durch das Komitee für biologische Sicherheit begonnen werden.
Außerdem überprüft das Komitee für biologische Sicherheit, ob biologische Sicherheitsmaßnahmen bei der geplanten Arbeit anwendbar sind.
Für diese beiden Aufgaben, Prüfung der Einstufung mit eventueller Freigabe und Prüfung der Anwendbarkeit biologischer Schranken, kommt dem Komitee Entscheidungsautonomie zu. Es ist in seinen diesbezüglichen Entscheidungen an keine Weisungen des Betreibers gebunden (§ 16 Abs 2). Ansonsten ist es, wie der Beauftragte für die biologische Sicherheit und der Projektleiter, weisungsgebunden.
Das Komitee muß über seine Prüfungshandlungen ein Protokoll führen und weiters die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ausarbeiten und diese laufend an sich ändernde Umstände anpassen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb3: Vergleich von Beauftragtem für die biologische Sicherheit, Projektleiter und Komitee für biologische Sicherheit.
2.2.5.2 – Klassifizierungen im GTG
Im GTG werden gentechnische Arbeiten in vielerlei Hinsicht unterteilt, um mit den unterschiedlichen Risikoniveaus einhergehende, ebenso abgestufte Schutzniveaus zu definieren. Diese Einteilungen und Kombinationen davon werden dazu verwendet, verschiedene Aspekte von gentechnischen Arbeiten fein differenziert zu regeln. Durch diese vielen Differenzierungen wird das Regelwerk aber etwas unübersichtlich.
Zuerst soll die Einteilung in die vier Sicherheitsstufen von Arbeiten mit GVO in GS erläutert werden.
Die Arbeiten werden entsprechend ihrem Risiko in vier Gruppen unterteilt. Sicherheitsstufe 1 werden jene Arbeiten zugeordnet, die nach Stand von Wissenschaft und Technik kein Risiko für die Sicherheit gem § 1 Z 1 erwarten lassen. Ebenso werden Arbeiten mit geringem Risiko der Stufe 2 und Arbeiten mit mäßigem Risiko der Stufe 3 zugeordnet. Arbeiten, bei denen von einem hohen Risiko oder einem begründeten Verdacht eines hohen Risikos auszugehen ist, werden der Sicherheitsstufe 4 zugeordnet.
Es stellt sich nun die Frage, wer entscheidet, welches Risiko zu erwarten ist, und was kein/geringes/mäßiges/hohes Risiko bedeutet, welche Kriterien also zur Risikobewertung herangezogen werden.
Zuerst schlägt der Projektleiter dem Betreiber eine Sicherheitseinstufung vor (§ 15 Abs 2 Z 1), dann legt dieser das Projekt dem Komitee für biologische Sicherheit vor. Dieses befindet neben anderem über die Sicherheitseinstufung. Ist es (neben anderem) mit der Einstufung einverstanden, so wird die Arbeit intern freigegeben (§ 16 Abs 4 Z 2). Nach der Befassung des Komitees für biologische Sicherheit muß in den meisten Fällen noch eine externe Freigabe abgewartet werden; die geplanten Arbeiten müssen bei der Behörde zur Anmeldung resp zur Genehmigung eingereicht werden. Die interne Freigabe ist aber weder für die Einreichung der Anmeldung oder des Genehmigungsantrags noch für die Bewilligung durch die Behörde Voraussetzung.[108] Neben der Behörde kann unter Umständen auch noch die Öffentlichkeit oder die Gentechnikkommission über die Arbeit und somit auch über ihre Sicherheitseinstufung befinden (§ 22 Abs 3).[109]
Die Einstufung gentechnischer Arbeiten erfolgt gem § 6 unter Berücksichtigung der – nicht näher definierten[110] – Zugehörigkeit der verwendeten GVO zu verschiedenen Risikogruppen. Zuerst wird also in Risikogruppen eingeteilt und dann in Sicherheitsstufen. Die Sicherheitseinstufung ist zu begründen und schriftlich festzuhalten.
Gem § 6 Abs 2 sind folgende für die Sicherheit gem § 1 Z 1 wichtige Kriterien bei der Risikoklassifikation und somit auch indirekt bei der Sicherheitseinstufung zu berücksichtigen (§ 6 Abs 2):
1. die Spender- und Empfängerorganismen (Z 1),
2. die Vektoren (das sind Moleküle, in denen die zellfremden Gene in die Zelle des Empfängerorganismus gelangen) (Z 2),
3. die eingefügten Gene (Z 3),
4. der verwendete oder hergestellte GVO (Z 4) und
5. die aus der gentechnischen Veränderung (Rekombination) resultierenden Genprodukte (Z 5).
6. Nur für die Sicherheitseinstufung, nicht für die Risikoklassifizierung ist die Effektivität allenfalls eingesetzter biologischer Sicherheitsmaßnahmen maßgeblich (§ 6 Abs 7).
Bei entsprechender Wirksamkeit angewandter biologischer Schranken (Kriterium 6), und somit erhöhter Sicherheit, ist die Einordnung in eine Sicherheitsstufe möglich, die niedriger als die entsprechende Risikogruppe ist (§ 6 Abs 7). Sonstige Einschließungs- (Containment-)Maßnahmen haben nach dem Wortlaut des § 6 keine Auswirkung auf die Sicherheitseinstufung, da Sicherheitsmaßnahmen – bis auf die biologischen – keine Kriterien für die Sicherheitseinstufung sind.
Weiters gibt es noch detaillierte Ausführungen, unter welchen Umständen ein Organismus einer Risikogruppe zuzuordnen oder nicht zuzuordnen ist.
Wie auch die S-RL gibt das GTG genau an, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein GVO in die Risikogruppe 1 eingestuft werden kann. Diese Voraussetzungen, sind jedoch bloß eine Präzisierung der ohnehin geltenden allgemeinen Kriterien zur Risikoklassifikation.
So sind GVM im kleinen Maßstab nur dann der Risikogruppe 1 zuzuordnen, wenn sie unter Berücksichtigung der Kriterien 1-3 u 6 keine pathogenen[111] Eigenschaften unter Laborbedingungen zu erwarten lassen (§ 6 Abs 3 Z 1). Bei GVM im großen Maßstab, dürfen diese Eigenschaften auch nicht unter Umweltbedingungen zu erwarten sein. Außerdem werden noch einige weitere Sicherheitsanforderungen gestellt, unter anderen die Unmöglichkeit des Transfers von neuen Resistenzgenen auf andere Mikroorganismen, wenn dies bestimmte pharmazeutisch-diagnostische Auswirkungen hätte (§ 6 Abs 3 Z 2).
Transgene Pflanzen und Tiere dürfen nur dann der Risikogruppe 1 zugeordnet werden, wenn unter Berücksichtigung der Kriterien 1-3 u 6 keine pathogenen Eigenschaften unter Laborbedingungen zu erwarten sind.
Diese Anforderung ist also sowohl an GVM im kleinen Maßstab und im großen Maßstab als auch an transgene Pflanzen und Tiere für die Einstufung in Risikoklasse 1 zu stellen. GVM im großen Maßstab müssen noch einige weitere Kriterien erfüllen.
Wer die Einstufung vorzunehmen hat, und wer darüber zu entscheiden hat wurde schon oben angeführt. Anzufügen ist aber noch, daß die Behörde von Amts wegen oder auf Antrag des Betreibers[112] die Sicherheitsstufe mittels (Feststellungs-)Bescheid festzulegen hat. Sie muß zuvor den zuständigen wissenschaftlichen Ausschuß der Gentechnikkommission anhören und die allgemein geltenden Bestimmungen des § 6 berücksichtigen.
Die Einteilung in Arbeiten im kleinen Maßstab und in Arbeiten im großen Maßstab erfolgt folgendermaßen:
Arbeiten im kleinen Maßstab sind gem § 4 Z 9 Arbeiten mit GVM unterhalb bestimmter Volumsgrenzen [113] (Sicherheitsstufe 1: bis 300 Liter Kulturvolumen, Sicherheitsstufe 2: bis 50 Liter, Sicherheitsstufen 3 u 4: bis 10 Liter) sowie Arbeiten mit anderen GVO als GVM, also mit gentechnisch veränderten Pflanzen und Tieren.
Arbeiten im großen Maßstab sind gem § 4 Z 11[114] alle anderen Arbeiten mit GVM[115]. Da Arbeiten mit gentechnisch veränderten Pflanzen und Tieren bereits dem kleinen Maßstab zugeordnet sind, bleiben nur noch Arbeiten mit GVM übrig. Davon kommen auch nur jene in Frage, die die kritischen Kulturvolumina überschreiten.
Eine weitere Einteilung ist die des § 4 Z 10 in Arbeiten des Typs A und des Typs B. Grundlegende Idee dieser Unterscheidung ist die Favorisierung gentechnischer Arbeiten zu Forschungszwecken; allerdings bloß mit GVM und das im kleinen Maßstab. Um nämlich als Arbeiten des Typs A iSd § 4 Z 10 zu gelten, müssen gentechnische Arbeiten zwei Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen
1. zu Lehr-, Forschungs-, Entwicklungszwecken oder zu nichtindustriellen oder nichtkommerziellen Zwecken dienen,
2. Arbeiten (oder Arbeitsreihen) mit GVM im kleinen Maßstab sein.
Alle anderen Arbeiten und Arbeitsreihen sind Arbeiten des Typs B. Daraus folgt, daß bei Arbeiten mit GVM im kleinen Maßstab unterschieden wird, ob gentechnische Arbeiten zu Forschungs- oder zu kommerziellen Zwecken betrieben werden. Diese Einteilung, resp die daraus folgenden Unterschiede in den Anforderungen, widerspricht der Forderung der Enquete-Kommission [116]: „Arbeiten bei gleichem Risiko in der Forschung, in der Entwicklung und in der Produktion müssen gleich behandelt werden“. Eine Auswirkung der Unterscheidung sind die unterschiedlichen Risikoeinstufungen und die daraus erwachsenden Differenzen in den Verfahren (vgl vor allem unten, Abb 5).
Weiters werden die GVO noch unterteilt in GVM, transgene Pflanzen und transgene Tiere.
Als Überblick soll folgende Darstellung dienen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb4: Übersicht unterschiedlicher Einteilungsmöglichkeiten
Außerdem ist zu unterscheiden, ob Arbeiten zum ersten Mal in einer Anlage durchgeführt werden (erstmalige Arbeiten [117] ), oder ob es sich um sog weitere Arbeiten handelt.
2.2.5.3 – Anmeldung und Genehmigung von gentechnischen Arbeiten
Welchen einzelnen Kriterien die Arbeiten zuzuordnen sind, bestimmt ihre weitere Behandlung in sämtlichen Verfahren. Die §§ 19 f regeln zB, welche gentechnischen Arbeiten der Behörde lediglich gemeldet, und für welche Arbeiten bei der Behörde um Bewilligung angesucht werden muß. Es ergibt sich folgendes Bild:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb 5: Anmelde- und Genehmigungsregime für gentechnische Arbeiten (A und B kennzeichnen den Typ, die Ziffern 1-4 die Risikoklasse der Arbeit)
Weitere Arbeiten in der Sicherheitsstufe 1 mit GVM des Typs A und mit transgenen Pflanzen und Tieren (Wirbeltiere ausgenommen) bedürfen weder einer Anmeldung noch einer Bewilligung.
Für Arbeiten des Typs A oder B, jeweils in der Sicherheitsstufe 2, muß unter Umständen nicht um Genehmigung angesucht werden. Sie müssen dann bloß angemeldet werden. Gem § 24 Abs 6 kann nämlich bei erstmaligen Arbeiten des Typs A in der Sicherheitsstufe 2 von der Genehmigungspflicht abgesehen und stattdessen eine bloße Anmeldung bei der Behörde gemacht werden, wenn der Anmeldung das Protokoll des Komitees für biologische Sicherheit mit der internen Freigabe beigelegt wird. Gleiches gilt gem § 24 Abs 7 für erstmalige und weitere Arbeiten des Typs B in der Sicherheitsstufe 2, wenn ebenfalls das Protokoll über die interne Freigabe eingereicht wird und es sich außerdem um Arbeiten zu Entwicklungszwecken handelt.
Insgesamt ist also festzuhalten, daß bloß bestimmte Arbeiten mit Mikroorganismen genehmigungspflichtig sind. In diesen Fällen handelt es sich also um ein Verbot mit Genehmigungsvorbehalt. Die restlichen Arbeiten sind anmeldepflichtig oder es bedarf nicht einmal ihrer Anmeldung.
In der S-RL sehen die Art 8-11 folgende Regelung vor:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb 6: Anmelde- und Genehmigungsregime nach der S-RL.[120] Die angeführten Gesetzesstellen sind solche der S-RL.
Wenn man nun unterstellt, daß der Gruppe I die Sicherheitsstufe 1, der Gruppe II die Sicherheitsstufen 2-4 des § 5 GTG entsprechen, so werden Abweichungen der österreichischen Rechtslage [121] von der europarechtlichen feststellbar. Die prinzipielle Regelung stimmt zwar mit der S-RL im großen und ganzen überein, die vielen Ausnahmen stellen jedoch ein Abweichen von den Vorgaben der RL dar.[122]
Der Anmeldung resp dem Genehmigungsantrag sind gem § 19 resp § 20 bestimmte Unterlagen lt Anlage 1 beizulegen. Beide sind in vierfacher Ausfertigung bei der Behörde einzureichen.
Im behördlichen Verfahren sind in manchen Fällen Anhörungen der Bevölkerung und/oder Gutachten des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses vorgesehen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb 7: Aufstellung der gentechnischen Arbeiten, die einer Anhörung resp eines Gutachtens des wissenschaftlichen Ausschusses bedürfen. Die fettgedruckten Arbeiten sind (in Abweichung von Abb 5) bloß meldepflichtig. Die unterstrichenen Arbeiten bedürfen sowohl eines Gutachtens als auch einer Anhörung.
Es wird ersichtlich, daß eine Anhörung nur für genehmigungspflichtige gentechnische Arbeiten existiert, und daß davon vor allem Arbeiten des Typs B betroffen sind. Auch ein Gutachten des wissenschaftlichen Ausschusses für Arbeiten mit GVO in GS ist fast ausschließlich für genehmigungspflichtige Arbeiten nötig. Das bedeutet nicht, daß ein Gutachen und schon gar nicht eine Anhörung für alle genehmigungspflichtigen Arbeiten vorgesehen ist.
Für Arbeiten, die nur angemeldet werden müssen, existieren verschieden lange „Stillhaltefristen“ [124] des Anmelders. So dürfen gem § 24 manche Arbeiten 90 Tage (Abs 1) nach ihrer Anmeldung, manche 60 (Abs 3) und manche 30 (Abs 2) Tage nach ihrer Anmeldung begonnen werden. Davon gibt es aber zahlreiche, die Fristen verkürzende Ausnahmen in Abs 4, die in den meisten Fällen von Amts wegen berücksichtigt werden.
Binnen der besagten Wartefristen hat die Behörde die Möglichkeit, die Arbeiten zu untersagen. Erst nach Ablauf der Frist dürfen die Arbeiten durchgeführt werden. Allerdings können die Arbeiten früher begonnen werden, wenn die Behörde dem früheren Beginn zugestimmt hat (§ 24 Abs 4 S 1).
Für Arbeiten, die genehmigt werden müssen, besteht eine einheitliche Verfahrensdauer von 90 Tagen. Auch hievon werden wieder einige Ausnahmen gemacht, insb kann die 90-Tage-Frist um 30 Tage reduziert werden, wenn eine sog „interne Freigabe“[125] vorliegt (§ 24 Abs 5)[126]. Weiters können manche genehmigungspflichtigen Arbeiten unter bestimmten Umständen wie anmeldepflichtige Arbeiten gehandhabt werden (§ 24 Abs 6 u 7). In diesen Fällen muß die Behörde bei Nichterfüllung der Voraussetzungen wie bei anderen meldepflichtigen Arbeiten einen negativen Bescheid erlassen, jedoch auch bei Erfüllung der Voraussetzungen gem § 23 Abs 1 Z 1 f muß sie – in Abweichung vom Verfahren bei meldepflichtigen Arbeiten – der angemeldeten Arbeit zustimmen (§ 24 Abs 8).
Bei all diesen Fristen werden jene Zeiten nicht berücksichtigt, in denen vom Anmelder resp Antragsteller eine Stellungnahme zu Teilergebnissen des Ermittlungsverfahrens[127] (das sind das Ergebnis der Anhörung und das des Gutachtens des wissenschaftlichen Ausschusses) oder eine Verbesserung des Antrags erwartet wird. Insofern besteht also eine Fortlaufshemmung der Fristen.[128]
Die Entscheidung der Behörde muß gem § 23 für genehmigungspflichtige Arbeiten durch einen positiven oder einen negativen Bescheid dem Antragsteller mitgeteilt werden, für meldepflichtige Arbeiten muß nur die Untersagung durch einen negativen Bescheid mitgeteilt werden. In diesen drei Fällen ist also eine Entscheidungspflicht der Behörde normiert. Die maßgebenden Kriterien sind dabei gem § 23 Abs 1 Z 1 f, daß die Vorschriften, insb im Hinblick auf die Sicherheitsausstattung der gentechnischen Anlage, vom Betreiber erfüllt werden und keine nachteiligen Folgen für Gesundheit und Umwelt zu erwarten sind.
Die Berechtigung zur Durchführung von gentechnischen Arbeiten erlischt gem § 104 Abs 1 drei Jahre[129] nach Anmeldung resp Genehmigung, wenn bis dahin die Arbeiten noch nicht aufgenommen worden sind. Es soll damit die Sicherheit gentechnischer Anlagen auf möglichst hohem Niveau gehalten werden. Sind nämlich gentechnische Arbeiten bereits angelaufen[130], so dürfen nachträgliche Auflagen (von Beschränkung bis zur Einstellung der Arbeiten und Vernichtung der GVO) zur Hintanhaltung unmittelbarer Gefahren von der Behörde unter möglichster Schonung bereits erworbener Rechte nur dann erteilt werden, wenn Umstände bekannt werden, die erhebliche Nachteile für die Sicherheit iSd § 1 Z 1 bedeuten (§ 33).[131]
Besonders erwähnenswert scheint zu sein, daß – unter Erfüllung der Voraussetzungen – der Antragsteller einen Anspruch auf Genehmigung resp der Anmelder auf (stillschweigende) Bewilligung gentechnischer Arbeiten hat. Dieser Anspruch ist auch im deutschen GenTG gegeben.
2.2.5.4 – Gentechnische Anlagen
Im behördlichen Verfahren über Anmeldungen von oder Genehmigungsanträge für gentechnische Arbeiten (§§ 19 f) werden auch die Eigenschaften der betroffenen Anlage als Entscheidungsgrundlage miteinbezogen. Kann die in Anmeldung oder Genehmigungsantrag beschriebene Anlage nicht die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen, insb der Sicherheit gewährleisten, so wird ein negativer Bescheid erlassen.
Es gibt also kein spezielles Regime für gentechnische Anlagen im GTG. Die Genehmigung der Anlage hat nach den entsprechenden Regelungen, insb der Gewerbeordnung und darauf beruhender Verordnungen zu erfolgen. Die Anlagenregelung des GTG ist nur eine indirekte, und zwar insofern, als keine gentechnischen Arbeiten möglich sind, wenn sie nicht in einer den Sicherheitserfordernissen des GTG entsprechenden Anlage stattfinden. Auch gibt es für gentechnische Anlagen keine Umweltverträglichkeitsprüfung im eigentlichen Sinn.[132] Stattdessen wird die Anlage bei jeder Bewilligung von – vor allem erstmaligen – gentechnischen Arbeiten geprüft. Bei weiteren Arbeiten werden die Anlagen erneut geprüft. Besonderes Augenmerk wird bei dieser Prüfung wohl auf die in Antrag oder Anmeldung angegebenen Änderungen der Anlage und deren Eignung zur Hintanhaltung von von den beantragten oder angemeldeten Arbeiten ausgehenden Gefahren für die Sicherheit gelegt werden.
Dieses „dynamische“ Anlagenregime scheint sinnvoller als eine herkömmliche Anlagengenehmigung zu sein. Für diese müßte man bei der Prüfung schon im vorhinein angeben, für welche gentechnische Arbeiten die Anlage genützt werden soll. So wird bei jeder neu beantragen Arbeit von der Behörde überprüft, ob die Anlage den veränderten Umständen entsprechend keine Gefahr für die Sicherheit darstellt.
In einer der europarechtlichen Vorgaben für das GTG, der Systemrichtlinie, ist der Anknüpfungspunkt bei Zulassungen ebenfalls bloß die Tätigkeit. Obwohl fast bei jeder Anmeldung resp jedem Bewilligungsantrag Unterlagen über die Anlage beizuschließen sind, ist die Anlage nicht explizit als Bewilligungskriterium genannt. Dennoch wird es schwer sein, den Zustand der gentechnischen Anlage als Einflußfaktor bei der Bewilligung zu ignorieren. Der österreichische Gesetzgeber hat daher den Einfluß der Eigenschaften der gentechnischen Anlage auf die Entscheidung der Behörde – insb über erstmalige Arbeiten – in § 23 Abs 1 Z 1 explizit normiert.
In Deutschland ist man etwas weiter gegangen. Obwohl ursprünglich wie in der S-RL ein reiner Tätigkeitsbezug vorgesehen war, setzte sich letztlich – in Anlehnung an das in Bundes-Immissionsschutzgesetz und Atomgesetz bewährte Institut der Anlagengenehmigung – ein tätigkeitsbezogenes Anlagenregime durch.[133]
Primärer Anknüpungspunkt bei der Genehmigung ist in Deutschland die gentechnische Anlage (§ 8 Abs 1 S 2 GenTG), die genehmigt wird und in der bestimmte gentechnische Arbeiten ebenfalls genehmigt werden. Es handelt sich um ein gentechnik-spezifisches Anlagenregime, das auch eine Entscheidungskonzentration beinhaltet. Es werden zugleich „Andere behördliche Entscheidungen“ (§ 22 GenTG) in diesem Verfahren berücksichtigt.
Bereits die Errichtung der (resp der Umbau zu einer) gentechnischen Anlage, nicht erst ihr Betrieb, ist genehmigungspflichtig (§ 8 Abs 1 S 2 GenTG). Da das Zulassungsregime sowohl für gentechnische Anlagen als auch für erstmalige gentechnische Arbeiten in § 8 GenTG gemeinsam geregelt wird, hat man – obwohl dies gar nicht nötig gewesen wäre, weil die S-RL eine Anlagengenehmigung nicht umfaßt, – nicht nur die Arbeiten konform mit der S-RL (Art 9 Abs 1 iVm Art 11 Abs 4 1. SpStr), sondern auch die Anlagen lediglich bloß einem Anmeldungsregime unterworfen.
Das „dynamische“ österreichische Anlagenregimge weist auch Nachteile auf. Einen mag man zB darin sehen, daß manchmal unnötig hohe Kosten entstehen können. Meldet beispielsweise ein Betreiber einer gentechnischen Anlage kurz hintereinander zwei Arbeiten mit GVO in ein und derselben Anlage an, so muß er nach dem case-by-case-Prinzip weitere Gutachten und erneut eine Prüfung seiner Anlage über sich ergehen lassen. Hier wäre wohl eine gewisse Frist wünschenswert, innerhalb derer für weitere Anmeldungen die letzte gültige Bewertung einer Anlage herangezogen werden kann.
Zu bedenken ist, daß es in Österreich keine spezifischen Richtlinien zur Bewertung der Sicherheit von gentechnischen Anlagen gibt.
2.2.6 – Genanalyse und Gentherapie am Menschen (§§ 64-79)
Es sollen unter diesem Punkt nur kurz auf die Regelung dieser Thematik im GTG eingegangen und die Möglichkeiten in der Humanmedizin aufgezeigt werden.
2.2.6.1 – Somatische Gentherapie
Die Gentechnik als Instrument der Medizin – allerdings nur im Bereich der Pharmakologie – ist relativ unbestritten. Sobald der Mensch direkt mittels Gentechnik, also nicht über den Umweg von Medikamenten, behandelt werden soll, erheben sich ethische Bedenken. Die Rede ist hier von der somatischen Gentherapie am Menschen[134]. Sie ist in § 4 Z 24 definiert: „Übertragung isolierter Gene oder Genabschnitte auf somatische Zellen“. Zumeist werden dabei körpereigene Zellen mit einem Gendefekt entnommen, diesen wird mit Hilfe eines sog Retrovirus[135] das gesunde Gen (Wildallel) eingepflanzt. Die behandelten Zellen werden dann wieder in den Körper eingebracht („rückinfundiert“).[136] Die Zellen mit dem gesunden Gen sollten jene mit dem defekten Gen verdrängen, da sie – zB infolge eines besseren Energiehaushaltes – üblicherweise besser wachsen. Der Anwendungsbereich der somatischen Gentherapie sind vor allem vererbbare[137] Krankheiten und Krebserkrankungen.
Die somatische Gentherapie heißt deswegen „somatisch“, weil nur die Somazellen, also die Körperzellen betroffen sind. Das Verbot eines Eingriffs in menschliche Keimzellen (sog „generativen Gentherapie“), wird gleich zu Beginn des IV. Abschnittes des GTG vorweggenommen, indem auf § 9 Abs 2 Fortpflanzungsmedizingesetz verwiesen wird (§ 64). Veränderungen des Erbmaterials von Körperzellen werden nachfolgenden Generationen nicht vererbt, Veränderungen des Erbmaterials von Keimzellen schon.
Die somatische Gentherapie ist gem § 74 nur zum Zweck der Therapie oder der Verhütung schwerwiegender Erkrankungen des Menschen (Abs 1) oder zu Forschungszwecken (Abs 2) zulässig. Dabei muß nach dem Stand von Wissenschaft und Technik eine Veränderung des Erbmaterials der Keimbahn ausgeschlossen werden können. Kann eine Veränderung des Erbmaterials der Keimbahn nicht völlig ausgeschlossen werden, so ist eine Gentherapie nur dann durchzuführen, wenn die Vorteile des zu Behandelnden dieses Risiko überwiegen und der zu Behandelnde mit Sicherheit keine Nachkommen haben kann. Auch ist die Verwendung von Keimzellen solcherart Behandelter zur Herstellung von Embryonen verboten.[138]
Durchgeführt werden darf eine somatische Gentherapie nur von einem Arzt in einer für somatische Gentherapien zugelassenen Krankenanstalt. Die Zulassung der Krankenanstalt ist vom ärztlichen Leiter beim BMGK zu beantragen. Die Gentherapie an sich bedarf keiner behördlichen Genehmigung oder Anmeldung.
Da ein mit somatischer Gentherapie behandelter Mensch nicht als GVO gilt (§ 4 Z 24 letzter S), sind gem § 78 die Vorschriften über Arbeiten mit GVO im GS (II. Abschnitt) und über Freisetzung und Inverkehrbringen (III. Abschnitt) nicht auf die Durchführung einer somatische Gentherapie anzuwenden. Ansonsten wäre nämlich für die Entlassung einer mit somatischer Gentherapie behandelter Person eine Freisetzungsgenehmigung notwendig[139], wie dies zB in Großbritannien bis April 1996[140] der Fall war.
2.2.6.2 – Genanalyse
Die Genanalyse dient vor allem der Feststellung von defekten Genen. Gegebenenfalls werden durch sie Mutationen nachgewiesen. Eine Genanalyse ist nur dann sinnvoll, wenn die Neigung zu monogenen (also durch ein Gen hervorgerufenen) Krankheiten untersucht werden soll. Einerseits können solche Analysen helfen, das Risiko der Weitergabe von Erbkrankheiten auszuloten, sei es durch „Genetische Beratung“ der zukünftigen Eltern oder eventuell auch durch pränatale Diagnose. Andererseits kann mit Genanalysen auch die Wahrscheinlichkeit eruiert werden, mit der bei der untersuchten Person eine Krankheit auftreten wird. In diesem zweiten Fall stellt sich aber das Problem, daß solche Krankheiten oft multifaktoriell bedingt sind, daß also das Auftreten der Krankheit nicht nur von einem Gen bestimmt wird und auch von Umwelteinflüssen abhängt. In diesen Fällen sind die Aussagen der Genanalyse mit ganz besonderer Vorsicht zu genießen. Generell muß bedacht werden, daß die Ergebnisse von Genanalysen ausführlich mit den Untersuchten besprochen werden müssen. Dazu bedarf es besonders qualifizierter Kräfte, denn „[f]alsche Interpretationen von Analyseergebnissen könnten […] beträchtlichen Schaden anrichten“[141].
Im GTG wird auch bei der Genanalyse zwischen der Genanalyse zu medizinischen Zwecken und der zu wissenschaftlichen und Ausbildungszwecken unterschieden. Genanalysen zu anderen Zwecken sind – bis auf zwei Ausnahmen (§ 67) – im GTG nicht geregelt.
Bei den Genanalysen zu medizinischen Zwecken wird wiederum unterschieden zwischen 1. solchen zur Feststellung einer Prädisposition oder eines Überträgerstatus für eine Krankheit[142] und 2. solchen, die vor allem zur Diagnose einer manifesten Erkrankung oder zur Vorbereitung oder Kontrolle einer Therapie dienen.
Genanalysen zu medizinischen Zwecken dürfen nur auf Veranlassung eines Arztes durchgeführt werden, nachdem die Patienten über „Wesen, Tragweite und Aussagekraft der Genanalyse“ (§ 65 Abs 2) aufgeklärt worden sind. Bei der ersten Gruppe von Genanalysen zu medizinischen Zwecken bedarf es zusätzlich einer schriftlichen Bestätigung über diese Aufklärung und einer schriftlichen Zustimmung der zu untersuchenden Person[143].
Genanalysen zu wissenschaftlichen und Ausbildungszwecken dürfen nur an anonymisierten Proben oder mit ausdrücklicher, schriftlichen Zustimmung des Probenspenders durchgeführt werden (§ 66 Abs 1). Die Ergebnisse aus den Analysen dürfen – unter Wahrung der Anonymität[144] – veröffentlicht werden (§ 66 Abs 2).
Wie Einrichtungen zur Durchführung von somatischen Gentherapien bedürfen auch Einrichtungen zur Durchführung von Genanalysen zu medizinischen Zwecken der ersten Gruppe (zur Feststellung einer Prädisposition oder eines Überträgerstatus für eine Krankheit) einer Zulassung [145]. Diese ist vom Leiter der Einrichtung beim BMGK zu beantragen (§ 68). Ebenso wie die einzelne Gentherapie bedarf auch die einzelne Genanalyse keiner behördlichen Genehmigung oder Anmeldung. Der Leiter muß allerdings seiner in § 73 normierten Meldepflicht nachkommen und alle zwei Jahre mittels Formblatt gem Anlage 2 der Behörde über alle durchgeführten Genanalysen berichten.[146]
Ergebnisse von Genanalysen dürfen von Arbeitgebern und Versicherern resp deren Gehilfen dem Arbeitnehmer oder -suchenden oder Versicherungsnehmer oder -werber nicht abverlangt werden, sie dürfen auch nicht von ihnen erhoben[147] oder verwertet werden[148]. Die Ergebnisse dürfen nicht einmal angenommen werden. Mit diesem Annahmeverbot soll verhindert werden, daß (potentielle) Arbeit- und Versicherungsnehmer sozusagen „freiwillig“ die Ergebnisse ihrer Genanalyse offenlegen oder sich gar einer solchen unterziehen. Ein Verstoß und auch der Versuch eines Verstoßes gegen diese Bestimmung stellt eine Verwaltungsübertretung dar, die – ungeachtet anderer Bestimmungen – mit bis zu öS 500.000,– zu bestrafen ist (§ 109 Abs 1).
Derart ethisch umstrittene Bereiche erfordern auch besonderen Datenschutz. Dem wird in § 71 Rechnung getragen. Insb dürfen die Daten nur unmittelbar involviertem medizinischen Personal weitergegeben werden. Andere als diese Personen[149] können die Daten nur erhalten, wenn die untersuchte Person (oder ihr gesetzlicher Vertreter) ausdrücklich und schriftlich zustimmt (§ 71 Abs 1 Z 4). Außerdem müssen die Daten vor dem Zugriff Unbefugter geschützt werden.
Ein noch nicht befriedigend gelöstes Problem bei der Genanalyse ist das der „Modernen Eugenik “. Es wird als ethisch bedenklich angesehen, daß Daten der Genanalyse in die Überlegungen einfließen, ein Kind abzutreiben, weil es früher oder später sicher oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an einer schweren Krankheit leiden wird.[150] Als Argument gegen die Befürchtungen einer neuen Eugenik wird angeführt, daß sie „aus populationsgenetischen nicht zu befürchten“ sei. So müßten zur Verringerung der Zahl der Genträger einer Erbkrankheit wie zB des Albinismus[151] auf die Hälfte über rund 30 Generationen hinweg die Kranken von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden.[152]
2.2.7 – Exkurs: Forschungsfreiheit und Grundrechte
Insbesondere in der Humangenetik, aber auch in anderen Bereichen der Gentechnologie gerät die Forschung in Konflikt mit Grundrechten. Da durch das GTG – trotz der Forderung nach verfassungsrechtlicher Verankerung der Menschenwürde[153] – keine diesbezügliche Klarstellung erfolgte, ist dieser Bereich nach wie vor etwas problematisch. Es sei allerdings angemerkt, daß vor einer allzu häufigen Berufung auf das Menschenwürdeargument gewarnt wird.[154]
Art 17 Abs 1 Staatsgrundgesetz (StGG) normiert die Freiheit von Wissenschaft und Lehre. Zwar wird die Forschung in Art 17 Abs 1 StGG nicht namentlich erwähnt, es ist jedoch mittlerweile unumstritten, „daß die gesamte Forschungstätigkeit auf dem Gebiete der Gentechnologie […] grundsätzlich in den Schutzbereich des Art 17 StGG fällt“[155], so daß man von einer „Forschungsfreiheit“ sprechen kann.
Art 17 Abs 1 StGG sieht keinen Gesetzesvorbehalt vor, der dieses Grundrecht relativieren könnte, wie dies etwa bei der Unverletzlichkeit des Eigentums der Fall ist. Demnach sind jedes Gesetz und jeder Verwaltungsakt, welche diese Freiheit inhaltlich einschränken, prinzipiell verfassungswidrig.[156]
Eine Einschränkung der Forschungsfreiheit liegt bereits dann vor, wenn bestimmte Bewilligungspflichten für bestimmte Arbeiten bestehen, bestimmte behördliche Überwachungsrechte normiert werden etc.[157]
Bereits Ende der 1949 hatte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) für solche Grundrechte, die durch keine Gesetzesvorbehalte relativiert sind, „ immanente Schranken “ festgestellt.[158] Demnach ist eine Beeinträchtigung der Forschungsfreiheit aus allgemeinen Gründen (zB strafrechtlicher Natur oder aus Gründen des Gesundheitsschutzes) nicht verfassungswidrig. Diese Auslegung wurde etwa dreißig Jahre später bestätigt.[159] Zwar darf demzufolge ein Gesetz gezielt auf einen bestimmten Bereich – wie etwa die Gentechnologie – blickend die Forschung nicht beschränken oder gar verbieten. Es ist jedoch verfassungskonform, das Recht auf Freiheit der Forschung mittels allgemeiner Gesetze (mit relevanter Begründung) zu beschränken. Mit dieser sog „Intentionaltheorie“[160] war die Forschungsfreiheit sozusagen dem Wohlwollen des Gesetzgebers ausgeliefert und quasi wertlos.[161]
In den 80er-Jahren war jedoch durch zwei Erkenntnisse[162] eine Trendwende zu erkennen. Obwohl sich das spätere Erkenntnis vom 7. 12. 1987 auf Art 17a StGG, also die Freiheit der Kunst bezog, ist eine Übertragbarkeit dieser Rechtsauffassung auf Art 17 StGG als wahrscheinlich anzunehmen.[163] Demgemäß wäre sowohl bei spezifisch auf die Beschränkung der Forschungsfreiheit zielenden Gesetzen als auch bei allgemeinen, die Forschungsfreiheit beschränkenden Gesetzen eine Güterabwägung vorzunehmen.
Allgemeine Gesetze, die die Forschungsfreiheit einschränken, sind daher nicht prinzipiell verfassungskonform, es muß vielmehr abgewogen werden, welchem Schutzgut – Freiheit der Wissenschaft oder Schutzgut des diese Freiheit einschränkenden Gesetzes – der Vorzug zu geben ist. Dafür können aber auch spezifisch auf die Beschränkung der Forschungsfreiheit abzielende Gesetze verfassungskonform sein, wenn sie andere, höherrangige Rechtsgüter schützen sollen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb8: Kriterienwechsel bei der Beurteilung der Verfassungskonformität von Einschränkungen der Forschungsfreiheit
Im Rahmen der Güterabwägung ist jedoch zu beachten, daß Einschränkungen der Grundrechte nur dann als verfassungskonform zu werten sind, wenn sie der Verhälnismäßigkeit Rechnung tragen. So sollen Verbote nur dann zum Einsatz kommen, wenn „nicht wiedergutzumachende Nachteile für andere Verfassungsrechtsgüter“[164] zu befürchten sind. Je größer das Risiko einer Beeinträchtigung anderer verfassungsrechtlicher Schutzgüter ist, desto schwerwiegendere Eingriffe in die Forschungsfreiheit sollen möglich sein. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit soll hier also in Form einer „risikoproportionalen Eingriffsintensität“ zur Geltung kommen. Damit sind zugleich Experten der Gentechnologie aufgerufen, die potentiellen Risken, die mit der Gentechnologie in Zusammenhang stehen, festzustellen und zu bewerten.
Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, und das ist kein Spezifikum der Gentechnologie, daß Wissenschaftler sich – zumindest indirekt – selbst kontrollieren,[165] und die gesetzlichen Technikregelungen, auch die der Gentechnologie, der Entwicklung der Technik im Regelfall ein gutes Stück nachhinken.
In vielen EU-Ländern wird – soweit das die einschlägigen RL der EU zulassen – nach wie vor großer Wert auf die Selbstreglementierung gelegt. Fairerweise sei dazu gesagt, daß ohne diese auch keine effektiven gesetzlichen Regelungen geschaffen werden könnten, weil Gentechniker – wie oben erwähnt – unausweichlich in den Entstehungsprozeß von Gesetzen eingebunden sind.
Noch ein Aspekt zur Forschungsfreiheit: Es ist darauf zu achten, daß auch die Patentgesetzgebung die Forschungsfreiheit nicht zu sehr einschränkt. Obwohl Patentgesetze oft Ausnahmebestimmungen für die Forschung aufweisen, ist es zu vermeiden, „daß bloß theoretische Erkenntnisse, die noch keine technische Umsetzung erlauben, die erst Vorstufen einer technischen Anwendung sind“[166] unter Patentschutz gestellt werden können.
Grundrechte gelten – historisch bedingt – vor allem[167] als Abwehrrechte gegenüber dem Staat. In letzter Zeit entstehen aber immer wieder Diskussionen, ob das staatsgerichtete Wesen der Grundrechte in bestimmten Fällen nicht besser zugunsten einer Wirkung gegen Dritte verworfen werden soll. Daß also Grundrechte auch inter privatos – etwa gegenüber einem Monopolisten – gelten sollen oder gar der Gesetzgeber diese Grundrechte gewährleisten soll.[168]
Die eben angesprochene Drittwirkung existiert bereits im Falle des § 1 Abs 6 Datenschutzgesetz. Ebenso ist nicht nur ein passives Akzeptieren der Grundrechte, sondern auch die Pflicht zu deren aktiven Gewährleistung (etwa durch Bestimmungen wie § 1 Abs 6 Datenschutzgesetz) denkbar. So ein „ Gesetzgebungsauftrag “ ist jedoch mit Einschränkungen zu betrachten. Es kann der Gesetzgeber de lege lata nicht zur Erlassung von Grundrechten vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) gezwungen werden. Er kann nur – im Wege der Gesetzesprüfung – dazu angehalten werden, bestehende Gesetze grundrechtskonform zu gestalten.[169] Dem steht allerdings die Europäische Menschenrechtskonvention entgegen, welche die Unterzeichnerstaaten völkerrechtlich dazu verpflichtet, bestimmte Grundrechte innerstaatlich zu garantieren, also einen Gesetzgebungsauftrag enthält.
Dem Bundesverfassungsgesetz über den umfassenden Umweltschutz (BGBl 1984/491, BVGuU)[170], in dem sich die Republik Österreich zum umfassenden Umweltschutz bekennt, wurde bald mehr als nur politische Apellfunktion zugeschrieben. 1987 sprach der VfGH vom Umweltschutz als Staatsaufgabe [171], 1988 vom durch das BVGuU bestimmten „Staatsziel eines – im weiten Sinn verstandenen – Umweltschutzes“[172] und 1989 erneut vom Umweltschutz als Staatsziel [173]. Die Konsequenz der in Rede stehenden VfGH-Erkenntnisse ist, daß in Zukunft wahrscheinlich das BVGuU als Rechtsgrundlage für Eingriffe in Grundrechte generell geeignet sein kann, und zwar deswegen, weil es selbst ein gegen andere Schutzgüter abzuwägendes, verfassungsrechtlich geschütztes Rechtsgut beinhaltet.[174] Daneben kommt das BVGuU als Kriterium im Gesetzesprüfungsverfahren in Betracht; widerspricht ein einfaches Gesetz dem BVGuU, so kann es der VfGH aufheben.[175]
3. Kapitel – Freisetzung und Inverkehrbringen von GVO
3.1 – Freisetzungvon GVO (§§ 36-53)
3.1.1 – Geschichte der Freisetzung
10 Jahre nach der ersten Freisetzung von GVO (1986[176] ) wurden bereits über 3.000[177] Freisetzungen durchgeführt. Einer der bekanntesten Freisetzungsversuche war jener des sog Ice-minus-Bakteriums (transgenes Pseudomonas syringiae-Bakterium), durch dessen Einsatz Pflanzen erst unterhalb von -4° C gefrieren.[178] Es wurden viele Erfahrungen gesammelt, jedoch sind zehn Jahre für die Beurteilung ökologischer Langzeitwirkungen relativ kurz.
10 Jahre nach der ersten Freisetzung waren auch in Österreich die ersten Freisetzungen geplant: Die Firma AgrEvo, hinter der die beiden Konzerne Hoechst und Schering stehen[179], beantragte die Freisetzung von transgenem Mais, der herbizidresistent gegen das Totalherbizid „ Basta “ von der Firma Hoechst[180] ist. Das Forschungszentrum Seibersdorf erzeugte Erdäpfel, die dank eingepflanzten Fäulnisresistenzgenen von Seidenmotten längere Zeit gelagert werde konnten als konventionelle Erdäpfel[181]. Schließlich der wohl bekannteste der Anträge, der der Firma Zuckerforschung Tulln GmbH, welchem zufolge rekombinante Industrieerdäpfel ausgesetzt werden sollten, bei denen ein Bestandteil nicht mehr produziert werden sollte, weil er bei der Stärkeherstellung sonst mit chemischem Aufwand herausgefiltert werden hätte müssen.[182]
Bevor auch nur einer dieser drei Anträge bewilligt wurde, hatte die Firma Zuckerforschung Tulln am 2. Mai 1996[183] ihre Erdäpfel in Absdorf bereits freigesetzt. Man sollte dabei bedenken, daß die Behörde (BMGK) mit ihrem Bescheid säumig war, was sich wohl darauf zurückführen läßt, daß die zuständigen Experten noch keine Erfahrung mit Freisetzungsanträgen hatten.[184] Die Überziehung der 90 Tagesfrist widerspricht den Intentionen des GTG. In den Erl RV (Allgemeiner Teil, 1.) wird angeführt, daß ökonomische Interessen nicht durch die Dauer der Verwaltungsverfahren behindert werden sollten. Damit wollte man sich besonders vom deutschen GenTG abheben, das als zu bürokratisch galt. Durch diese Verzögerung wäre wohl der spätest mögliche Termin der Freisetzung der Erdäpfel verpaßt worden.[185]
Als dies Mitte Mai publik wurde, entwickelte sich die Angelegenheit zum „Skandal“, der zu einem generellen Freisetzungsverbot, einem von Ministerin Krammer am 14. Mai 1996 [186] verhängten Freisetzungsmoratorium führte.
Diesem Moratorium zufolge soll es bis auf weiteres – genannt wurde eine Frist von zwei Jahren – keine Bewilligungen auf Freisetzungsanträge mehr geben. Krammer wollte damit „eine Diskussionsphase in Gang bringen, um einen gesellschaftspolitischen Konsens zur Gentechnik erreichen“[187] – nicht nur mit Bezug auf Freisetzungen, sondern viel mehr auch im Hinblick auf die spätere Anwendungen. Während die medizinische Anwendung der Gentechnik in weiten Bereichen akzeptiert seien, gelte dies nicht für den Einsatz in der Landwirtschaft und schon gar nicht bei Lebensmitteln.
Damit lag die Ministerin ziemlich richtig: Sofort nach Verhängung des Moratoriums wurde eine bundesweite Umfrage bei knapp 1.600 Österreichern von der Firma Ökonsult durchgeführt (14.-20. Mai 1996). Demnach stimmen drei Viertel der Befragten dem Moratorium voll und ganz zu und fühlen sich rund zwei Drittel über die Gentechnik insgesamt eher schlecht bis überhaupt nicht informiert. Weit über die Hälfte hätte Bedenken, gentechnisch veränderte Lebensmittel zu essen, über 97% fordern eine klare Kennzeichnung genmanipulierter Lebensmittel, zugleich sind über zwei Drittel für den Einsatz der Gentechnik in der Pharmazie. Über zwei Drittel sind für eine sog „gentechnik-freie Zone Österreich“ und befürworten den Verzicht auf Freisetzung und Einsatz gentechnisch veränderter Tiere, Pflanzen oder Lebensmittel. Außerdem treten rund zwei Drittel der Befragten für ein Volksbegehren resp sogar für eine Volksabstimmung zur Gentechnikfrage ein.
Auf Grund dieses Moratoriums wurden alle drei Anträge abgelehnt, resp wurde der Antrag der AgrEvo – der Ablehnung zuvorkommend – zurückgezogen. Im Falle des Antrags des Forschungszentrums Seibersdorf kam das den Staat nicht gerade billig. BMWVK und BMGK haben diese Sicherheitsforschung (es sollte der Gentransfer erforscht werden) in Auftrag gegeben und rund drei Millionen Schilling dafür zur Verfügung gestellt.[188]
Die Firma Zuckerforschung Tulln plante, im Herbst einen neuen Antrag auf Freisetzung einzureichen. Es wurde den Vertretern der Firma aber seitens des Ministeriums geraten, den Antrag im Ausland zu stellen.[189]
Mittlerweile wird ein „ Gentechnik-Volksbegehren “ geplant und es ist eine Anti-Gentechnik-Kampagne angelaufen. Es ist nicht zu übersehen, daß die Gentechnik zur Zeit das wichtigste umweltpolitische Thema ist, das massiv bearbeitet werden muß und momentan auch wird.
3.1.2 – Exkurs: „Freisetzungsmoratorium“
Das Moratorium bedeutet, wie bereits oben erwähnt, daß vorläufig keine Freisetzungen genehmigt werden. Dieser Aufschub oder besser diese Nachdenkpause bezieht sich nicht überhaupt auf Entscheidungen der Behörde, schließlich trifft diese ja eine Entscheidungspflicht (§ 40 Abs 1). Vielmehr ist damit gemeint, daß bis auf weiteres alle Anträge abgelehnt werden. Inwieweit dies gesetzeskonform ist, soll im folgenden erörtert werden.
Die rechtliche Deckung des Moratoriums sieht das BMGK durch § 40 Abs 1 Z 2 als gegeben an.[190] Nach dieser Bestimmung muß die Behörde vor der Erlassung eines Genehmigungsbescheides feststellen, ob nachteilige Folgen für die Sicherheit gem § 1 Z 1 nicht zu erwarten sind. Das Ministerium stellt sich nun auf den Standpunkt, daß dies momentan nicht garantiert werden kann.[191] Dies kann aber nicht der Sinn des GTG sein, das als Zulassungsgesetz und nicht als Verbotsgesetz zu werten ist.[192] Es macht kaum Sinn – insb unter dem Aspekt der Rechtssicherheit –, detaillierte Regeln zu erlassen, die dann nicht zur Anwendung kommen. Weiters ist darauf hinzuweisen, daß der Antragsteller ein Recht auf Genehmigung hat, wenn er die Voraussetzungen des § 40 Abs 1 Z 1 f erfüllt[193].
Die Tatbestandsvoraussetzung des § 40 Abs 1 Z 2 ist interessant konstruiert: Die Genehmigung ist zu erteilen – Erfüllung auch der Voraussetzung der Z 1 vorausgesetzt –, wenn „gewährleistet ist, daß die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik notwendigen Vorkehrungen getroffen sind und deshalb [Hervorhebung durch den Verfasser] nachteilige Folgen für die Sicherheit (§ 1 Z 1) nicht zu erwarten sind“.[194]
Es wird aus dieser Formulierung ersichtlich, daß es als eine logische Konsequenz der notwendigen Vorkehrungen angesehen wird, daß keine nachteiligen Folgen für die Sicherheit zu erwarten sind. Es stellt sich nun die Frage, was „die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik notwendigen Vorkehrungen“ sind. Sind damit bloß mit dem heutigen Wissen machbare Vorkehrungen gemeint, oder sind damit auch Vorkehrungen gemeint, die noch nicht realisierbar sind, aber zur Hintanhaltung bereits bekannter Gefahren notwendig wären? Im Sinne einer Wortinterpretation vertritt das BMGK offensichtlich letztere Auffassung. Es wird die Nicht-Erwartbarkeit von Folgen für die Sicherheit als Kriterium für die Wahl der Vorkehrungen eingesetzt. Abstrakt formuliert wird die Konsequenz der vorangehenden Bedingung dieser Bedingung wiederum vorangestellt. So wird die Konsequenz zur Bedingung ihrer selbst erhoben. Demnach ist die Sicherheit zugleich Bedingung der Maßnahmenwahl und Folge derselben.
Diese etwas verwirrende Deutung läßt sich auch mit den Zielen des Gesetzes vereinbaren. Primär ist der Schutz von Mensch und Umwelt intendiert.[195] Das zweite Ziel, die Förderung der Anwendung der Gentechnik, gilt nur unter dem Vorbehalt, daß diese zum Wohle des Menschen ist.
Wenn man davon ausgeht, daß die Ausdrucksweise des Gesetzgebers zweifelhaft ist, kann man noch nach dem Willen des Gesetzgebers forschen.[196] Die Erl RV zu § 40 helfen dabei kaum weiter, wohl aber jene zu § 1. Hier wird der Schutz des Menschen als das vorrangige Ziel definiert. Die Förderung der Anwendung der Gentechnik ist bloß ein weiteres Ziel.
Bei Betrachtung des § 40 Abs 1 ist ein Moratorium „bis auf weiteres“ gerechtfertigt. In dem Moment jedoch, in dem Wissenschaft und Forschung so weit fortgeschritten sind, daß sie die der Wissenschaft bis dato bekannten Sicherheitsrisken (nach Auffassung des BMGK: zur Gänze) beseitigen können, ist das Moratorium hinfällig. Es sei darauf hingewiesen, daß ein auf bestimmte Dauer verhängtes Moratorium jedenfalls dem Gesetz widerspräche, weil die Behörde unter bestimmten Voraussetzungen zur Bewilligung einer Freisetzung verpflichtet ist (§ 40 Abs 1 S 2). Die Behörde muß schließlich von Fall zu Fall entscheiden, sie muß den Einzelfall beurteilen und kann nicht im vorhinein ohne Prüfung des Antrags entscheiden. Ein Moratorium kann also nur unter der obengenannten Resolutivbedingung gelten.
Gem Art 4 Abs 1 FS-RL haben die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen, „daß alle geeigneten Maßnahmen getroffen werden, damit die absichtliche Freisetzung oder das Inverkehrbringen von GVO keine Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zur Folge hat“. Auch im Europarecht will man keine (noch so geringe) Gefährdung der Gesundheit zulassen[197]. Demnach ist die restriktive Auslegung des GTG durch das BMGK richtlinienkonform, kann aber einen gewissen Hauch von Willkür nicht verleugnen.
Konzentriert man sich nämlich nicht nur auf § 40 Abs 1 Z 2, sondern vergleicht die Bestimmungen des § 40 Abs 1 Z 1 f mit denen des § 23 Abs 1 Z 1 f, so sieht man, daß diese praktisch identisch sind. Dazu ist zu sagen, daß auf Grund dieser zu § 40 analogen Bestimmung nach wie vor gentechnische Arbeiten genehmigt werden, obwohl dies dem im Mai 1996 dokumentierten Verständnis der Bestimmung widerspricht. Es drängt sich nun die Frage auf, wie man zwei gegenläufige Interpretationen quasi ein und derselben Regelung seitens des Ministeriums rechtzufertigen gedenkt.[198]
Ein weiteres gewichtiges Argument gegen das Freisetzungsmoratorium ist die dadurch bewirkte Verletzung der Forschungsfreiheit.[199]
Die Reaktionen im Zuge des „Absdorf-Skandals“ und des Freisetzungsmoratoriums waren sehr unterschiedlich und heftig. Es wurde viel gefordert und viel diskutiert. Die Ablehnung war die erste seit mindestens zweieinhalb Jahren in Europa[200], das ist in Anbetracht der 215 Anträge im Jahr 1995[201] und der 200 Anträge im ersten Halbjahr 1996[202] bemerkenswert.
Mancherorts wurde ein fünfjähriges Moratorium gefordert, oder gar eine „ Gentechnikfreie Zone Österreich “ verlangt. Dadurch würden die Zukunftschancen Österreichs als „Feinkostladen Europas“ erhöht. Es wurden Vergleiche mit dem deutschen Reinheitsgebot beim Bierbrauen aufgestellt.[203] Bei entsprechender Rigorosität – auch bei Importen[204] – könnte die Gewißheit entstehen, daß Lebensmittel aus Österreich garantiert gentechnikfrei sind. Außerdem könnten Biobauern nicht sehr glaubwürdig wirken, wenn am benachbarten Acker gentechnisch verändertes Saatgut sprieße.[205]
Einerseits wurde die von Ministerin Krammer angeregte Diskussion begrüßt, andererseits wurde auch zu recht gefragt, warum die Diskussion erst jetzt in Gang gebracht worden sei und nicht in den Jahren der Vorbereitung des GTG. Fairerweise muß dazu aber gesagt werden, daß damals das Thema Gentechnologie den wenigsten geläufig war, was man aber als Anlaß nehmen hätte sollen, Informationen über diese Wissenschaft und die ihr innewohnenden Chancen und Risken zu forcieren. Auch heute wird die Diskussion zum großen Teil polemisch geführt, was sicher nicht im Dienste der Gentechnologie, aber auch nicht der Bevölkerung ist. Es wäre angebracht, so rasch wie möglich für ein faires und objektives Forum zu sorgen, damit die Bevölkerung bei dem bevorstehenden Volksbegehren wohl informiert und rational statt aus dem Bauch heraus entscheiden kann.
Während die einen eine Abkoppelung befürchten[206] – einmal ins Hintertreffen geraten, läßt sich der Rückstand kaum mehr aufholen[207] –, erwarten die anderen, daß Österreich einmal mehr die Vorreiterrolle spielt.
Wenn erst Erfahrungen bezüglich Freisetzung gesammelt werden sollen, bevor man Freisetzungen genehmigt, stellt sich die berechtigte Frage, wie denn diese Erfahrungen gesammelt werden sollen, dies geschieht nämlich am besten durch kontrollierte Freisetzungen selbst.[208]
Ebenso gegen das Moratorium ist das Argument gerichtet, das sich auf die Forschungsfreiheit beruft.[209]
3.1.3 – Gesetzliche Regelung der Freisetzung
Lt GTG ist Freisetzung das absichtliche Ausbringen von GVO oder Kombinationen von GVO (§ 4 Z 20), sofern für deren Inverkehrbringen noch keine Genehmigung erteilt wurde. Die FS-RL spricht von Haus aus von „ Absichtliche [r] Freisetzung “ (Art 2 Z 3 FS-RL [Hervorhebung durch den Verfasser]). Wesentlich für das Gesetz ist also, daß die GVO absichtlich, oder wie es die Erl RV zu § 4 Z 19 formulieren, „gezielt [¼] ins Freiland entlassen werden“. Andernfalls würde es sich um einen Unfall (§ 4 Z 12 f) handeln, wenn dabei die Sicherheit gefährdet wird.[210]
War schon das Arbeiten mit GVO nur dann ein solches, wenn es noch keine Genehmigung für Freisetzung oder Inverkehrbringen gab, so ist auch die Freisetzung nur dann eine, wenn es für die freizusetzenden GVO noch keine Genehmigung zum Inverkehrbringen gibt. Das bedeutet, daß die Genehmigung des Inverkehrbringens eine Genehmigung für das Freisetzen in sich einschließt, und somit auch die Genehmigung für Arbeiten im GS, sofern dafür nicht eine eigene Anlagenprüfung nötig sein sollte.
3.1.3.1 – Genehmigungsverfahren
Im Gegensatz zu den Arbeiten im GS, die nicht so risikobehaftet sind, sind Freisetzungen ausnahmslos genehmigungspflichtig (§ 37 Abs 1). Der für den Antrag erforderliche Inhalt ist in § 37 geregelt. Anforderungen an Inhalt, Umfang und Form des Antrages können per Verordnung des BMGK gem § 38 festgelegt werden.
Gleich vorweg ist festzuhalten, daß der Antragsteller ein Recht auf Genehmigung der Freisetzung hat, wenn er die vorgesehenen Auflagen erfüllt.[211] Dasselbe gilt auch für das Inverkehrbringungsverfahren. Auch im GenTG ist das recht auf Genehmigung durch die Behörde normiert. In der S-RL und der FS-RL ist ein solcher Anspruch nicht normiert, obwohl man bei Betrachtung letzterer geneigt sein mag, einen solchen anzunehmen (Art 6 Abs 2).[212]
Die Behörde hat nach Erhalt des Antrags binnen 90 Tagen über den Freisetzungsantrag zu entscheiden.[213] Der Behörde wird hier wiederum eine Entscheidungspflicht auferlegt (§ 40 Abs 1). Wird vom Antragsteller eine Stellungnahme oder eine Verbesserung des Antrags verlangt, so wird der Fortlauf der Frist gehemmt.[214]
Binnen 30 Tagen ab Einlangen des Antrags auf Genehmigung der Freisetzung muß der BMGK der EU-Kommission[215] eine Zusammenfassung des Antrags übermitteln. Die Kommission übermittelt diese Unterlagen den übrigen Mitgliedstaaten. Diese können binnen 30 Tagen unmittelbar bei der Behörde, bei der der Antrag eingegangen ist, oder aber über die EU-Kommission um weitere Informationen ansuchen oder Stellungnahmen abgeben.
Die Behörde hat im Rahmen des Ermittlungsverfahrens eine Anhörung durchzuführen[216] und ein Gutachten des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses der Gentechnikkommission einzuholen (§ 39 Abs 3).[217]
Die Behörde muß mit dem BMUJF zusammenarbeiten, indem sie Antrag, Aufforderungen zur Einreichung weiterer Informationen, daraufhin einlangende Informationen, sonstige Mitteilungen des Antragstellers und die Entscheidung an das BMUJF weiterleitet.
Die Behörde hat die Freisetzung zu genehmigen, wenn die Vorschriften des GTG über Freisetzungen vom Antragsteller eingehalten werden und keine nachteiligen Folgen für die Sicherheit zu erwarten sind (§ 40 Abs 1). Ihre Entscheidung muß die Behörde der EU-Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten mitteilen (Art 9 Abs 3 FS-RL[218] ).
Es besteht die Möglichkeit, ein vereinfachtes Verfahren, das auch keiner Anhörung mehr bedarf, zu schaffen. Dazu muß die nationale Behörde, wenn sie der Meinung ist, daß genügend Erfahrung mit der Freisetzung eines bestimmten Organismus gesammelt wurde, bei der EU-Kommission um ein vereinfachtes Verfahren ansuchen (§ 42, Art 6 Abs 5 FS-RL). Wenn die Kommission positiv entscheidet, ist diese Entscheidung in nationales Recht zu transformieren, in Österreich in Form einer Verordnung (§ 42), nach Anhörung des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses und im Einvernehmen mit vier Bundesministern (Land- und Forstwirtschaft; Umwelt, Jugend und Familie; wirtschaftliche Angelegenheiten; Wissenschaft und Forschung).
Auch bei der Freisetzung sind gem § 48 nachträgliche Auflagen nur zur Hintanhaltung unmittelbarer und für die Sicherheit gem § 1 Z 1 erheblich nachteiliger Gefahren unter möglichster Schonung der erworbenen Rechte möglich.[219] Ebenso verliert die Genehmigung nach drei Jahren ihre Gültigkeit, wenn bis dahin die Freisetzung noch nicht begonnen wurde (§ 104).
3.1.3.2 – Exkurs: Anhörung
Die Verfahren für die Genehmigung bestimmter gentechnischer Arbeiten und für die Genehmigung von Freisetzungen rekombinanter Organismen sehen in § 22 Abs 3 Z 2 iVm § 28 resp in § 39 Abs 3 iVm § 43 ein Anhörungsverfahren vor. Der Wortlaut der inhaltlichen Regelungen der Anhörung (§§ 28 u 43) ist nahezu derselbe. Es muß der Antrag in der Wiener Zeitung und in zwei örtlichen Tageszeitungen kundgemacht werden. Ort, Zeit und Dauer der Möglichkeit zur öffentlichen Einsichtnahme in die Unterlagen und zur Einreichung von begründeten Einwendungen sind bei dieser Veröffentlichung anzuführen. Die Auflegungsfrist beträgt drei Wochen. Binnen drei Wochen ab Ende der Auflegungs- und Einwendungsfrist ist die Anhörung zur näheren Erläuterung der Einwendungen abzuhalten. Die Einwender, die Mitglieder des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses und der Betreiber[220] sind dazu zu laden.
Zur Parteistellung schweigt sich der Gesetzgeber aus. Lediglich in den Erl RV [221] findet sich der Hinweis, daß im vorigen Entwurf die Parteistellung behandelt wurde. Dort war vorgesehen, daß jeder, der begründete Einwendungen erhebt, auch Parteistellung erlangt hätte.[222] Diese undifferenzierte Form des demokratischen Prinzips – Einmischungen mittels Parteistellung von jenen, die keine eigene rechtliche Betroffenheit vorweisen können, wären besonders begründungsbedürftig gewesen und wurden seitens der Industrie entsprechend heftig kritisiert[223] – galt es im nächsten Entwurf, der Regierungsvorlage, zu vermeiden.[224]
Aus der ausgebliebenen Behandlung der Parteistellung im GTG folgt aber nicht, daß niemand Parteistellung im Verfahren hat. Gem § 8 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, BGBl 1991/51 (AVG) der mangels anderslautender Bestimmungen auf Verfahren nach dem GTG anzuwenden ist, ist jeder Partei, der vermöge eines Rechtanspruches oder eines rechtlichen Interesses an der Sache beteiligt ist. Kriterium hiefür ist der Nachweis eines hinreichend konkretisierten Individualinteresses.[225] Im Zweifel ist anzunehmen, daß, wenn von einer Norm nicht bloß öffentliche Interessen gewahrt werden sollen, zugleich subjektives Recht eingeräumt wird.[226] Folgt man dieser Auffassung, so ergibt sich aus der Betrachtung der Ziele des GTG in § 1, daß jeder, der im Rahmen des Anhörungsverfahrens[227] begründete (plausible) Einwendungen die Gesundheit seiner selbst oder seiner Nachkommen betreffend macht, Parteistellung erlangt.[228]
Zur näheren Ausgestaltung der Vorschriften von Kundmachung und Ablauf des Anhörungsverfahrens, Art und Umfang der Einsichtnahme in Antrag und Unterlagen, enthalten die §§ 29 u 44 Verordnungsermächtigungen, wobei die erste Einvernehmen mit dem BMWVK und dem BM für wirtschaftliche Angelegenheiten verlangt, die zweite bloß mit dem BMWVK.
Diese Verordnungsermächtigungen sollen wohl die Möglichkeit geben, die typischen Probleme von Massenverfahren – als solche sind die ersten (später wird sich das Interesse wohl legen) Anhörungsverfahren, insb im Zuge von geplanten Freisetzungen zu werten – zu lindern.[229]
Auf Grund der erwähnten Verordnungsermächtigungen ist nun eine Anhörungsverordnung im Entstehen, deren Entwurf (GT-AnhVE) etwa folgenden Inhalt hat:
Der Anwendungsbereich entspricht genau den Fällen, bei denen gem §§ 22 Abs 3 Z 2 u 39 Abs 3 Anhörungen vorgeschrieben sind (§ 1 Z 1-5 u Z 6 GT-AnhVE). Im Entwurf wird der Begriff der „ örtlichen Tageszeitungen “ präzisiert (§ 2 GT-AnhVE) und es wird festgelegt, daß die Behörde nicht nur die Unterlagen[230] auflegen muß, sondern auf Wunsch auch eine Kurzfassung des Antrages jedermann zuzusenden resp Umweltschutzorganisationen eine (ungekürzte) Kopie des Antrags zu überlassen hat.[231] Ferner werden das Ladungsverfahren vereinfacht (§ 4 GT-AnhVE), Mindestanforderungen an die Räumlichkeit, in der die Anhörung abgehalten wird, gestellt (§ 6 GT-AnhVE) und Regeln für das Anhörungsverfahren festgelegt (§§ 5 u 7 GT-AnhVE). Ein über die Anhörung verfaßtes Protokoll ist dem zuständigen wissenschaftlichen Ausschuß zukommen zu lassen.
Dem anläßlich der ersten gem GTG durchgeführten Anhörung geäußerten Vorwurf, daß manche Einwender keine Ladung zur Anhörung erhalten hätten[232], wird begegnet, indem man die Ladung seitens der Behörde statt über den Postweg nun gleich bei der Kundmachung in den besagten Medien aussprechen möchte.
Ein weiterer Vorwurf, daß es nämlich „grobe Mängel bei [dem] Bürger-Beteiligungsverfahren gegeben“[233] hätte, weil potentiell Interessierte nach Wien fahren hätten müssen, um Einsicht in die Antragsunterlagen zu erhalten, wurde auch berücksichtigt. Zwar ist der Ort der Auflegung der der nach GTG zuständigen Behörde, welche gem Art 5 B-VG ihren Sitz in Wien haben muß, dafür kann man aber die Zusendung – zumindest einer Kurzfassung des Antrags – bei der Behörde anfordern.[234] Denkbar wäre auch eine Auflegung bei der regional zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde[235] oder zumindest in den betreffenden Landeshauptstädten (etwa am Sitz der Landesregierung), womit auch die aus der Vervielfältigung und Versendung erwachsenden, unter Umständen erheblichen Aufwendungen [236] vermindert werden könnten. Offenbar wollte man aber die Auflegung zentral gestalten.
Damit wird aber nicht das Problem beseitigt, daß die Räumlichkeit, in der die Anhörung stattfindet, nicht in der Nähe der gentechnischen Anlage oder des Ortes der geplanten Freisetzung[237] sein muß und damit für manche Einwender auf jeden Fall Probleme mit der Anreise entstehen können.
Bemerkenswert ist der Umstand, daß Anhörungen in den Verfahren für die Genehmigung von gentechnische Arbeiten und Freisetzungen vorgesehen sind, in dem Bereich, in dem der einzelne aber als Konsument direkt betroffen ist, nämlich beim Inverkehrbringen, keine Anhörung in das Genehmigungsverfahren integriert ist. Dies hat in den EU-RL seinen Ursprung: Art 13 S-RL und Art 7 FS-RL stellen fest, daß ein Mitgliedstaat die „Anhörung bestimmter Gruppen oder der Öffentlichkeit zu jedem Aspekt“ der vorgeschlagenen Anwendung im GS resp der vorgeschlagenen absichtlichen Freisetzung vorschreiben kann.
Dieser Spielraum bei der Umsetzung der beiden RL in das GTG wurde genützt. Es wurden sowohl in das Genehmigungsverfahren von bestimmten gentechnischen Arbeiten als auch in das von Freisetzungen ein Anhörungsverfahren eingearbeitet (§§ 22 Abs 3 Z 2 u 39 Abs 3[238] ). Wenn auch der Umsetzungsspielraum außerhalb der RL heftig umstritten ist[239], so steht dennoch fest, daß der Spielraum innerhalb der RL jedenfalls nicht zur Gänze ausgenutzt wurde, da in manchen Verfahren zur Genehmigung von gentechnischen Arbeiten eine Anhörung nicht vorgesehen ist. Für nicht genehmigungspflichtige Arbeiten gibt es überhaupt kein Anhörungsrecht, wobei dieses – vor allem bei nicht einmal anmeldepflichtigen Arbeiten – entbehrlich sein kann.
„Eine […] Öffentlichkeitsbeteiligung sollte […] in abgestufter Weise entsprechend den unterschiedlichen Risken der gentechnischen Anwendung erfolgen“[240]. Diese Abstufung der Öffentlichkeitsbeteiligung hat zwei Ausprägungen: Anhörung oder keine Anhörung. Wenn man nun annimmt, daß die Anforderungen an eine gesetzliche Regelung der Gentechnik, wie sie in den Erl RV aufgeführt sind, vom Gesetzgeber erfüllt wurden, sieht man eine Diskrepanz zwischen der Abstufung der Anhörungen und der Zahl der Risikoklassen resp Sicherheitsstufen gem § 5, die ja aus der Einstufung in vier Risikoklassen resultieren.[241]
Von einer Abstufung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Hinblick auf das Inverkehrbringungs-Verfahren kann allerdings keine Rede sein. Dort, wo die Risken am größten sind, gibt es nicht einmal ein Anhörungsrecht. Man bedenke dabei, daß eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung oft als eine conditio sine qua non angesehen wird[242] und diese Vorgehensweise demokratiepolitsch bedenklich anmutet.
Es stellt sich daher die Frage, ob eine Öffentlichkeitsbeteiligung beim Genehmigungsverfahren für das Inverkehrbringen eines Produkts nicht doch möglich wäre. Im Allgemeinen Teil der Erl RV wird unter 3. b) festgestellt, daß „die Richtlinie 90/220/EG nämlich nur eine Teilharmonisierung für den Gesundheits- und Umweltschutzbereich“ darstellt und daher „Freisetzungen und Inverkehrbringen von GVO […] durch die Freisetzungsrichtlinie nicht abschließend geregelt“ sind. Demnach seien die „über den Bereich der beiden Richtlinien hinausgehenden Bestimmungen […] EG-konform, weil die EG diese Bereiche bislang nicht geregelt hat“.[243] Diese Meinung ist allerdings nicht unreflektiert zu teilen. Während die S-RL ihre Rechtsgrundlage in Art 130s EGV hat, und ihre Wirkung als Teilharmonisierung weitgehend unumstritten ist, kann man bei der FS-RL, deren Rechtsgrundlage Art 100a ist[244], nicht davon ausgehen, daß es sich ebenso verhält. Viel mehr ist prima vista anzunehmen, daß es sich dabei um eine Vollharmonisierung handelt.[245], Wenn man sich vor Augen führt, daß die in Art 7 FS-RL angeführte Anhörung in Teil B der RL steht, jenem Teil, der die Freisetzung regelt, wird wohl die Absicht klar, daß diese Möglichkeit nur für die in Teil B geregelten Sachverhalte, nämlich die Freisetzung, gelten soll. Andernfalls wäre die Plazierung dieser Norm zB in den allgemeinen Bestimmungen des Teil A angebracht. Relativiert wird dieses Argument allerdings durch den Begriff der Freisetzung in der FS-RL. Denn Freisetzung ist gem der Legaldefinition des Art 2 Z 3 FS-RL in einem weiten Sinn, auch das Inverkehrbringen umfassend, zu verstehen.[246]
Ein weiteres Argument für die Zulässigkeit von Anhörungen im Rahmen des Verfahrens zum Inverkehrbringen geht davon aus, daß der EU betreffend Regelung von nationalen Verfahren im allgemeinen nur zugestanden wird, Mindeststandards zu setzen, nicht aber Höchststandards wie eben den Ausschluß der Öffentlichkeit im Inverkehrbringungsverfahren.[247]
Daß mit Freisetzung in diesem Fall– für die RL eher untypisch – die Freisetzung im engeren Sinn gemeint ist, also nicht zugleich das Inverkehrbringen betroffen sein soll, geht aber klar aus Art 12 Abs 5 FS-RL hervor. Er bestimmt, daß für die Dauer der Verbesserung des Antrags durch den Antragsteller eine Fortlaufshemmung der Verfahrensfristen besteht. Im Gegensatz dazu, werden in Art 6 Abs 3 FS-RL, der für die Freisetzung gilt, sowohl die Verbesserung des Antrags als auch eine öffentliche Untersuchung oder Anhörungen als Grund für die Fortlaufshemmung angeführt. Genau dieselbe Regelung findet sich auch in Art 11 Abs 6 S-RL für das Verfahren für gentechnische Arbeiten, welches ja auch eine Anhörung vorsieht. Es ist also nicht davon auszugehen, daß in Art 12 Abs 5 FS-RL der Hemmungstatbestand der Anhörung vergessen wurde oder offengelassen werden sollte.
Dennoch sind manche dieser Meinung und proklamieren, daß eine Anhörung auch für das Inverkehrbringen durch die FS-RL gedeckt ist, und weisen darauf hin, daß durch die Anhörung die Fristen nicht wie bei den unumstritten Anwendungen der Anhörung ruhen.
Insb in den USA setzt man auf weitreichende Öffentlichkeitsbeteiligung, um so hohes Vertrauen in objektiv-sachlich statt polemisch geführte Genehmigungsverhandlungen zu gewährleisten. Dieses Vertrauen in das objektive Zulassungsregime – kombiniert mit einer aktiven Informationspolitik – ist maßgeblich für die Akzeptanz der späteren gentechnischen Erzeugnisse.[248] Die Informationspolitik könnte vor allem ein „qualifizierter Wissenschaftsjournalismus [betreiben, der] auch komplizierte wissenschaftliche und technische Fragen einer breiteren und interessierteren Öffentlichkeit vermittelt“[249]. Diesbezüglich besteht in Österreich allerdings noch Nachholbedarf, es wird angeraten den Wisschenschaftsjournalismus zu institutionalisieren und in systematischer Form zu fördern.[250]
Durch den Widerstand der Industrie gegen Kennzeichnung und Öffentlichkeitsbeteiligung wird nur Mißtrauen in der Bevölkerung geweckt[251] und der spätere Markterfolg der Produkte fraglich.
In Deutschland regelt § 1 Gentechnik-Anhörungsverordung 1990, wann Anhörungen durchzuführen sind. So bei bestimmten Anlagen- und Betriebsgenehmigungen (Anknüpfungspunkt ist bei erstmaligen Arbeiten die Anlage, nicht wie in Österreich die gentechnische Arbeit), bestimmten weiteren Arbeiten[252] und bei Freisetzungen (mit Ausnahmen).
3.1.3.3 – Stufenprinzip
Bereits in den Grundsätzen (§ 3) wird das Stufenprinzip normiert. Es besagt, daß bei Freisetzungen von GVO die Einschließung der GVO stufenweise gelockert wird. Bei jeder Stufe wird erhoben, ob auch die darauffolgende Stufe erfahrungsgemäß keine Gefährdung von Mensch und Umwelt mit sich bringt. In § 36 wird normiert, welche Stufen bei einer Freisetzung zu durchlaufen sind, und wie diese Stufen zu gestalten sind. Es sind zwei Stufen vorgesehen: Die erste Stufe ist ein „Versuch in einem kleinen Ausmaß“ (§ 36 Abs 1 Z 1), was bedeutet, daß bei dieser ersten Stufe auf Grund des kleinen Ausmaßes eine unbegrenzte Vermehrung von GVO nicht möglich sein soll. Diese Stufe kann gem § 36 Abs 2 übersprungen werden, wenn daraus kein Risiko für die Sicherheit entsteht und ein entsprechender Bescheid vorliegt. Die zweite Stufe ist ein „Versuch in einem großen Ausmaß“ (§ 36 Abs 1 Z 2). Das Ausmaß ist so zu wählen, daß es möglich ist, die Verbreitung und Vermehrung der GVO in der Umwelt zu überwachen.
Europarechtlich wird das Stufenprinzip in einem anderen Zusammenhang gesehen. Die FS-RL spricht vom Stufenprinzip nur insoferne, als im Erwägungsgrund 11 angeführt wird, daß „die Einbringung von GVO in die Umwelt [...] nach dem ,Stufenprinzip’ erfolgen“ sollte. Es ist jedoch zu beachten, daß „Absichtliche Freisetzung“ iSd Art 2 Z 3 FS-RL – mangels einer Begriffsabgrenzung vom Inverkehrbringen wie sie in § 4 Z 20 steht – in einem weiteren Zusammenhang gesehen wird als im GTG und dessen Begriffe „Freisetzung“ und „Inverkehrbringen“ umfaßt.[253] Was soviel heißt, wie ein Inverkehrbringen iSd Art 2 Z 5 FS-RL (unter den Begriff „absichtliche Freisetzung“ fallend) sollte nur nach einer Freisetzung im engeren Sinn, also nach Abschnitt B der FS-RL (dh Freisetzung iSd GTG) erfolgen.[254] So stellt sich also die Mindestanforderung an ein national auszuformulierendes Stufenprinzip dar. Ein weiterer Hinweis auf das Stufenprinzip findet sich zB in Art 11 Abs 2 FS-RL.
Auch im deutschen GenTG ist das Stufenprinzip nicht ausdrücklich normiert. Ebenso wie die FS-RL setzt aber auch das GenTG das Stufenprinzip implizit voraus (vgl zB § 15 Abs 1 Nr 3).[255]
3.1.3.4 – Pflichten des Antragstellers und späteren Betreibers
Der Antragsteller hat seinem Antrag Informationen über die Folgen des GVO und seiner Anwendung auf die Sicherheit beizuschließen (§ 37 Abs 2); so etwa Daten über den GVO, über humanpathogene Merkmale des GVO, über Wechselwirkungen zwischen GVO und Umwelt (Stichwort Gentransfer), über die Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit etc. Auch während und nach dem Genehmigungsverfahren muß er die Behörde über allfällige Änderungen im Hinblick auf die Sicherheit (zB durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse) unverzüglich informieren und vor allem muß er auch unverzüglich dementsprechende Maßnahmen ergreifen, resp, sollte der Antrag noch vor seiner Genehmigung stehen, ebensolche Maßnahmen im Antrag vorsehen (§ 37 Abs 5).
Der nunmehrige Betreiber hat im Falle eines Unfalles (das ist eine unvorhergesehene Abweichung vom geplanten Versuchsablauf, bei der eine Vermehrung der GVO über den geplanten Versuchsbereich die Sicherheit gefährden kann; vgl § 4 Z 13), nicht nur Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, sondern auch der Behörde unverzüglich die Unfalldaten mitzuteilen. Bei Unfällen mit höherem Risiko für die Sicherheit ist die Behörde zusätzlich sofort telefonisch zu verständigen. Ist die Gesundheit von Menschen unmittelbar betroffen, sind diese Personen vom Unfall und über geeignete Verhaltensmaßnahmen unverzüglich zu informieren (§ 49).
Weiters treffen den Betreiber Aufzeichnungspflichten (§ 52) kombiniert mit einer Aufbewahrungspflicht (10 Jahre ab Beendigung der Freisetzung): Er muß unter anderem Abweichungen vom geplanten Versuchsablauf und die Entsorgung der GVO anführen.
Sicherheitsdaten, die vom Betreiber sowohl während als auch nach der Freisetzung erhoben werden, sind der Behörde mitzuteilen (§ 46).
3.1.4 – Weitere Aspekte der Freisetzung
Freisetzen von GVO bedeutet, daß die Kontrolle über GVO, die im GS im großen und ganzen gegeben ist, wesentlich verringert wird. Es besteht sowohl die Gefahr, daß das Erbmaterial an die Umwelt weitergegeben werden kann, als auch, daß die Organismen als ganzes in die Umwelt entweichen. Man faßt dies unter dem Stichwort „Rückholproblematik“ zusammen. Es ist also – je nach Organismus – fraglich bis praktisch unmöglich, die veränderten Erbinformationen, sind sie einmal freigesetzt, wieder unter Kontrolle zu bekommen.
Um diese Problematik zumindest vorerst zu entschärfen, sieht das GTG das Stufenprinzip (vgl oben) vor, das schon in den Grundsätzen des GTG verankert ist.
3.1.4.1 – Risikobeurteilung
Seit über 20 Jahren wird Gentechnik betrieben. Ebenfalls seit über 20 Jahren macht man sich auch Gedanken über die Gefahren und Risiken, die durch ihre Anwendung entstehen können, sowie über deren Hintanhaltung. So wurden 1976[256] von den National Institutes of Health der USA (NIH) Sicherheitsrichtlinien (Guidelines on research involving recombinant DNA-molecules) entworfen, die weltweit Eingang in diverse Gentechnikregulierungen fanden. So wurden Teile auch im GTG (die vier Risiko- und daraus resultierenden Sicherheitsstufen für Arbeiten mit GVO) eingearbeitet.
1983 wurde die sog „ OECD ad hoc Arbeitsgruppe von Regierungsexperten über Sicherheit und Regelungen in der Biotechnologie“ eingesetzt, die 1986 ihren Bericht „Recombinant DNA Safety Considerations“ veröffentlichte. Dieser Bericht, an dem auch Mitglieder der EG-Kommission mitwirkten[257], war wiederum Vorlage für zahlreiche nationale Regelungen.[258] So wurden darin die Prinzipien case-by-case und step-by-step entwickelt, die auch in die Gentechniktrichtlinien der EU übernommen wurden.[259]
Es werden auch für die Freisetzung von GVO, den vier Risikostufen ähnliche, im Gesetz verankerte Abstufungen gefordert. Art 6 Abs 1 FS-RL 2. SpStr fordert bloß eine Risikobeurteilung durch die Behörde[260], wie diese zu erfolgen hat wird in den Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt. Wohl werden – sowohl in den EU-Mitgliedstaaten als auch in vielen anderen Staaten – ähnliche Angaben vom Antragsteller im Hinblick auf Risiko und Gefahr der Freisetzung verlangt, doch die Kriterien resp deren Akzentuierung bei der Beurteilung dieser Daten unterscheiden sich (oft nur um Nuancen) von Staat zu Staat. So setzte sich insb in den USA die Ansicht durch, daß sich zwischen gentechnisch veränderten und herkömmlichen Organismen prinzipiell kein Unterschied ergibt.[261] Es wird also bei der Risikobeurteilung kein besonderes Augenmerk auf die Art der Herstellung gelegt, sondern vielmehr auf die Eigenschaften des Organismus. Dies scheint auch sehr vernünftig, weil zum ersten die Herstellung des GVO ohnehin detailliert geregelt ist, und zum zweiten all die Probleme wie Pathogenität, Vermehrungsfähigkeit, Verdrängungspotential, Gentransfer, die es noch kurz zu erörtern gilt, ja auch von herkömmlichen Organismen ausgehen. Als Beispiel sei der Kastanienrindenkrebs angeführt[262]. 1904 wurde in Nordamerika der parasitische Pilz Endothia parasitica aus Ostasien eingeschleppt. In nur 50 Jahren starben dadurch vier Fünftel des Bestandes der in diesem Gebiet urtümlich stark vertretenen Edelkastanien, die restlichen erkrankten. In Asien war eine solche Wirkung des Pilzes nicht zu beobachten, weil sich dort im Laufe der Jahrhunderte ein Gleichgewicht zwischen Wirt und Parasit – wohl auf Basis einer Resistenz gegen den Pilz – entwickelt hatte.
Weiters beziehen manche Staaten den Nutzen der Freisetzung in die Risikobeurteilung ein. Es ist wohl begrüßenswert, daß überhaupt nach dem Nutzen gefragt wird, formal paßt die Nutzenfrage jedoch nicht in eine Risikoanalyse.
Grundlegend für die Risikobeurteilung ist die Frage, ob ein additives oder ein synergistisches Modell besser geeignet ist, das Risiko bei der Freisetzung von GVO zu beschreiben. Obwohl in vielen Staaten auf das additive Konzept zurückgegriffen wird, bei dem vor allem die Eigenschaften des Empfängerorganismus im Vordergrund stehen, aber auch jene des Spenderorganismus (vor allem die Wirkung des Gens im Spenderorganismus) und des Vektors (sofern verwendet). Der Gesamteffekt (das Gesamtrisiko) ist nach diesem Modell die Summe aus den Einzeleffekten (Einzelrisken). Es wird dabei aber nicht beachtet, daß bestimmte Kombinationen von Erbinformationen plötzlich ganz andere Auswirkungen haben könnten als mit additiven Methoden vorhersehbare. Das synergistische Modell beachtet, wie der Name schon sagt, jene Synergieeffekte. Es berücksichtigt, daß sich gewisse Gefahren gegenseitig aufschaukeln oder auch kompensieren können. Der Gesamteffekt ist nicht unbedingt gleich der Summe der Einzeleffekte.
Dazu bedarf es aber der Kenntnis der Einflüsse entfernter oder hinzugefügter Gene auf die gesamten Erbanlagen eines Organismus und auch auf seinen Stoffwechsel. Sog Positionseffekte, das sind Effekte durch die Änderung der relativen Position der Gene zueinander und pleiotrope Effekte, das sind Effekte auf mehrere Eigenschaften des Organismus durch nur ein Gen, wie auch die oben genannte Abhängigkeit von der Position im Organismus unterstützen das synergistische Modell.[263] Das additive Modell wird daher als nützliche und manchmal auch einzig mögliche Näherung an das synergistische betrachtet. Die beiden Modelle stehen zueinander in einem Verhältnis, das mit dem zwischen Newtonscher Mechanik und spezieller Relatiitätstheorie vergleichbar ist. Die Forderung nach dem synergistischen Modell als dem einzig passablem bei der Risikobeurteilung käme einer Forderung nach derzeit noch illusorischem Wissen gleich und wäre daher kontraproduktiv. Wünschenswert wäre die synergistische Risikobetrachtung in einem begrenzten und vertretbaren Rahmen, als Ergänzung der additiven Betrachtungsweise in bestimmten Bereichen; das additive Modell wird jedoch in nächster Zeit auf jeden Fall noch vorwiegen.
Eine Folgerung der Verfechter des synergistischen Prinzips sei noch erwähnt, nämlich „daß die tatsächlichen Gefährdungspotentiale transgener Organismen prospektiv nicht vollständig abschätzbar sind“[264].
Weiters wird die Frage aufgeworfen, wie ein Risiko zu berechnen sei. Häufig wird das Risiko als Produkt von Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines unerwünschten Ereignisses und der zu erwartenden Schadenshöhe dargestellt.[265] Das „optimale Risiko“ oder die optimale Risikovorsorge im ökonomischen Sinn wird durch Betrachten der beiden Kostenkurven – Risikokosten (= erwarteter Schaden) und Risikovermeidungs- oder Sorgfaltskosten – ermittelt.[266] Da es sich bei den beiden Kurven wie gesagt um Kostenkurven handelt, erhält man die minimale Kostenkombination, indem man beide Kurven vertikal aggregiert und von dieser Gesamtkostenkurve das Minimum bestimmt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb9: Minimale Gesamtkosten eines Risikos
Die Identifikation des Schadens setzt Wissen um Zusammenhänge zwischen Ursachen und unerwünschten Folgen voraus. Die Kenntnis von Ursache-Wirkungsbeziehungen hängt mit dem momentanen Wissensstand direkt zusammen. Dh je mehr Zusammenhänge man kennt, desto größer könnte der potentielle Schaden dimensioniert werden. Als Beispiel seien Asbest-Bauteile genannt, über deren karzinogenen Eigenschaften man erst seit wenigen Jahren Bescheid weiß, und die nun entsprechend gesichert oder überhaupt entfernt werden müssen.
Die Quantifizierung des Schadens bereitet oft Schwierigkeiten. In der Versicherungswirtschaft wird selbst der Wert eines Menschenlebens in Geldbeträgen ausgedrückt. Sind aber sehr viele Menschen betroffen und weiß man auch nicht inwieweit, muß man auf kompliziert Modelle und Expertenmeinungen zurückgreifen, was nichts anderes bedeutet, als daß man sich auf recht vage Schätzungen einläßt, da Erfahrungswerte oft nicht existieren.
Die Schadenshöhe wird üblicherweise mit den Wiederherstellungskosten beziffert. Man könnte zum Bezugspunkt für die Wiedergutmachung aber auch eine „wünschenswerte Umwelt“[267] machen. Dieses Problem ergibt sich beispielsweise, wenn eine Folge einer Tätigkeit weder eindeutig nachteilig noch eindeutig vorteilhaft ist. So würde die Tollwutimpfung von Füchsen dazu führen, daß es mehr von ihnen gäbe. Ist es eher von Vorteil, daß die Population einer ziemlich stark dezimierten Gattung wieder ansteigt, oder eher von Nachteil, daß mehr Füchse mehr Niederwild jagen? Halten sich sich diese Aspekte die Waage oder könnte der eine den anderen überkompensieren?[268] Hier stellt sich die schwer zu beantwortende Frage nach der „wünschenswerten Umwelt“.
Auf das Problem der subjektiv wünschenswerten Umwelt, folgt das des subjektiven Risikos. Vom oben dargestellten objektiven Risiko, weicht die subjektive Risikoeinschätzung oftmals ab. Dies liegt oft daran, daß die Wahrscheinlichkeiten falsch eingeschätzt werden. ZB wird die Wahrscheinlichkeit, eine Fleischvergiftung zu bekommen oder schwanger zu werden überschätzt, die Wahrscheinlichkeit, einen elektrischen Schlag oder Krebs zu bekommen wird unterschätzt. Bei Krebs kann diese Fehleinschätzung zB daran liegen, daß sich viele über die Hauptursachen von Krebs nicht im klaren sind. Man denkt an Tabak, UV-Strahlung und Kernkraftwerke, wundert sich aber über die 2 Hauptfaktoren neben Tabak: Ernährung und Sexualverhalten (zusammen mit Tabak: 72%)[269].
Diese von Schicht zu Schicht oder von Land zu Land unterschiedlichen subjektiven Risikoeinschätzungen[270] sind nun Grundlagen für politische Entscheidungen. Der Wähler hat eine gewisse Vorstellung, wie riskant eine bestimmte Sache ist, und verlangt eine je nachdem mehr oder weniger strenge Regelung. Nun ist es Aufgabe der Politik, nicht den Wähler durch ein seinem Wunsch entsprechendes Gesetz einfach zu besänftigen, sondern es sollte durch aktive (aber nicht aufdringliche) und glaubwürdige Information versucht werden, die oftmals enorme Differenz zwischen subjektivem und objektivem Risiko zu schmälern und so die Risikowahrnehmung der Bevölkerung an das tatsächliche, wissenschaftlich erwiesene Risiko heranzuführen.[271]
Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Unfalls ist kaum weniger komplex, dennoch dürfte der Wert sehr gering sein, denn offiziell sind „keine Fälle der Gefährdung von Mensch und Umwelt durch Freisetzungen von rekombinanten Organismen bekannt, die eindeutig mit GVOs in Verbindung zu bringen sind“[272].
3.1.4.2 – Überlebens- und Ausbreitungsverhalten
Die These, daß freigesetzte GVM leicht durch die vorhandene Wildpopulation verdrängt werde, kann weder eindeutig bestätigt noch verworfen werden. Auf der einen Seite[273] wird davon berichtet, daß einige Jahre nach der Freisetzung von 106 rekombinanter Rhizobien je freigesetzter Pflanze (bestimmte Hülsenfrüchte) noch immer 103 dieser Mikroorganismen pro Gramm Boden gefunden wurden. In diesem Fall – und auch in einigen anderen dokumentierten Fällen – war der Verdrängungsdruck durch die Wildpopulation demnach minimal. Hier besteht also das Problem der Rückholbarkeit (oder Nichtrückholbarkeit). Dieses Problem ist bei Mikroorganismen wesentlich gravierender als bei rekombinanten Pflanzen oder gar Tieren.[274]
Auf der anderen Seite[275] wird davon berichtet, daß sich überzüchtete Coli-Bakterien[276] kaum länger als wenige Tage in der simulierten freien Umwelt (es handelte sich hier unter anderem um die Magen-Darm-Flora von Ratten) gegen die Wild-Stämme behaupten konnten und sich auch nicht vermehrten. Dies war jedoch Absicht der Versuchsleiter, es handelte sich um eine sog Bio-Containment-Maßnahme, bei der die in die Umwelt entlassenen rekombinanten Mikroorganismen absterben sollten.
Es ist demzufolge durchaus machbar, Organismen mit Selbstmordgenen[277] zu versehen, die zum Absterben des Organismus in der freien Umwelt führen. Es kann aber in vielen Fällen auf Dauer nicht der Zweck sein, daß teuer hergestellte und mühsam ausgesetzte Organismen binnen weniger Tage wieder absterben und somit erneut GVO ausgesetzt werden müssen.
Daß sich GVO negativ auswirken, ist allerdings eher unwahrscheinlich, da erstens sich die GVO nur dann dauerhaft gegen die Wildstämme durchsetzen können, wenn sie einen Selektionsvorteil vorweisen können, und es zweitens bis zum Kontakt zB mit dem Menschen meist bereits zu einer starken Verdünnung der Konzentration zB von ausgeschiedenen humanpathogenen Stoffen gekommen ist. Außerdem werden künstlich eingefügte, nicht lebensnotwendige Gene öfters aus dem Erbmaterial des Organismus wieder entfernt.[278] [279]
3.1.4.3 – Gentransfer
Während der vertikale Gentransfer zwischen verwandten Organismen auf sexuellem Wege stattfindet (sexuelle Rekombination), ist der horizontale Gentransfer ein asexueller auch zwischen nicht miteinander verwandten Organismen, zB von Pflanzen auf Mikroorganismen (parasexuelle Rekombination).
Der horizontale Gentransfer kommt auch in der Natur vor. So überträgt beispielsweise das pflanzenpathogene Bodenbakterium Agrobacterium tumefaciens sein Ti-Plasmid (Tumor-induzierend) auf bestimmte verwundete Pflanzen (zB Paradeiser, Erdäpfel etc). Diese Information wird in das chromosomale Genom der Pflanzen eingegliedert und veranlaßt daraufhin Tumorwachstum. Es ist bereits gelungen, dieses Ti-Plasmid gentechnisch zu zerlegen, die tumorinduzierenden Gene zu entfernen, andere gewünschte Gene einzusetzen und diese durch das Bakterium auf die Pflanze zu übertragen.
Ein weiteres Beispiel für horizontalen Gentransfer ist das rasch zunehmende Vorkommen von Antibiotikaresistenzen gegenüber in Therapien eingesetzten Antibiotika. Immer mehr bewährte Antibiotika wirken heute nicht mehr, weil die pathogenen Organismen Resistenzgene übernommen haben. Aus diesem Grund ist es zu kritisieren, daß zusätzlich noch Antibiotika-Resistenzgene als sog Markergene[280] verwendet werden, die dann oft bis zum Inverkehrbringen im Organismus bleiben und so diese Entwicklung zur Antibiotikaresistenz unterstützen. Mittlerweile wird aber schon an Genen gearbeitet, die zB eine Schwermetallresistenz oder eine gewisse ph-Wert-Toleranz bewirken.[281] Diese ließen sich ebenfalls als Markergene verwenden.
Der horizontale Gentransfer kann erfolgen durch Konjugation, durch Transduktion und durch Transformation.[282]
Bei der Konjugation können Prokaryonten[283] vor allem ihre Plasmide mit Artgenossen oder sehr nahen Verwandten über eine sog Plasmabrücke austauschen. Es wurde ein solcher DNA-Transfer auch schon zwischen Prokaryonten und Säugerzellen beobachtet.
Bei der Transduktion wird DNA von Bakteriophagen oder Viren übertragen. Diese Methode wird oft auch in der Gentechnik verwendet, indem Viren als Vektoren dienen.
Bei der Transformation werden frei in der Natur verbliebene DNA-Sequenzen aufgenommen. Diese Nukleinsäuren stammen von Ausscheidungen von Mikroorganismen oder von abgestorbenen Mikroorganismen. Obwohl diese DNA normalerweise durch sog DNasen zersetzt werden, verbleiben sie eine gewisse Zeit in der Umwelt (zB im Boden). Durch die Adsorption an Bodenmineralien kann die Widerstandsfähigkeit gegen die DNasen um ein bis zwei Zehnerpotenzen erhöht werden. Diese adsobierten DNA-Sequenzen können auch von anderen als den Bakterien, von denen die Nukleinsäuren stammen, aufgenommen werden; insb geschieht dies bei Nährstoffmangel. Dadurch ergibt sich ein gigantischer Genpool, über den Bakterien verfügen können (Hypothese des „bakteriellen extrazellulären Genpools“). Ob sich bloß Bakterien dieses Pools bedienen können oder auch im Boden ansässige Pilze über diese Eigenschaft verfügen, und in welchem Ausmaß die Transformation außerhalb der Laborbedingungen in der Natur stattfindet, muß noch geklärt werden.
Bei Pflanzen und Tieren kommt im allgemeinen nur die sexuelle Rekombination zwischen Artgenossen (vertikaler Gentransfer) in Frage. Diese ist meist nur zwischen Artgenossen möglich.
Der horizontale Gentransfer ist für den einzelnen Organismus ein eher unwahrscheinliches Ereignis; die Integration extrazellulärer Gene in die Keimbahn ist noch unwahrscheinlicher. Wenn man aber bedenkt, daß ca 90% der belebten Natur aus Mikroorganismen bestehen und nur rund 5% der Mikroorganismen bekannt sind[284], nimmt die Relevanz des horizontalen Gentransfers immense Dimensionen an. Lt Lelley (p 18) allerdings sind – zumindest in einem Fall – die sich daraus ergebenden Konstellationen in der Erbsubstanz von wesentlich geringerer Anzahl als entsprechende Konstellationen, die von Natur aus vorkommen.
Aus diesen Ausführungen wird jedenfalls ersichtlich, daß das zuvor angeschnittene Problem der Rückholbarkeit nicht nur die Rückholbarkeit von GVO, sondern auch die Rückholbarkeit derer Erbmaterialien betrifft.
3.1.4.4 – Unterschiede zwischen Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren
Zu den rekombinanten Mikroorganismen [285] wurde im Rahmen der Erörterung des Gentransfers bereits viel gesagt. Sie und ihre Erbanlagen sind in der freien Umwelt äußerst schwer zu kontrollieren, da sie sehr klein sind und sehr leicht ihre Erbinformationen an andere (nicht nur an artverwandte) Organismen weitergeben. Hinzu kommt, daß man nur wenige Mikroorganismen kennt und wenig über sie weiß. Aus diesen Gründen sind Freisetzungen von GVM besonders risikobehaftet.
Jedoch gibt es für Mikroorganismen auch viele Anwendungsmöglichkeiten in GS. Bei diesen sollte man sich mit den Mikroorganismen zunächst näher vertraut machen, bevor man daran geht sie unreflektiert freizusetzen.
Bei transgenen Pflanzen [286] ist die Lage eine andere. Pflanzen – sowohl konventionelle als auch transgene – sind wesentlich besser erforscht als Mikroorganismen und sie sind in der Umwelt (ihre Erbanlagen betreffend) stabiler. Andererseits bedarf es, um transgene Pflanzen effektiv nutzen zu können der Freisetzung dieser Pflanzen, während es für GVM, wie erwähnt, viele (zB medizinisch-pharmazeutische) Anwendungsmöglichkeiten gibt.
Transgene Tiere [287] und ihre Erbanlagen sind wohl – allgemein gesprochen – am leichtesten von den drei Gruppen zu kontrollieren. Dennoch gibt es auch unter ihnen gewaltige Unterschiede im Hinblick auf Gefährdungspotentiale. Es liegt wohl auf der Hand, daß Vögel nicht so leicht rückholbar sind wie eine Kuh. Außerdem haben Kühe gar keine bis wenige Paarungspartner in der Natur, Vögel wesentlich mehr. Nicht zu unterschätzen ist aber die Gefahr des unkontrollierten Genflusses im GS. Die Diskrepanz von im Herdbuch vorgesehenen Abstammungen und realen Abstammungen beträgt ca 5%. Diese 5% der Nachkommen könnten also, wenn sich transgene Rinder im Stall oder auf der Weide (dort ist die Kontrolle aber wesentlich schwieriger als im Stall, was sich wohl in höheren Prozentsätzen niederschlagen wird) befinden, ebenfalls transgen sein, ohne daß dies gewollt wäre und gewußt würde.
Ein grundlegendes Problem bei der Freisetzung von transgenen Tieren liegt noch in der Definition des GS. Nach dem Wortlaut des GTG ist ein GS „ein System, bei dem […] zur Verhinderung oder zumindest zur Minimierung des Kontakts des verwendeten GVO mit der Außenwelt [die] gebotenen […] Schranken […] mit dem Ziel angewandt werden, eine unkontrolliert Vermehrung des GVO in der Außenwelt zu verhindern“.
Es ist zu klären, ob der Stall oder gar die (umzäunte) Weide ein GS iSd GTG ist, oder ob der Aufenthalt transgener Rinder im Stall oder auf der Weide als Freisetzung zu werten ist. Ein Stall erfüllt wohl die Anforderungen des GTG an ein GS. Ob eine Weide ein GS für Rinder ist, ist nicht mehr so sicher, wird aber mE zu bejahen sein, da beide Ziele – 1. das Ziel bei der Wahl der Schranken (Umzäunung als physische Schranke): Verhinderung oder zumindest Minimierung des Kontakts mit der Außenwelt; 2. das Gesamtziel des GS: Verhinderung der unkontrollierten Vermehrung des GVO in der Außenwelt – erreicht werden. Voraussetzung dabei ist aber, daß der Begriff der Außenwelt nicht allzu weit aufgefaßt wird, sondern man darunter eher die Menge wahrscheinlicher Empfängerorganismen des Erbgutes versteht.
Daher ist mE die Rinderhaltung im Stall oder auf der Weide – sofern bloß transgene Tiere gehalten werden, denn bei einem Nebeneinander von transgenen und konventionellen Tieren könnten letztere als Außenwelt gewertet werden – bloß eine Arbeit mit GVO im GS und keine Freisetzung.
3.1.5 – Zusammenfassung
Obwohl bei Freisetzungen die Gefahr der unkontrollierten Verbreitung und des Austausches von pathogenen Erbinformationen, die insb bei Mikroorganismen besteht, möglicherweise nicht allzu groß sein mag, ist sie dennoch evident. Während man aber GVM auch sehr gut im GS nutzen kann, müssen vor allem Pflanzen aber manchmal auch Tiere freigesetzt werden.
Bei der Risikobeurteilung ist unbedingt der Einzelfall (case-by-case-Prinzip) zu beurteilen, man kann Fadenwürmer nicht mit Rindern in einen Topf werfen.
Anzumerken ist, daß es – trotz entgegenlautenden Meldungen – in über 20 Jahren Gentechnikgeschichte zu keinen Unfällen – weder bei Freisetzungen noch bei Arbeiten im GS – gekommen ist.[288]
3.2 – Inverkehrbringen von Erzeugnissen (§§ 54-63)
3.2.1 – Gesetzliche Regelung des Inverkehrbringens
Das GTG definiert Inverkehrbringen als die Einfuhr und die Abgabe an Dritte von Erzeugnissen, die aus GVO bestehen oder solche enthalten. Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß damit nur Erzeugnisse gemeint sind, die aus ganzen GVO bestehen oder ganze GVO enthalten.[289] „Kennzeichen des Inverkehrbringens ist es, daß jegliche Kontrolle über den Organismus aufgegeben wird“[290]. Sind diese GVO für Arbeiten in GS, für eine genehmigte Freisetzung oder für wissenschaftliche Zwecke bestimmt, gilt die Abgabe oder Einfuhr nicht als Inverkehrbringen (§ 4 Z 21).
Die FS-RL versteht unter Inverkehrbringen hingegen„die Abgabe an Dritte oder die Bereitstellung für Dritte“ (Art 2 Z 5 FS-RL). Es fällt sofort auf, daß nicht nur die Abgabe an sich als Inverkehrbringen verstanden wird, sondern auch die Bereitstellung, also Vorbereitungshandlungen für den Verkauf, wie Lagern oder Feilbieten, unter diesen Begriff fallen. Dem widersprechen sowohl die österreichische (§ 4 Z 21) als auch die deutsche Umsetzung (§ 3 Nr 8 GenTG) der Richtlinie, die unter Inverkehrbringen nur die (kommerzielle) Abgabe als solche an Dritte erfassen.
Wesentlich weniger problematisch ist mittlerweile, daß in der FS-RL kein Unterschied zwischen Produkten, die lediglich für Forschungsarbeiten im GS bestimmt sind, und solchen, die auf den Markt gebracht werden sollen, gemacht wird. Dies ist aber nur in der deutschen Fassung der RL der Fall. Die englische Fassung führt den Begriff „placing on the market“ an. In einer guidance (Document XI/57/92) aus dem Jahr 1992 wird klargestellt, daß die Kommission für Inverkehrbringen einen kommerziellen Bezug voraussetzt. Dasselbe Problem gab es im deutschen GenTG, wurde aber – im Rahmen der Gentechniknovelle 1993 – ebenfalls behoben.[291]
3.2.1.1 – Genehmigungsverfahren
Das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die aus GVO bestehen oder solche enthalten (im folgenden kurz: Inverkehrbringen oder Inverkehrbringung) ist jedenfalls genehmigungspflichtig (§ 54 Abs 1).
Zur Inverkehrbringung eines jeden Erzeugnisses, das bereits genehmigt ist, aber zu einem anderen Zweck dienen soll, bedarf es einer gesonderten Genehmigung (§ 54 Abs 2, Art 11 Abs 4 FS-RL).[292]
Eine Ausnahme besteht für Erzeugnisse, die aus obengenannten Erzeugnissen gem den Verwendungsbestimmungen im Antrag obengenannter Erzeugnisse erzeugt werden. Diese Erzeugnisse müssen also nicht extra genehmigt werden, wenn sie an GVO bloß solche enthalten oder aus solchen GVO bestehen, die bereits zugelassen sind. Die Erl RV zu § 54 sprechen in diesem Zusammenhang etwas verwirrend von „Nachkommen von GVO“ anstatt von „Nachkommen von aus GVO bestehenden oder solche enthaltenden Produkten“.[293] Gemeint sind eigentlich Nachfolgeprodukte von GVO-Produkten, also Erzeugnisse aus Erzeugnissen, die aus GVO bestehen oder solche enthalten.[294]
Diese Ausnahme gilt aber wie gesagt nur dann, wenn bereits im Zulassungsantrag des genehmigten GVO dieser Verwendungszweck bereits angegeben wurde (§ 54 Abs 3). Es sei darauf hingewiesen, daß dies allerdings nicht der FS-RL entspricht. Das Mehl eines transgenen Getreides wäre also iSd FS-RL ein neues Erzeugnis, das nach dem nationalem Recht vorrangigem EU-Recht einer Zulassung bedürfte.
Die Genehmigung erfolgt durch die zuständige österreichische Behörde oder durch die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats gem FS-RL.
Im Antrag auf Genehmigung des Inverkehrbringens müssen unter anderem folgende Angaben gemacht werden:
– Bezeichnung des Erzeugnisses und der enthaltenen GVO,
– eine wissenschaftliche Beschreibung des Erzeugnisses und deren durch die Manipulation hervorgerufenen besonderen Eigenschaften,
– Daten oder Ergebnisse aus Freisetzungen der gleichen GVO und dazugehörigen Freisetzungsanträgen (ev auch anderer Antragsteller) und auch Literaturangaben zur Freisetzung dieser GVO,
– zu erwartende Verwendungsarten, Verbreitung und Produktions- oder Einfuhrmengen,
– Erläuterung der zu erwartenden Risken für die Sicherheit,
– Beschreibung der geplanten Kontrollmaßnahmen und der Notfallpläne,
– Beschreibung empfohlener Handhabungsregeln und Anwendungsregeln (Gebrauchsanleitung) für das Erzeugnis und auch für allfällige Reststoffe,
– Vorschlag für eine verbreitungshemmende Verpackung,
– Vorschlag für die Kennzeichnung.
Auf einzelne Angaben kann die Behörde gem § 55 Abs 5 verzichten, wenn keine nachteiligen Auswirkungen auf die Sicherheit zu erwarten sind. Gem § 57 sind nach Einreichung des Antrags neue Informationen, die das Risiko des Erzeugnisses für die Sicherheit betreffen, unverzüglich der Behörde schriftlich mitzuteilen und erforderliche Maßnahmen zu ergreifen. Vor allem müssen die Betroffenen (zB Konsumenten) informiert werden und nötigenfalls auch die Rücknahme der im Verkehr befindlichen Erzeugnisse angeboten werden (§ 57 Z 3).
Neben diesem Schutz durch die Sorgfaltspflichten des Antragstellers während und nach dem (positiven) Verfahren, existiert auch eine aktive Schutzverpflichtung der Behörde. Gem § 61 muß diese in Fällen einer drohenden Gefahr für die Sicherheit dem Inverkehrbringer mittels Bescheid auftragen, die Betroffenen über das Risiko und Abwehrmaßnahmen zu informieren sowie diese nötigenfalls zur Rückgabe der Erzeugnisse aufzufordern.
Das Verfahren für die Genehmigung eines Antrags auf Inverkehrbringen von gentechnischen Erzeugnissen ist in § 58 resp in den Art 12 f u 21 FS-RL geregelt.[295] Dabei ist zu beachten, daß der Geltungsbereich vieler Produktrichtlinien der EU gem Art 11 FS-RL von der Anwendung der Art 12 bis 18, also den Verfahrensbestimmungen für Inverkehrbringen, ausgenommen ist. So schließt auch Art 9 Abs 1 letzter S des Novel-Food-Verordnungsentwurfes Novel-Foods von der Anwendung der Art 11-18 der FS-RL aus. Wie beim Verfahren zur Genehmigung von Freisetzungen ist auch beim Verfahren für die Zulassung von gentechnischen Erzeugnissen von der Behörde ein Gutachten des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses der Gentechnikkommission einzuholen (§ 58 Abs 2). Jedoch ist im Gegensatz zu den Verfahren über die Genehmigung einer Freisetzung oder von manchen gentechnischen Arbeiten keine Anhörung notwendig. Damit entfällt im Verfahren auch die Kundmachung des Antrags auf Inverkehrbringen.
Auch ist hier das Recht auf Einsicht in die Unterlagen nicht explizit angeführt, aber durch Art 20 Abs 4 B-VG, das Auskunftspflichtgesetz (BGBl 287/87) und das Umweltinformationsgesetz[296], BGBl 495/93 (UIG), für jedermann gegeben.[297] Zwar mögen sich der Bereich der gem § 105 von der Behörde als vertraulich anerkannten Daten und der Bereich der geheimhaltungspflichtigen Daten in den drei oben erwähnten Bestimmungen unterscheiden. Dennoch darf man davon ausgehen, daß jene Daten, die lt § 105 Abs 3 auf keinen Fall vertraulich sind, größtenteils auch im Rahmen Auskunfts- resp Informationspflichten zugänglich sind.[298]
Aktive Information durch die Behörde über Anträge für gentechnische Arbeiten, Freisetzungen oder Inverkehrbringen – etwa via Presse – wäre zu erwägen, wird aber mit wenig einsichtigen Argumenten seitens des BMGK abgelehnt.[299]
Voraussetzung für die Bewilligung einer Inverkehrbringung ist eine – entweder im Inland nach GTG oder im Ausland nach der dort geltenden Umsetzungsvorschrift der FS-RL – genehmigte und auch – im jeweiligen Mitgliedstaat – durchgeführte Freisetzung des im Erzeugnis befindlichen GVO[300] (§ 58 Abs 4 Z 2 lit a u b). Diese Pflicht zur dem Inverkehrbringen vorangehenden Freisetzung wird in lit c gleich wieder zurückgenommen: Anstatt eine Freisetzung genehmigen zu lassen und durchzuführen, genügt es, die Voraussetzungen für eine Genehmigung einer Freisetzung nach dem GTG des im Erzeugnis befindlichen GVO nachzuweisen.[301]
Wie auch bei Arbeiten im GS und Freisetzungen ist eine weitere Voraussetzung, daß nach dem Stand von Wissenschaft und Technik keine nachteiligen Folgen für die Sicherheit zu erwarten sind.
Liegen die drei Voraussetzungen, vollständiger Antrag, vorangegangene „Freisetzung“ und Gewährleistung der Sicherheit, vor, so muß die Behörde ohne unnötigen Aufschub, spätestens jedoch 90 Tage nach Einreichung des Antrages, eine Kurzfassung desselben und eine befürwortende Stellungnahme an die EU-Kommission (Art 12 Abs 3 FS-RL) weiterleiten. Andernfalls ist das Inverkehrbringen zu untersagen.
Die nationale Behörde prüft also in einer Art Vorverfahren, ob der Antrag der nationalen Regelung und damit zugleich der FS-RL entspricht (Art 12 Abs 1 FS-RL). Tut er dies nach Ansicht der nationalen Behörde nicht, wird er gleich von dieser abgewiesen (Art 12 Abs 2 lit a). Entspricht der Antrag in den Augen der Behörde der FS-RL, dann wird er von ihr zur weiteren Bearbeitung an die EU-Kommission weitergeleitet (§ 58 Abs 4, Art 12 Abs 1 ff FS-RL).
Die Kommission leitet ihrerseits nach Erhalt der Unterlagen diese mit allfällig zusätzlich eingeholten Informationen an die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaaten weiter (Art 13 Abs 1 FS-RL). Von da an haben die Mitgliedstaaten 60 Tage Zeit, begründete Einwände vorzubringen (Art 13 Abs 2 FS-RL). Erfolgen keine Einwendungen, hat die nationale Behörde dem Antragsteller das Inverkehrbringen zu genehmigen und die Kommission sowie die anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis zu setzen (Art 13 Abs 2 FS-RL). Werden aber Einwendungen von zumindest einer zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates erhoben, so obliegt es den betreffenden Behörden (also der nationalen Behörde des Antragstellers und den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten), sich innerhalb der 60 Tage ab Weiterleitung durch die Kommission zu einigen (Art 13 Abs 3 FS-RL).[302]
Können sich die betreffenden Behörden nicht rechtzeitig einigen, so wird ein Verfahren nach Art 21 FS-RL [303] eingeleitet (Art 13 Abs 3 FS-RL). Dabei wird ein Ausschuß (Regelungsausschuß) eingesetzt, der aus Vertretern der Mitgliedstaaten besteht und dessen Vorsitz der Vertreter der Kommission innehat. Dieser legt dem Ausschuß einen „Entwurf der zu treffenden Maßnahmen“ vor. Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb einer vom Vorsitzenden unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der Angelegenheit vorgegebenen Frist Stellung. Die Abstimmungserfordernisse und Gewichtung der Stimmen entsprechen denen des Art 148 Abs 2 EGV, der Vorsitzende hat keine Stimme.
Die Stimmgewichtung [304] des Art 148 Abs 2 EGV sieht folgendermaßen aus:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb10: Stimmverhältnisse im Artikel-21-Ausschuß gem Art 148 Abs 2 EGV
Gem dieser Vorschrift bedarf es einer Mehrheit von 62 der 87 Stimmen, damit eine gültige Stellungnahme des Ausschusses zustande kommt.
Stimmt die Stellungnahme des Ausschusses mit dem Entwurf überein, so „erläßt“ die Kommission die beabsichtigten Maßnahmen, dh sie teilt das Ergebnis der nationalen Behörde mit, die dann dem Antragsteller die Genehmigung zu erteilen hat (Art 21 UAbs 3 FS-RL).
Kommt es zu keiner übereinstimmenden Stellungnahme, also stimmt die Stellungnahme nicht mit den beabsichtigten Maßnahmen überein oder kommt gar keine Stellungnahme zustande – zB weil die erforderliche Mehrheit im Ausschuß nicht erreicht wurde –, so muß der Vorschlag unverzüglich dem Rat (EU[305] -Umweltministerrat[306] ) unterbreitet werden. Dieser kann binnen drei Monaten ab Befassung darüber abstimmen. Der Rat hat zwei Möglichkeiten, einen Beschluß zu fassen. Er kann einstimmig[307] vom Vorschlag der Kommission abweichen oder mit qualifizierter Mehrheit mit der Kommission übereinstimmen. Im ersten Fall wird der Vorschlag der Kommission verworfen, im zweiten Fall wird er angenommen.
Entscheidet der Rat nicht, dh kann er sich weder zu einer qualifizierten Mehrheit für noch zur Einstimmigkeit gegen den von der Kommission unterbreiteten Vorschlag durchringen, so ist zuletzt die Kommission zuständig.[308] Sie „erläßt“ die vorgeschlagenen Maßnahmen, dh wiederum, daß die Entscheidung zugunsten der vorgeschlagenen Maßnahmen an die Mitgliedstaaten weitergeleitet wird und die nationale Behörde die Inverkehrbringung zu genehmigen hat.
Dh, auch wenn mehr als die Hälfte, ja sogar, wenn die qualifizierte Mehrheit der gewogenen Ratsstimmen gegen den Vorschlag der Kommission ist, wird der Vorschlag der Kommission durchgebracht. Daß dieses Verfahren als demokratiepolitisch bedenklich aufgefaßt werden kann, ist kaum verwunderlich.[309]
Da bei den oft sehr kontroversen Standpunkten die Erzielung der erforderlichen Konsensquoren im Ausschuß (qualifizierte Mehrheit für die vorgeschlagenen Maßnahmen) und im Ministerrat (qualifizierte Mehrheit für, Einstimmigkeit gegen die vorgeschlagenen Maßnahmen) eher selten ist, liegt die Genehmigung meistens schließlich im Kompetenzbereich der EU-Kommission. Um also vorgeschlagene Maßnehmen der Kommission zu verhindern bedarf es der einstimmigen Ablehnung im Rat oder der Überziehung der Kommission durch neue Beweise, Gutachten etc.
Gem Art 13 Abs 5 FS-RL gilt die Genehmigung, die von der nationalen Behörde des Antragstellers schriftlich ausgestellt wird, ab Erhalt durch den Antragsteller ohne weitere Anmeldung in der gesamten Gemeinschaft.[310] Die Mitgliedstaaten dürfen auch das Inverkehrbringen eines Produkts[311] nicht behindern, indem sie das Freisetzungsverfahren bemängeln, wenn das Verfahren der FS-RL entspricht. Damit soll verhindert werden, daß das Inverkehrbringen nach der RL verhindert wird, weil die nationalen Bestimmungen über die Freisetzung nicht exakt übereinstimmen.
Vorübergehend (für maximal drei Monate) hat ein Mitgliedstaat in Art 16 FS-RL dennoch die Möglichkeit, ein nach FS-RL vorschriftsgemäß in Verkehr gebrachtes Produkt auf seinem Territorium zu verbieten oder den Einsatz und/oder Verkauf einzuschränken.[312] Er muß dafür allerdings einen berechtigten Grund zur Annahme haben, daß das Produkt eine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt. Diese Maßnahme muß er unverzüglich der EU-Kommission und den anderen Mitgliedstaaten mitteilen. Die Kommission entscheidet – für den betreffenden Mitgliedstaat bindend – binnen drei Monaten nach dem oben beschriebenen Artikel-21-Verfahren[313], ob die Beschränkung aufrecht erhalten werden darf oder nicht.
In Österreich ist diese Regelung der FS-RL in § 60 umgesetzt. Die Entscheidung gem Art 16 Abs 2 iVm Art 21 FS-RL ist von der Behörde entsprechend zu vollziehen.
Das GTG sieht aber noch eine Möglichkeit vor, das Inverkehrbringen von Erzeugnissen zu verbieten. § 63 Abs 2 ermächtigt die Bundesregierung, per Verordnung das Inverkehrbringen von sozial unverträglichen Erzeugnissen zu verbieten. Der BMGK hat, sobald abzusehen ist, daß sozial unverträgliche Erzeugnisse in Österreich in Verkehr gebracht werden könnten, die Gentechnikkommission anzuhören und einen Vorschlag an die Bundesregierung weiterzuleiten. Produkte sind sozial unverträglich, wenn sachlich anzunehmen ist, daß sie „zu einer nicht ausgleichbaren Belastung der Gesellschaft […] führen könnten, und wenn diese Belastung für die Gesellschaft […] nicht annehmbar erscheint“ (§ 63 Abs 1).
Es sei darauf hingewiesen, daß diese Regelung in keiner Weise mit der FS-RL übereinstimmt, sondern dieser eindeutig widerspricht (vgl Art 16 FS-RL).
§ 58 Abs 8 sieht eine Verfahrenskonzentration [314] vor. Zur Genehmigung von Inverkehrbringungen von Pflanzenschutzmitteln, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen, ist die gem Pflanzenschutzmittelgesetz (BGBl 476/1990) zuständige Behörde einzuschalten. Diese hat im Rahmen des Verfahrens nach dem Pflanzenschutzmittelgesetz zusätzlich § 58 Abs 1-7 u §§ 60 f anzuwenden, also das Zulassungsverfahren zum Inverkehrbringen von gentechnischen Erzeugnissen in das Verfahren gem Pflanzenschutzmittelgesetz zu integrieren.
3.2.1.2 – Verpackung und Kennzeichnung
Wie bereits erwähnt, müssen im Antrag auf Genehmigung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die aus GVO bestehen oder solche enthalten, jeweils ein Vorschlag für die Verpackung und für die Kennzeichnung des Erzeugnisses gemacht werden. Die Verpackung soll derart beschaffen sein, daß sie eine unbeabsichtigte Vermehrung von GVO verhüten kann (§ 55 Abs 2 Z 7 lit c). Der Vorschlag für die Kennzeichnung muß zumindest folgende Punkte beinhalten (55 Abs 2 Z 7 lit d)[315]:
– Bezeichnung des Erzeugnisses und der enthaltenen GVO,
– Name und Anschrift des Herstellers oder „EWR-Importeurs“[316] des Erzeugnisses,
– Angaben über die besonderen Eigenschaften, die durch die genetische Manipulation bewirkt werden; genaue Einsatzbedingungen, gegebenenfalls einschließlich der geographischen und Umweltbedingungen, für die das Erzeugnis geeignet ist,
– Beschreibung der zu ergreifenden Maßnahmen im Falle einer unbeabsichtigten Verbreitung,
– Anleitung zur Lagerung und Handhabung.
Verpackung und Kennzeichnung müssen den Vorschlägen des Antrags in der eventuell von der Behörde abgeänderten Fassung entsprechen (§ 62 Abs 1).
In § 62 Abs 2 werden die Erfordernisse an die Kennzeichnung noch einmal angeführt (vgl oben). Dies deshalb, weil die Anforderungen an die Kennzeichnung lt Bescheid nur inter partes gelten, die Anforderungen aber auch für Dritte, zB Händler, gelten sollen.[317]
Gem § 62 Abs 1 u 2 erwächst die Kennzeichnungspflicht erst mit Inverkehrbringung des Erzeugnisses. Es sei dabei auf die unterschiedlichen Definitionen von Inverkehrbringen iSd FS-RL und iSd GTG hingewiesen, woraus nach EG-Recht eine Kennzeichnung schon beim Lagern der Erzeugnisse erforderlich ist.[318]
Auf die Frage, wo die Kennzeichnung anzubringen ist, und in welcher Weise dies zu geschehen hat, wird im GTG nicht näher eingegangen. Außerdem bleibt offen, ob die „Bezeichnung“ der enthaltenen GVO (§ 62 Abs 2 Z 1) miteinschließt, diese GVO auch allgemeinverständlich als solche zu deklarieren, oder ob damit – bloß für fachlich Versierte aufschlußreich – die namentliche Anführung des GVO gemeint ist.[319]
Eine Doppelregelung der Kennzeichnung wird durch § 62 Abs 3 vermieden. Bestehen für bestimmte Arten von Erzeugnissen gleichwertige (auch supranationale) Vorschriften über die Kennzeichnung, sind per Verordnung die Abs 1 und 2 des § 62 für nicht anwendbar zu erklären. Die Verordnung wird vom BMGK im Einvernehmen mit derjenigen Behörde erlassen, die zur Vollziehung desjenigen Bundesgesetzes berufen ist, das die gleichwertigen Vorschriften enthält. Es handelt sich bei dieser Regelung um ein materielles Verschlechterungsverbot.
§ 62 Abs 4 enthält eine weitere Verordnungsermächtigung. Unter bestimmten Voraussetzungen hat der BMGK im Einvernehmen mit dem BMUJF und dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten durch Verordnung zu bestimmen, daß Sachen, die aus Teilen von GVO bestehen oder solche enthalten, nur in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie mit einem oder mehreren der oben angeführten Kennzeichnungselementen versehen sind. Davon ausgenommen sind von GVO und deren Teilen isolierte Sachen.
Interessant ist die Wortwahl „Sachen“. War bisher in bezug auf Inverkehrbringen und Kennzeichnung immer von „Erzeugnissen“ die Rede, so sollen hier „Sachen“ gekennzeichnet werden.[320]
Gelten die Kennzeichnungsregeln im GTG normalerweise für das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die aus GVO bestehen oder solche enthalten, so umfaßt die Verordnungsermächtigung die gewerbsmäßige Abgabe[321] von Sachen, die aus Teilen von GVO bestehen oder solche enthalten.[322]
Die Verpackung und die Kennzeichnung von Produkten sind in der FS-RL ähnlich geregelt. Es werden ebenso detaillierte Vorschläge im Antrag verlangt (Art 11 Abs 1 2. SpStr FS-RL iVm Anhang III). Die nationale Behörde hat dann sicherzustellen, daß die „Verpackung und Etikettierung den Anforderungen entsprechen, die in der schriftlichen Zustimmung […] angegeben sind“ (Art 14 FS-RL). Es wird also davon ausgegangen, daß Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften im Rahmen des EU-Zulassungsverfahrens für den Einzelfall aufgestellt werden und diese dann von der nationalen Behörde dem Antragsteller bescheidmäßig vorgeschrieben werden.
Der Weg der Etikettierung im Zulassungsverfahren sieht vom Vorschlag des Antragstellers bei der zuständigen Behörde in Österreich bis zur Anbringung am Erzeugnis resp Produkt also folgendermaßen aus:
– Vorschlag, der zumindest kurzgefaßt die fünf Punkte des § 55 Abs 2 Z 7 lit d sublit aa bis ee umfaßt (vgl auch Art 11 Abs 1 2. SpStr FS-RL iVm Anhang III B.5 iVm Anhang III A.1, A.2, A.3, B.1 und B.2). Der Vorschlag muß unter Umständen gem FS-RL (Art 11 Abs 1, letzter UAbs) die letzten zwei der fünf Punkte, gem GTG (§ 55 Abs 5) die letzten drei der fünf Punkte cc bis ee nicht berücksichtigen,
– eventuelle Abänderungen im Zulassungsverfahren (§ 58 Abs 5, Art 14 FS-RL) – alle Abänderungen werden durch die nationale Behörde vorgeschrieben, zuerst im Rahmen des nationalen Verfahrens, dann im Rahmen des EU-Verfahrens,
– tatsächliche Kennzeichnung: Sie muß gem Art 14 FS-RL (§ 62 Abs 1) den Anforderungen im Genehmigungsbescheid entsprechen (gilt nicht nur für den Bescheidempfänger) und im österreichischen Recht auch den Anforderungen der obengenannten fünf Punkte (vgl § 62 Abs 2 Z 1 bis 6[323] ).
Zuerst wird also für das Inverkehrbringen die Kennzeichnung gem Bescheid verlangt (§ 62 Abs 1), dann die Kennzeichnung gem § 62 Abs 2. Der Katalog in § 62 Abs 2 Z 1-6 stellt also die Mindestanforderungen an dein Kennzeichnung dar. die Behörde kann darüber hinaus im Bescheid weitere Kennzeichnungselemente vorschreiben. Sollte die Behörde gem § 55 Abs 5 auf bestimmte Kennzeichnungselemente verzichten, sind diese dennoch gem § 62 Abs 2 verpflichtend bei der endgültigen Kennzeichnung anzugeben.
In Anbetracht der Tatsache, daß jene Kennzeichnungselemente, die die Behörde vorschreibt, jene sein sollten, die im Rahmen des EU-Verfahrens in der schriftlichen Zustimmung (gem Art 12 f FS-RL) festgelegt wurden, können also im Einzelfall die vorgeschriebenen Kennzeichnungselemente von jenen der EU abweichen, was diskussionswürdig ist.[324]
Inwieweit dies nämlich in bezug auf die Ziele der FS-RL – insb (Rechtsgrundlage ist Art 100a EGV) auf das Ziel der Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten – sinnvoll ist, sei dahingestellt.
In bezug auf die Etikettierung existiert in Deutschland eine ähnliche Rechtslage wie in der FS-RL, jedoch mit dem Unterschied, daß es keine Kennzeichnungspflicht gibt.
§ 15 Abs 3 Nr 6 GenTG legt ebenfalls die Pflicht des Antragstellers fest, den Antragsunterlagen einen Vorschlag für die Kennzeichnung und Verpackung des in Verkehr zu bringenden Produkts beizuschließen. In der Gentechnik-Verfahrensverordnung (GenTVfV) wird diese Pflicht präzisiert (§ 6 Abs 1 Nr 5 GenTVfV iVm Anlage 3 Teil B Nr 5). Wie in der FS-RL werden hier die bekannten fünf Punkte aufgezählt (Produkt, Hersteller, Eigenschaften, Maßnahmen im Notfall, Lager- und Gebrauchsanleitung). Bis hierher entspricht die Regelung des deutschen Gentechnikrechts fast eins zu eins den Vorgaben der FS-RL. Doch ist im GenTG keine verpflichtende Kennzeichnung vorgesehen. Es wurde zwar mit § 30 Abs 2 Nr 14 GenTG die Verordnungsermächtigung gegeben, sowohl Verpackung und Kennzeichnung überhaupt vorzuschreiben als auch deren Form resp Inhalte, eine entsprechende Verordnung ist aber bisher nicht erlassen worden.
Zwar mag es sein, daß in Deutschland viele Kennzeichnungsregelungen in den einzelnen Produktregelungen enthalten sind[325], dennoch entspricht das GenTG in diesem Aspekt nicht der FS-RL.
3.2.2 – Kennzeichnungsverordnungen
Momentan sind zwei Verordnungen zur Kennzeichnung von gentechnischen Produkten im Entstehen. Es handelt sich zum einen um den Gentechnik-Kennzeichnungsverordnungsentwurf (GT-KennzVE), der auf der Verordnungsermächtigung des § 62 Abs 4 beruht, zum anderen um den Gentechnik-Erzeugnis-Kennzeichnungsverordnungsentwurf (GT-ErzKennzVE), der gem der Verordnungsermächtigung der §§ 10 Abs 1 u 19 Lebensmittelgesetz verordnet werden soll. Die beiden Verordnungen wurden bereits der EU-Kommission notifiziert. Eine positive Reaktion von ihrer Seite war kaum zu erwarten, da in der EU momentan die Novel-Food-Verordnung in Vorbereitung ist. An dieser Stelle sei auf die Problematik des nationalen Alleingangs hingewiesen.[326]
Ursprünglich sollten auf Grund der Verordnungsermächtigung des § 62 Abs 3 vor allem Kennzeichnungsvorschriften der EU – insb in Sachen Novel-Foods – übernommen werden.[327] Da deren Zustandekommen aber im Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs nicht absehbar war, wurden die zwei Verordnungen entworfen.
3.2.2.1 – Gentechnikkennzeichnungsverordnung
Die Gentechnikkennzeichnungsverordnung (GT-KennzV), ist vor allem für die Landwirtschaft und die Industrie (chemische und Textilindustrie) gedacht. Es soll damit dem Konsumenten nicht nur direkt ermöglicht werden, zwischen gentechnisch veränderten und konventionellen Produkten zu unterscheiden, sondern es sollen auch die Voraussetzungen gegeben werden, die dem Konsumenten indirekt die Möglichkeit geben, gentechnikfreie Produkte zu beziehen. Indirekt deshalb, weil dies durch Information in den vorgelagerten Distributionsstufen geschehen muß, damit die Information nicht verloren geht. Diese Regelung gibt daher auch zB den Produzenten und den Zwischenhändlern die Möglichkeit, sich für oder gegen die Gentechnik zu entscheiden. Sowohl der Produzent von Waschmitteln als auch der Landwirt soll diese Möglichkeit bei der Wahl seiner Betriebsmittel haben.
Die GT-KennzV stellt lt Entwurf für das Inverkehrbringen von Produkten [328], die aus (ganzen) GVO bestehen oder solche (nämlich ganze GVO) enthalten, noch einmal klar, daß sie den Kennzeichnungsvorschriften des § 62 Abs 2 unterliegen.[329] Zusätzlich erfordert sie aber die Anbringung eines Hinweises („ Gentechnik-Erzeugnis “).[330]
Für die gewerbsmäßige Abgabe an Dritte von Produkten, die aus GVO hergestellt werden und aus Teilen von GVO bestehen oder solche (nämlich Teile von GVO) enthalten, bedarf es ebenfalls einer – wenn auch weniger rigorosen –Kennzeichnung.[331] Es handelt bei dieser Regelung (§ 1 Abs 2 Z 1-3 GT-KennzVE) sich um die ersten drei Angaben, die auch im GTG verlangt werden (die Z 1-3 des § 62 Abs 2 sind im großen und ganzen nur sprachlich angepaßt[332] ):
– Bezeichnung des Erzeugnisses und des GVO,
– Name und Anschrift des Inverkehrbringers,
– Angaben über die besonderen Eigenschaften.
Zusätzlich bedarf es auch in diesem Fall des Hinweises, daß es sich dabei um ein „ Gentechnik-Erzeugnis “ handelt.
Im der GT-KennzVE wird auch geregelt, wo die Kennzeichnung anzubringen ist. Dabei wird zwischen verpackten Produkten einerseits und nicht verpackten Produkten andererseits unterschieden.
Der Hinweis „Gentechnik-Erzeugnis“ muß bei verpackten Produkten direkt an der Verpackung oder einem damit verbundenen Etikett angebracht sein. Er muß 1. an gut sichtbarer Stelle, 2. deutlich lesbar und 3. dauerhaft angebracht sein und darf nicht durch andere Angaben verdeckt sein (§ 2 GT-KennzVE). Die Angaben gem § 62 Abs 2 GTG[333] dürfen auch auf einem Beipackzettel gemacht werden. Dh wohl, daß sie andernfalls wie der Hinweis „Gentechnik-Erzeugnis“ anzubringen sind.
Durch diese Regelung soll gewährleistet werden, daß der Dritte das Produkt sofort als ein gentechnisches identifizieren kann.
Bei nicht verpackten Produkten ist die Kennzeichnung (inklusive Hinweis) beim Einführen durch entsprechende Angaben in den Begleitpapieren vorzunehmen. Bei jeder sonstigen Abgabe[334] an Dritte muß der Hinweis ebenfalls 1. an gut sichtbarer Stelle, 2. deutlich lesbar und 3. dauerhaft entweder in unmittelbarer Nähe zum Produkt angebracht werden oder in den Begleitpapieren stehen, wo auch die Angaben gem § 1 Abs 1 Z 1-3 GT-KennzVE gemacht werden.
Von der Kennzeichnungspflicht gem § 1 Abs 1 f GT-KennzVE sind gem § 1 Abs 3 GT-KennzVE Arzneimittel (Z 2) iSd Arzneimittelgesetzes und solche Produkte, die ausschließlich in der Medizin oder im GS verwendet werden ausgenommen (Z 3). Des weiteren sind Produkte ausgenommen, die vom GVO isoliert und vom Erbmaterial gereinigt sind (Z 1), weil sie sich ja von konventionell hergestellten Produkten nicht unterscheiden sollten, und Lebensmittel (Z 4), Lebensmittelzusatzstoffe und Verzehrprodukte, die in den Anwendungsbereich der GT-ErzKennzV fallen.
Anderen Kennzeichnungsregelungen des Bundes wird von der GT-KennzV nicht derogiert (§ 4 GT-KennzVE).
3.2.2.2 – Gentechnik-Erzeugnis-Kennzeichnungsverordnung
Die Gentechnik-Erzeugnis-Kennzeichnungsverordnung (GT-ErzKennzV) besagt lt Entwurf (GT-ErzKennzVE), daß Lebensmittel, Verzehrprodukte und Zusatzstoffe, die GVO sind oder daraus gewonnen wurden (kurz: LVZ), sowie Lebensmittel und Verzehrprodukte, die aus obengenannten LVZ hergestellt wurden (kurz: LV), nur mit dem Hinweis „Gentechnik-Erzeugnis“ in Verkehr gebracht werden dürfen (§ 1 Abs 1 f GT-ErzKennzVE).
Die einzige Ausnahme bilden jene Waren, die vom GVO abgetrennt und vom Erbmaterial gereinigt sind (§ 1 Abs 3 GT-ErzKennzVE).
Der Forderung nach Kennzeichnung von Produkten, die mit Hilfe von GVO erzeugt und von diesen abgetrennt werden, ist nicht zuzustimmen, weil sich solche Produkte nicht von herkömmlichen unterscheiden (vgl Erl zu § 1 Abs 3 GT-ErzKennzVE). Diese Meinung hat sich auch in den USA durchgesetzt. Billigung und Abneigung von Produkten soll sich nicht an deren Herstellungsprozeß, sondern an ihnen selbst und ihren Eigenschaften ausrichten.[335] Dennoch gibt es Verfechter der Kennzeichnung auch dieser Gattung von Produkten.[336]
Der Ansatz ist ein anderer als der aus GTG und GT-KennzVE bekannte. Anknüpfungspunkt ist gem § 1 Abs 1 GT-ErzKennzVE nicht die Beinhaltung von oder Bestehen aus GVO oder Teilen von GVO, sondern daß die LVZ (ganze) GVO sind (das entspricht noch dem Tatbestand „Bestehen aus GVO“) oder aus GVO gewonnen werden.
Der zweite Tatbestand ist ein neuer Ansatz. Bei der Produktion müssen GVO (nämlich ganze GVO) als Inputfaktoren verwendet werden, aber alle daraus hervorgebrachten LVZ – egal, ob sie ganze GVO, Teile von GVO oder gar keine GVO aufweisen – sind kennzeichnungspflichtig.
Gem § 1 Abs 2 GT-ErzKennzVE gibt es für die Kennzeichnungspflicht von LV neben der Gewinnung (oder dem Bestehen) aus GVO (wie oben) noch einen zweiten Anknüpfungspunkt, nämlich die Herstellung mittels (unter anderem) obengenannter LVZ.
Der Unterschied zum GTG und zum GT-KennzVE besteht darin, daß vom bewährten ergebnisorientierten Ansatz („die aus […] bestehen oder solche enthalten“) abgegangen wird und stattdessen eine primär prozeßorientierte Formel verwendet wird („die […] daraus [nämlich aus GVO] gewonnen wurden“, „bei deren Herstellung […] verwendet wurden“). Ein weiterer Unterschied liegt darin, daß Erzeugnisse, um in den Anwendungsbereich von GTG oder GT-KennzVE zu fallen, in einem Prozeß erzeugt werden müssen, in dem ganze GVO als Inputfaktoren verwendet werden,[337] während der GT-ErzKennzVE auch bei GVO-Erzeugnissen als Inputfaktoren greifen kann.
Auch dieser Entwurf unterscheidet sinnvollerweise zwischen verpackten und nicht verpackten Sachen.
Bei verpackten LVZ muß der Hinweis „Gentechnik-Erzeugnis“ 1. an gut sichtbarer Stelle, 2. deutlich lesbar und 3. dauerhaft auf der Verpackung oder auf einem mit ihr verbundenen Etikett angebracht sein. Er darf nicht durch andere Angaben verdeckt sein.[338]
Sind verpackte LV ohne weitere Verarbeitung für den Letztverbraucher (oder für die Gemeinschaftsversorgung[339] ) bestimmt, so ist der Hinweis „Gentechnik-Erzeugnis“im sog Sichtfeld anzubringen. Sichtfeld gem § 3 Abs 2 LMKV bedeutet, daß die wichtigsten Kennzeichnungselemente (zB Füllmenge, Haltbarkeitsdatum etc) in einen optischen Zusammenhang gebracht werden sollen.[340]
Von dieser Regelung (Anbringung im Sichtfeld) sind aber Glasflaschen ausgenommen, die zur Wiederverwertung bestimmt sind, und auf denen der Hinweis dauerhaft angebracht ist (§ 3 GT-ErzKennzVE).[341]
Nicht verpackte LVZ sind beim Einführen in den Lieferpapieren mit dem Hinweis „Gentechnik-Erzeugnis“ zu versehen. Beim Lagern, Feilhalten, Verkauf, bei jedem sonstigen Überlassen und beim Verwenden für andere, sofern es zu Erwerbszwecken[342] oder für Zwecke der Gemeinschaftsversorgung geschieht, sind nicht verpackte LVZ durch Anbringung des Hinweises in unmittelbarer Nähe an gut sichtbarer Stelle deutlich lesbar und dauerhaft zu kennzeichnen.
Gilt demnach ein Hinweis in der Speisekarte eines Restaurants nicht als gut sichtbar und in unmittelbarer Nähe? Ist neben die Ketchup aus gentechnisch veränderten Tomaten enthaltende Glasschüssel ein Schild mit dem Hinweis „Gentechnik-Erzeugnis“ auf den Tisch zu stellen? Je nachdem, wie man die unmittelbare Nähe etc zB in der Gastronomie auslegt, können sich verschiedene Fragestellungen ergeben.
Wenn man nun die beiden Entwürfe einander gegenüberstellt, wird ersichtlich, daß sie sich vor allem in folgenden wichtigen Punkten unterscheiden:
Abb11: Vergleich zwischen GT-KennzVE und GT-ErzKennzVE
Die GT-KennzV regelt lt Entwurf neben dem Hinweis „Gentechnik-Erzeugnis“ auch die detaillierte Kennzeichnung zum einen gem § 1 Abs 1 GT-KennzVE iVm § 62 Abs 2, zum anderen gem § 1 Abs 2 Z 1-3 GT-KennzVE. Der GT-ErzKennzVE regelt die Kennzeichnung hingegen nur im Hinblick auf die Kennzeichnung als „Gentechnik-Erzeugnis“. Die übrigen Kennzeichnungsvorschriften sind dem GTG zu entnehmen. Demnach werden nur jene Lebensmittel etc mit den Angaben des § 62 Abs 2 zu versehen sein, die aus (ganzen) GVO bestehen oder solche enthalten.
Außerdem sei nochmals darauf hingewiesen, daß die Kennzeichnungspflicht von nicht verpackten Produkten gem GT-KennzVE erst mit Inverkehrbringen erwächst, gem GT-ErzKennzVE aber bereits mit der Bereitstellung.
3.2.2.3 – „Novel-Food“-Regelung
In der EU wird schon seit längerem die sog „Novel-Food“-Regelung – gestützt auf Art 100a EGV – geplant. Diese Regelung, für die die Form einer Verordnung vorgesehen ist, wird vieleicht noch 1996, vier Jahre nach Vorlage des ersten Entwurfs, beschlossen werden.
Das Europäische Parlament (EP) gab seine Stellungnahme in erster Lesung zum Vorschlag des Rates für die Verordnung Ende 1993 ab.[343] Ende 1995 leitete der Ministerrat den Gemeinsamen Standpunkt an das EP. Dieses überwies den Gemeinsamen Standpunkt an mehrere Ausschüsse, wobei der Ausschuß für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz federführend war.
Der Gemeinsame Standpunkt wurde abgeändert, der Ministerrat konnte die erforderliche Mehrheit nicht erreichen und so mußte Mitte Oktober 1996 gem Art 189b Abs 3 EGV ein Vermittlungsausschuß zwischen Rat und Europäischem Parlament einberufen, der sich am 27. November 1996 auf einen Gemeinsamen Entwurf einigte. Demzufolge ist man von der „Signifikanz“ der Unterscheidung gem Art 8 Abs 1 lit a NF-VE abgekommen. Dafür mußte des Europäische Parlament Abstriche bei seiner Liste der zu kennzeichnenden Produkte machen. Es sollen nur wissenschaftlich nachweisbar manipulierte Produkte gekennzeichnet werden.
Dieser Gemeinsame Entwurf bedarf nun binnen 6 Wochen zur Umsetzung einer absoluten Mehrheit im Europäischen Parlament und einer qualifizierten Mehrheit im Ministerrat (Art 189b Abs 5 EGV).[344] Die Zustimmung im Ministerrat ist quasi sicher, weil alle 15 Mitglieder im Ausschuß vertreten waren. Die Zustimmung des Parlaments ist – obwohl ebenfalls 15 Mitglieder, also nicht einmal 2,5% der Abgeordneten im Ausschuß vertreten waren – sehr wahrscheinlich, weil seine Vorschläge im großen und ganzen behauptet werden konnten.
Die nun zu erlassende Novel-Food-Verordnung – der Entwurf kann nicht mehr abgeändert, sondern lediglich noch verworfen werden – sieht nun folgendermaßen aus.[345]
Gem dem Gemeinsamen Entwurf von Rat und Parlament vom 27. November 1996 (NF-VE) sollten neuartige Lebensmittel und ebensolche Lebensmittelzutaten bei deren Inverkehrbringen gem der Verordnung gekennzeichnet werden. Die Neuartigkeit ist gegeben, wenn die Erzeugnisse bisher noch nicht in nennenswertem Umfang für den menschlichen Verzehr verwendet wurden.[346] Im Zweifelsfall kann nach dem Verfahren des Art 13 NF-VE festgelegt werden, ob ein Lebensmittel oder eine Lebensmittelzutaten in den Anwendungsbereich der Novel-Food-Verordnung fällt. Außerdem müssen die Erzeugnisse solche, die in Art 1 Abs 2 lit a-f NF-VE aufgezählt werden, sein.
Darunter fallen vor allem auch
1. Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die GVO enthalten oder aus GVO bestehen und
2. Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die aus GVO hergestellt wurden, aber keine enthalten (lit a u b)[347] und
3. Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die in einem nicht üblichen Verfahren hergestellt wurden, das eine Veränderung ihrer Zusammensetzung oder Struktur bewirkte, welche sich wiederum auf Nährwert, Stoffwechsel oder Menge unerwünschter Stoffe auswirkt (lit f).
Für die unter unter 1. angeführten Lebensmittel und Lebensmittelzutaten bestimmt Art 9 NF-VE, daß die Art 11-18 FS-RL nicht anzuwenden sind und alle Angaben gem Art 11 FS-RL für das Inverkehrbringen zu machen sind.
Damit die in den Anwendungsbereich der Novel-Food-Verordnung fallenden Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten gem NF-VE in Verkehr gebracht werden können, müssen sie folgende drei Anforderungen erfüllen: Sie dürfen 1. keine Gefahr für den Verbraucher darstellen, 2. den Verbraucher nicht irreführen, 3. keine Ernährungsmängel bei normalem Verzehr (im Vergleich mit den durch sie ersetzten Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten) mit sich bringen (Art 3 Abs 1 NF-VE).
Das Inverkehrbringungsverfahren (Art 4, 6-8 NF-VE) sieht folgendermaßen aus:
Der Antragsteller stellt in jenem Mitgliedstaat, in dem das Erzeugnis erstmals in Verkehr gebracht werden soll, einen Antrag und übermittelt diesen zugleich der EU-Kommission (Art 4 Abs 1 NF-VE). Diese leitet die Unterlagen an die anderen Mitgliedstaaten weiter (Art 6 Abs 2 NF-VE). Der Antragsstaat[348] läßt die Erstprüfung gem Art 6 Abs 2 NF-VE durchführen und übermittelt den binnen 3 Monaten ab Antragseingang von der Prüfstelle verfaßten Prüfbericht (Art 6 Abs 3 NF-VE) unverzüglich der EU-Kommission. Diese leitet den Bericht wieder an die anderen Mitgliedstaaten weiter. Binnen 60 Tagen ab dieser Übermittlung können die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission Bemerkungen oder begründete Einwendungen gegen das Inverkehrbringen der EU-Kommission mitteilen (Art 6 Abs 4 NF-VE).[349] Die Fristen gleichen jenen der FS-RL für Inverkehrbringungen. Im Gegensatz dazu ist das Verfahren mehr zentralisiert.[350] So gibt es zB keine negative Vorabentscheidung im Antragsstaat wie in Art 12 Abs 2 lit b FS-RL.
Der Prüfbericht über die Erstprüfung stellt fest, ob das Lebensmittel oder die Lebensmittelzutat der Verordnung entspricht oder eine ergänzende Prüfung nach Art 7 NF-VE notwendig ist (Art 6 Abs 3 NF-VE). Ist keine solche ergänzende Prüfung nötig und wurden auch keine begründeten Einwendungen erhoben, so muß die nationale Behörde dem Antragsteller mitteilen, daß das Erzeugnis von ihm[351] in Verkehr gebracht werden darf (Art 4 Abs 2 1. SpStr NF-VE). Andernfalls teilt sie ihm mit, daß eine Entscheidung gem Art 7 NF-VE nötig ist (Art 4 Abs 2 2. SpStr NF-VE).
Art 7 NF-VE bestimmt im wesentlichen, daß über die Genehmigung im ständigen Lebensmittelausschuß gem dem Verfahren des Art 13 NF-VE abgestimmt wird. Das Verfahren entspricht dem Art 21-Verfahren der FS-RL (Regelungsausschußverfahren IIIa).[352] Die EU-Kommission unterrichtet den Antragsteller direkt (ohne Umweg über den Mitgliedstaat) und unverzüglich über die Entscheidung (Art 7 Abs 3 NF-VE).
Die Kennzeichnung der zugelassenen Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten zur Unterrichtung der Endverbraucher wird in Art 8 NF-VE geregelt. Sie umfaßt unbeschadet der übrigen Anforderungen iSd gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für die Etikettierung von Lebensmitteln,
– alle Ernährungsmerkmale wie Zusammensetzung, Nährwert und Verwendungszweck (Art 8 Abs 1 lit a), die dazu führen, daß das Novel-Food nicht mehr gleichwertig[353] mit herkömmlichen Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten ist;
– bestimmte Stoffe, wenn sie in bestehenden gleichwertigen Erzeugnissen nicht vorkommen und außerdem die Gesundheit bestimmter Bevölkerungsgruppen beeinflussen können oder auf ethische Vorbehalte stoßen (Art 8 Abs 1 lit b u c);
– vorhandene GVO iSd FS-RL (Art 8 Abs 1 lit d)[354].
In Abweichung von diesem Verfahren gem Art 4, 6-8 NF-VE sieht Art 5 iVm Art 3 Abs 4 NF-VE für bestimmte Lebensmittel und Lebensmittelzutaten eine radikal abgekürztes Verfahren vor, bei dem alleinige Kommissionskompetenz besteht. Die Kennzeichnung dieser Lebensmittel und Lebensmittelzutaten hat nach Art 8 NF-VE zu erfolgen.[355]
Art 12 NF-VE gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Verwendung von Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die der NF-VE genügen, vorübergehend einzuschränken oder auszusetzen, wenn sie stichhaltige Gründe zu der Annahme haben, daß die ihre Verwendung die menschliche Gesundheit oder die Umwelt gefährden. Dies ist insb auch wichtig für Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen, da für sie die Einschränkungsmöglichkeit des Art 16 FS-RL gem Art 9 Abs 1 NF-VE nicht gelten.
Wie man ersieht, ist die Kennzeichnung – in krassem Gegensatz zu den vorigen Entwürfen – wesentlich rigider. Sowohl der Anwendungsbereich der Novel-Food-Verordnung (insb von Bedeutung für die Zulassung), als auch obligatorische Kennzeichnung ist weiter gefaßt als früher geplant. Ein Inkrafttreten ist erst gegen April 1997 abzusehen.[356]
Im Zusammenhang mit den „ Roundup Ready Soybeans “ von Monsanto ist anzumerken, daß diese gem der Novel-Food-Verordnung gekennzeichnet werden müßten. Ebenso wären Sojaschrot und Roh-Lecithin einer Etikettierung zu unterziehen. Lecithin beispielsweise in Schokolade, resp die Schokolade selbst, wäre aber auf Grund des – momentan noch – kaum möglichen Nachweises nicht zu kennzeichnen.[357]
Zum österreichischen GT-ErzKennzVE, gibt es nun kaum einen Unterschied mehr, so daß dessen Erlassung, die ohnehin schon vor dem gemeinsamen Entwurf auf Grund von Diskrepanzen zwischen den zuständigen Ressorts illusorisch schien, eher unwahrscheinlich ist.[358]
Sollte Österreich die Kennzeichnungspflicht gem der zukünftigen Novel-Food-Verordnung dennoch zu „weich“ sein, bliebe noch die Option einer sog „Negativ-Kennzeichnung“ [359] wie etwa „Kein Gentechnikerzeugnis“. Diese wird explizit, allerdings lediglich in den Erwägungsgründen (8B) offengelassen, und zwar kann nicht nur für das Produkt, sondern auch für das Verfahren im Rahmen der Etikettierung entsprechend ausgewiesen werden.
Vor allem folgende Erwägungen waren es, die eine Novel-Food-Verordnung in der zuvor geplanten Form bedenklich erscheinen lassen:
Die Diskussion rund um Novel Food ist von „unmittelbare[r] gesellschaftliche[r] Relevanz“[360] und stellt die Gentechnik in manchen ihrer Anwendungsbereiche grundsätzlich in Frage. Es werden dabei Ängste der Bevölkerung zu Tage gefördert, die auf Grund sowohl der mangelhaften Information als auch der vehementen Weigerung einerseits und des (unverschuldeten) Unvermögens anderseits seitens der Industrie zur Deklaration ihrer Erzeugnisse durchaus verständlich sind.
Es konkurrieren hier also Interessen von Verbraucherinformation und -schutz mit denen der Industrie. Dazu ist anzumerken, daß es unwahrscheinlich ist, daß durch die Zurückhaltung von Informationen die von seiten der Industrie befürchtete Akzeptanzminderung vermieden werden kann.[361] Weiters wird auf das Leitbild des mündigen Verbrauchers verwiesen.[362] Es scheinen hier nationale Abweichungen auf Grund des Art 36 EGV resp der „ Cassis de Dijon “-Prinzipien erwägenswert.[363]
Da mit der Abschaffung der Zölle der nationale Protektionismus bei weitem noch nicht beseitigt war, verbietet Art 30 EGV darüber hinaus grundsätzlich sämtliche mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen[364] sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung [365]. Es sind damit also die „ nicht-tarifären Handelshemmnisse “ oder „non-tariff-trade-barriers“ angesprochen.
Die Auslegung der Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie Einfuhrbeschränkungen ist umstritten. Die mannigfaltige Rechtsprechung des EuGH scheint auch kaum geeignet, systematisch zu klären, welche Maßnahmen als Maßnahmen gleicher Wirkung wie Importbeschränkungen zu werten sind.[366] Die Klassifizierung verbotener, nicht-tarifärer Handelshemmnisse erfolgt durch den EuGH weitgehend kasuistisch.
Er geht prinzipiell von einem sehr weiten Anwendungsbereich des Art 30 EGV aus. Im Fall Dassonville[367] stellt er in der sog „ Dassonville-Formel klar, daß unter den besagten Maßnahmen gleicher Wirkung „jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten fällt, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern“.[368]
Es sind daher nicht nur die offen diskriminierenden Maßnahmen verboten, sondern auch die versteckten Diskriminierungen, die in manchen Maßnahmen, die unterschiedslos auf nationale und importierte Waren anwendbar sind verboten.[369] Auch das deutsche Reinheitsgebot für Bier konnte sich gegen die Dassonville-Formel nicht behaupten. Seit dem Urteil aus dem Jahr 1987[370] müssen auch andere Biere zugelassen werden.
Von diesem in seiner Anwendung durch die Rechtsprechung des EuGH ausgeweiteten Art 30 EGV gibt es allerdings auch Ausnahmen, die den Anwendungsbereich des Art 30 EGV wieder ein wenig einschränken. Gem Art 36 EGV sind Maßnahmen – auch gleicher Wirkung – zulässig, die – unter anderen – aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder zum Schutz der Gesundheit gerechtfertigt sind. Diese Ausnahmebestimmung des Art 36 S 1 EGV wird allerdings in S 2 gleich wieder ein Stück zurückgenommen. Die in S 1 erlaubten „Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen“. „Vorgeschobene“ Rechtfertigungen dürfen also nicht vorliegen.[371]
Auch der EuGH hat die exzessiv genutzte Dassonville-Fomel eingeschränkt. Im Cassis-de-Dijon-Urteil [372] stellte er klar, daß „Hemmnisse für den Binnenhandel der Gemeinschaft […] hingenommen werden [müssen,] soweit diese Bestimmungen notwendig sind, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden, insbesondere den Erfordernissen […] des Schutzes der öffentlichen Gesundheit […] und des Verbraucherschutzes“. Diese Einschränkung gilt nur, wenn die beanstandeten Regelungen unterschiedslos, also gleichermaßen auf in- und ausländische Erzeugnisse angewendet werden.[373]
Später fügte der EuGH zu den Rechtfertigungskriterien vor allem noch den Umweltschutz als zwingendes Erfordernis iSd Cassis-Formel hinzu.[374]
Im Unterschied zu Art 36 EGV sind die Cassis-Kriterien nur dann relevant, wenn die Maßnahme unterschiedslos angewandt wird, also gleichermaßen auf in- wie ausländische Erzeugnisse angewandt wird.[375]
3.2.2.4 – Zulassungs- versus Kennzeichnungsregime
Insb im Zusammenhang mit der Import- und Inverkehrbringungsgenehmigung für transgene Sojabohnen im April 1996 stellt sich die Frage, welches Instrument zur Abwendung ungewollter Gentechnik-Produkte besser geeignet ist: Verbot oder Kennzeichnungspflicht?
Zwar ist ein Verbot gem Art 16 FS-RL resp Art 12 NF-VE möglich, jedoch ohne (für die EU-Kommission[376] ) schwerwiegende Gründe bestenfalls kurzfristig haltbar. Außerdem sind diese Verbote von Fall zu Fall zu erwägen und daher ein eher kasuistischer Ansatz, der wenig Rechtssicherheit bietet. Daher scheint die einheitliche Kennzeichnungspflicht die effektivere Lösung zu sein. Diese tägliche „Volksabstimmung im Supermarkt“[377] wird aber gerade im Falle „Roundup Ready Soybeans“ zu spät ermöglicht werden. Sowohl die Novel-Food-Verordnung als auch eine allfällig doch noch zustande kommende GT-ErzKennzV kommen dafür zu spät.
In Zukunft könnte es aber so sein, daß die relativ weitgehende Kennzeichnungspflicht der Novel-Food-Verordnung dafür Sorge trägt, daß in den meisten Fällen niemandem Gentechnik-Erzeugnisse aufgedrängt werden, der dies nicht wirklich will.[378]
3.2.3 – EU-Zulassungen 1996
Im ersten Halbjahr 1996 wurden drei Produkte zugelassen, die GVO enthalten. Diese sind 1. herbizidresistente Rapssamen[379], 2. herbizidresistente Chicoree-Pflanzen[380], 3. herbizidresistente Sojabohnen[381]. Zwei vor 1996 eingebrachte Anträge – insekten- und herbizidresistenter Mais und herbizidresistente Rapssamen – sind noch nicht abgeschlossen. Weitere vier, bisher noch nicht abgeschlossene Anträge wurden in den Monaten Jänner bis Juni gestellt.
Die Produkte 1. und 2. dürfen lt Genehmigung nicht zu Lebens- und Tierfuttermittelzwecken eingesetzt werden. Sie sind insofern harmloser als die gegen das firmeneigene Herbizid „Roundup“ resistente Sojabohnen der Firma Monsanto, deren im April 1996 durch die EU-Kommission erteilte Genehmigung die Einfuhr und die Weiterverarbeitung zu nichtvermehrungsfähigen Produkten umfaßt. Sojabohnen, resp ihre Verarbeitungsprodukte finden sich in rund 60%[382] aller Lebensmittel. Sojaöl und Sojalecithin als Emulgator für (unter Umständen Soja-) Öl sind zB in Schokolade und Teigwaren enthalten. Der Sojaschrot dient zur Herstellung von Müsli und Futtermittel.[383] Die Identifizierung der transgenen 2% der Gesamternte ist deswegen so schwierig, weil die Bohnen mit konventionelle Soja vermischt sind.
Auf Grund dieser „Allgegenwärtigkeit“ von (in Zukunft transgener) Soja haben vor allem Österreich, Dänemark und Schweden erhebliche Bedenken und erwägen, ein vorübergehendes Importverbot gem Art 16 FS-RL zu verhängen. Dementsprechend bemühten sich diese drei gemeinsam mit Deutschland im Vermittlungsausschuß zwischen Europäischem Parlament und EU-Ministerrat um eine umfassende Kennzeichnung von Novel-Food im Sinne des Parlaments.[384]
Das Verfahren zum noch nicht genehmigten, insekten- und herbizidresistenten Mais [385] von Ciba-Geigy/Novartis sah folgendermaßen aus:
Zuerst erfolgte die Anmeldung bei der national zuständigen Behörde in Frankreich. Nach der Übermittlung der befürwortenden Stellungnahme an die EU-Kommission und Weiterleitung an die Mitgliedstaaten erhob Österreich neben anderen Mitgliedstaaten begründete Einwendungen. Damit war der Weg zum Art 21-Verfahren geebnet. Der Art 21-Ausschuß konnte sich zu keiner qualifizierten Mehrheit für die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen durchringen (25. April 1996), worauf der Umweltministerrat mit der Angelegenheit zu befassen war. Dieser sprach sich am 26. 6. 1996 mit mehrheitlich gegen das Inverkehrbringen aus. Nur noch das Antragsland Frankreich war mit seinen 10 Stimmen dafür. Da der Rat keine einstimmige Ablehnung erzielte, müßte die EU-Kommission „die vorgeschlagenen Maßnahmen“ erlassen (Art 21 UAbs 5 FS-RL).
Auf Drängen von Österreich und einiger Umwelt- und Verbraucherorganisationen[386] wurde die Entscheidung von der Kommission aufgeschoben, sie beauftragte drei ständige Ausschüsse (Lebensmittel-, Futtermittel- und Pflanzenschutzmittelausschuß) mit der Untersuchung der Risken des Erzeugnisses. Am 31. August lief die Frist des Rats ab. Die Kommission sollte – zwei Tage nach der Stellungnahme der drei Ausschüsse – am 13. November 1996 über den Antrag entscheiden. Diese Entscheidung wurde aber neuerlich auf Mitte Dezember vertagt.
4. Kapitel – Haftpflicht und Patentierung
4.1 – Haftpflicht
Das GTG verfügt über keinerlei Haftungsregelungen. Auch die FS-RL behandelt das Haftungsthema nicht. Es kommen so in beiden Fällen nur allgemeine Haftungsregeln in Betracht, die den spezifischen Gefahren der Gentechnik nicht immer gerecht werden können. Obwohl die FS-RL Art 100a EGV als Rechtsgrundlage hat, ihr Sinn also die Harmonisierung des Binnenmarkts ist, werden durch den Verzicht auf eine spezifische Haftungsregleung immense Wettbewerbsverzerrungen in Kauf genommen.[387]
Probleme des Schadenersatzrechts in der Gentechnik sind vor allem unzureichende Erfahrung und mangelndes Wissen um die Kausalzusammenhänge. Vor allem sind die langen Kausalketten praktisch nicht mehr zurückzuverfolgen. Es erheben sich Fragen wie: Ist für einen von einem freigesetzten GVO, der in der Natur weitermutierte, bewirkten Schaden Ersatz vom Freisetzer zu verlangen?
Es soll im folgenden analysiert werden, welche Haftungsregeln für die Gentechnik von Bedeutung sein könnten.
4.1.1 – Verschuldensabhängige Haftung
Verschuldensabhängige Haftung wird im allgemeinen ausgeschlossen, wenn alle Vorschriften (materiell-gesetzliche im Hinblick auf Schutzgesetzverletzung; auch unverbindliche im Hinblick auf die Verletzung von geschützten Gütern[388] ) eingehalten werden.[389] Es wird daher fast immer ein sozialadäquat zumutbares Restrisiko [390] geben – auch bei der verschuldensunabhängigen Haftung –, das allein der Geschädigte zu tragen hat.[391]
4.1.1.1 – Schutzgesetze
Schutzgesetze sollen „zufälligen Beschädigungen“ (§ 1311 S 2 ABGB) vorbeugen und enthalten dazu konkrete Verhaltensnormen. Wer gegen ein solches Schutzgesetz verstößt, wird schadenersatzpflichtig. Allein die Übertretung der Schutznorm kann schadenersatzpflichtig machen, auch wenn keine konkrete Gefährdung dadurch auftrat wohl aber Schaden („ abstraktes Gefährdungsverbot “). Durch Verletzung von Schutzgesetzen wird auch die abstrakte „Verletzungen von Rechtsgütern, die – weil sie nicht mit absoluter Wirkung ausgestattet sind – sonst keinen Schutz genießen würden, rechtswidrig“[392] gemacht.
Schutzgesetze finden sich sowohl im Privatrecht als auch im öffentlichen Recht (vor allem im Verwaltungs- – so zB die Informationspflichten im GTG – und im Strafrecht). Es wird dort keine schadenersatzrechtliche Regelung getroffen, im Schutzgesetz findet sich nur der Verhaltenstatbestand, an den § 1311 ABGB anknüpft.
Der Begriff Schutzgesetz bedeutet nicht Gesetz im formellen Sinn, sondern es sind die einzelnen Bestimmungen in Gesetzen, aber auch Verordnungen oder Bescheide gemeint. Zur Qualifizierung von Schutzgesetzen ist zu sagen, daß im Zweifel jede Verbots- oder Gebotsnorm, die einen bestimmten Schutzzweck hat, der nicht nur auf das Allgemeininteresse gerichtet ist, als Schutzgesetz gilt.[393]
Zur Beweisfrage ist zu sagen, daß der Geschädigte neben dem Schaden nur das Übertreten der Schutznorm durch den Schädiger beweisen muß. Dies indiziert Kausalität und Rechtswidrigkeitszusammenhang (sog Anscheins- oder prima-facie-Beweis, vgl dazu unten). Damit einher geht die Beweislastumkehr des § 1298 ABGB. Der Beschuldigte kann sich von der Haftung befreien, wenn er die Kausalitäts- oder die Rechtswidrigkeitsvermutung zweifelhaft macht. Dazu genügen Argumente, die wahrscheinlicher als jene des Geschädigten sind.[394]
4.1.1.2 – Geschützte Rechtsgüter
Die schuldhafte Verletzung von geschützten Rechtsgütern (zB Leben, Gesundheit, Eigentum) ist rechtswidrig und macht den Schädiger haftpflichtig. Das von der Lehre entwickelte Institut der geschützten Güter stützt sich auf § 1295 Abs 1 ABGB.[395] Der Unterschied zur Haftung aus Verletzung von Schutzgesetzen besteht darin, daß in diesem Fall die geschützten Güter definiert werden, aber keine Verhaltensmaßstäbe angegeben werden.[396] Die Verhaltenspflichten müssen dann der praktischen Übung entnommen werden. Die normative Kraft des Faktischen wächst mit der Dauer der Übung[397], was bedeutet, daß es in der relativ jungen Sparte der Gentechnik noch keine allzu große normative Kraft der praktischen Usancen gibt. Richtlinien können hier zur Orientierung dienen. Sind diese Richtlinien verbindlich, können sie ev sogar als Schutzgesetze (vgl oben) gelten.[398]
Auch hier kommt der prima-facie-Beweis zur Anwendung. Es müssen also auch hier Tatsachen bewiesen werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale hinweisen, der Anscheinsbeweis wird durch zumindest gleich wahrscheinliche Schlüsse zulassende Tatsachen entkräftet.[399] Allerdings muß der Geschädigte im Falle der Verletzung geschützter Rechtsgüter nicht nur (wie bei der Schutzgesetzverletzung) den Schaden und die Verletzung (hier: Rechtswidrigkeit) beweisen, sondern auch die Kausalität und das Verschulden des Schädigers.[400]
Wie man sieht, ist der Geschädigte bei der bloßen Verletzung von geschützten Rechtsgütern in einer schlechteren Position als im Falle der Verletzung eines Schutzgesetzes. Nimmt man aber für den Bereich der Gentechnik Verkehrssicherungspflichten an, so ist der in seinen geschützten Rechten Verletzte so gestellt, als wäre eine Schutznorm (, die die Verkehrssicherung im Rahmen der üblichen Sicherheitsvorkehrungen vorschreibt,) übertreten worden (vgl dazu oben).[401]
4.1.2 – Gefährdungshaftung
4.1.2.1 – Produkthaftung
Das Produkthaftungsgesetz 1988 (PHG) regelt die Haftung von Unternehmern für Schäden, die durch von ihnen in Verkehr gebrachte Produkte verursacht werden.
Unternehmer ist derjenige, der das Produkt hergestellt oder in den EWR eingeführt hat und es auch in Verkehr gebracht hat. Darunter würden also die Betreiber von gentechnischen Anlagen etc iSd § 4 Z 18 fallen sowie die Hersteller oder Importeure iSd § 55 Abs 1. Betreiber von Einrichtungen zur Durchführung von Genanalysen und somatischen Gentherapien erzeugen weder ein Produkt noch setzen sie eine Produkt in Verkehr, womit sie von der Produkthaftung nicht betroffen sind.
Gehaftet wird für fehlerhafte Produkte. „Produkt ist jede bewegliche körperliche Sache, auch wenn sie […] mit einer unbeweglichen Sache verbunden worden ist“ (§ 4 S 1 PHG). GVO fallen definitiv in diese Kategorie.
Seit der Änderung des PHG durch Art II GTG sind land- und forstwirtschaftliche Naturprodukte (das sind Boden-, Viehzucht- und Fischereierzeugnisse), die GVO iSd GTG sind[402] und noch keiner ersten Verarbeitung unterzogen wurden, auch Produkte iSd PHG (§ 4 letzter S). Nicht erfaßt im Produktbegriff sind jedoch unverarbeitete land- und forstwirtschaftliche Naturprodukte, die keine GVO sind, sondern bloß aus ihnen oder ihren Teilen bestehen oder solche enthalten[403]. Nach der Verarbeitung sind allerdings alle Produkte, also auch solche aus Teilen von GVO, Produkte iSd PHG.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb12: Produkteigenschaft von land- und forstwirtschaftlichen Naturprodukten gem PHG
Was fehlerhaft ist, wird zwar nicht immer ganz klar sein; in § 5 Abs 1 PHG heißt es jedenfalls: „Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die man unter Berücksichtigung aller Umstände zu erwarten berechtigt ist“. Zu diesen „Umständen“ zählen auch die Gebrauchsanweisungen. Mangelhafte Anleitung (sog Instruktionsfehler), etwa in Form einer unverständlichen Gebrauchsanweisung eines Produktes, bedeutet fehlerhaftes Produkt[404].
Das fehlerhafte Produkt muß vom Unternehmer in Verkehr gebracht worden sein (§ 1 Z 1 u Z 2 PHG). Das Inverkehrbringen ist lt § 6 PHG die Übergabe an einen Dritten. Wichtig ist, daß die Übergabe willentlich erfolgen muß, Unfälle iSd § 4 Z 12 f sind kein Inverkehrbringen iSd PHG.[405]
Die Haftung nach dem PHG ist ausgeschlossen, wenn zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens „die Eigenschaften des Produkts nach dem Stand der Wissenschaft und Technik […] nicht als Fehler erkannt werden konnten“[406] (§ 8 Z 2 PHG). Es handelt sich hier um das sog „Entwicklungsrisiko“, das gerade in jungen Forschungsbereichen nicht zu unterschätzen ist, und für dessen Realisierung der Unternehmer nicht haftet.[407]
Ein weiterer Haftungsauschluß des § 8 PHG gilt, wenn der in Anspruch Genommene nachweisen kann, daß er das fehlerhafte (land- oder forstwirtschaftliche) Naturprodukt, das ein GVO iSd GTG ist, nicht selbst gentechnisch verändert hat. Damit werden vor allem Land- und Forstwirte, aber auch spätere Wirtschaftsstufen von der Produkthaftung für diese Produkte befreit. Der Urheber der gentechnischen Veränderung, der Betreiber der gentechnischen Anlage, in der die Veränderung vorgenommen wird, haftet.
4.1.2.2 – Gesamtanalogie aus anderen Gefährdungshaftungsgesetzen
Da in Österreich – im Gegensatz zu Deutschland – nach der herrschenden Meinung Gefährdungshaftungsgesetze analogiefähig sind, kann im allgemeinen eine verschuldensunabhängige Haftung für gefährliche Sachen, als welche GVO unter Umständen ja durchaus gesehen werden können, angenommen werden. Ob nun die Gefährlichkeit oder Gefahr der einzelnen Anwendung von GVO vergleichbar mit der im bestehenden Gesetz behandelten ist, ist im Einzelfall zu prüfen, was sich aber auf Grund der vagen Risikoprognosen recht schwierig gestalten dürfte. Problematisch bei der Konkretisierung dieses Vorhabens sind aber auch die vielfältigen Unterschiede (zB im Hinblick auf Haftungshöchstgrenzen, zwischen den einzelnen Gefährdungshaftungsgesetzen) so daß es schwer möglich erscheint, solch eine Analogie im Detail zu begründen.
Wäre diese Form der Haftung praktisch umzusetzen, würde sie beim Großteil der künftig möglichen Schadenersatzansprüche zur Anwendung gelangen und die Frage nach gentechnikspezifischer Haftungsregelung würde sich gar nicht mehr stellen.
Selbst wenn dieser Weg praktisch gangbar wäre, wäre es angesichts der unsicheren Einstellung der Judikatur gegenüber der Gefährdungshaftungsanalogie im Bereich der Gentechnik unverantwortlich, sich auf dieses Instrument zu verlassen.[408]
4.1.2.3 – Gefährdungshaftung für Anlagen
Gem § 79 Gewerbeordnung (GewO) hat die gem GewO zuständige Behörde auch nach der Genehmigung einer Anlage die nach dem Stand der Technik erforderlichen nachträglichen Auflagen für diese Anlage vorzuschreiben, die den hinreichenden Schutz des Nachbarn gewährleisten sollen. Tut sie das nicht, bedeutet das nicht, daß der Anlagenbetreiber bloß auf Grund von Einhaltung der Auflagen zivilrechtlich nicht für von der Anlage verursachte Schäden haftet.[409]
In seinem Urteil vom 11. 10. 1995[410] entschied der Oberste Gerichtshof (OGH) unter anderem, daß „[e]ine rechtskräftige Betriebsanlagengenehmigung nicht schlechthin alle Eingriffe in das Eigentum auf Nachbargrundstücken zu rechtmäßigen [macht], gegen die bei Gericht nicht auf Abhilfe gedrungen werden könnte“ und „die seinerzeit die Rechtswidrigkeit ausschließende materiell-öffentlichrechtliche Beurteilung, […] für das Rechtmäßigkeitsurteil der Gerichte nicht mehr bindend“ ist. In diesem Zusammenhang sprechen Kerschner–Raschauer [411] von der „Emanzipation des Privatrechts vom öffentlichen Recht“ und von einer „Absage an eine […] Verwaltungsakzessorietät des Privatrechts“.
§ 364a ABGB[412] war bisher als Schutzschild auf Dauer verstanden worden.[413] Nachträgliche nachbarrechtliche Einwendungen gegen Immissionen genehmigter Anlagen sollten damit unterbunden werden. Man sprach in diesem Zusammenhang von der „Versteinerungswirkung der Anlagengenehmigung“. Nunmehr wird die Genehmigung iSd § 364a ABGB auf Grund der nachträglichen Änderung der Verfassungsrechtslage durch Art 6 Menschenrechtskonvention (MRK) aber anders ausgelegt. Damit sie als Genehmigung iSd § 364a gilt, muß im Genehmigungsverfahren dem Nachbarn grundsätzlich das rechtliche Gehör zugestanden haben. Nicht als rechtliches Gehör läßt Bußjäger [414] eine bloß „faktische Anhörung“ gelten.[415]
Dieses rechtliche Gehör ist auch dann nicht gegeben, wenn sich „nachträglich die Sach- oder Rechtslage geändert hat [… und] nach dem letzten Stand von Stand von Wissenschaft und Technik neue Gefahren erkennbar bzw vermeidbar geworden sind“[416].
Zusammenfassend läßt sich dazu also sagen, daß es gegen Immissionen von behördlich genehmigten Anlagen nun doch nachbarrechtliche Unterlassungsansprüche gibt. Dies gilt, wenn
1. sich die Interessenlage nach Erlassung des Betriebsanlagengenehmigungsbescheides geändert hat. Dies kann auf Grund einer Fehleinschätzung der Behörde, aber vor allem auch durch Veränderungen im Stand von Stand von Wissenschaft und Technik geschehen sein; oder
2. dem Nachbarnn kein rechtliches Gehör iSd Art 6 MRK zukam.
Für die Gentechnik bedeutet dies, daß der Anlagenbetreiber für von seiner Anlage verursachte Schäden auch dann haften kann, wenn er alle Auflagen bescheidgemäß erfüllt, nämlich dann, wenn der Bescheid nicht mehr dem Stand von Wissenschaft und Technik entspricht. Weiters vertritt die Lehre die Ansicht, daß gegen Gefahren für die Gesundheit und das Leben der Nachbarn auf jeden Fall ein Unterlassungsanspruch verfügbar ist.[417]
4.1.2.4 – Gefährdungshaftung im deutschen Gentechnikrecht
Im deutschen GenTG werden im 5. Teil die Haftungsvorschriften für Schäden durch GVO normiert. Anknüpfungspunkt sind gem § 32 Abs 1 GenTG die „Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen“. Die Haftpflicht des Betreibers[418] erwächst bei Tötung, Verletzung von Gesundheit oder Körper und Sachbeschädigung. Der Umfang der Ersatzpflicht reicht vom Ersatz der Kosten der Beerdigung bis zum Ersatz des Unterhalts eines nasciturus, allerdings existieren – wie im deutschen Recht bei Gefährdungshaftungen üblich[419] – keine Schmerzengeldansprüche. Insgesamt reicht die Haftung bis zum Haftungshöchstbetrag von umgerechnet etwa 1,1 Milliarden Schilling (§ 33 GenTG). Zur Sicherstellung des nötigen Haftungsfonds, wird in § 36 GenTG eine Deckungsvorsorge vorgeschrieben. Diese kann insb in Form einer Haftpflichtversicherung oder einer Freistellungs- oder Gewährleistungsverpflichtung des Bundes oder eines Landes erbracht werden.
4.1.3 – Zivilrecht statt Ordnungsrecht?
In den USA gibt es keine zusammenhängende Regelung der Gentechnik. Vielfach ist man auf Grund der enormen Haftungspflichten gezwungen, jede Schädigung zu vermeiden und dazu fachspezifische Richtlinien einzuhalten. Eine gleichsam allein auf dem Haftungsrecht basierende Regelung scheint aber auch keine gelungene Lösung zu sein. So sollen US-amerikanische Forschungsinstitute und Firmen schon des längeren fordern, daß die Haftungsregelungen entschärft werden und dafür die Regulierung verstärkt wird.[420] Es macht sich ein Streben nach Berechenbarkeit , nach Planungssicherheit und somit nach Rechtssicherheit bemerkbar.
Es ist daher – nicht nur auf Grund der österreichischen Rechtslage – eine Gentechnikregulierung über das Haftungsrecht nicht als Alternative zum Ordnungsrecht zu sehen.
4.1.4 – Resumee
Es ist nun ersichtlich, warum der Schutz durch die Generaltatbestände des Schadenersatztrechts vor Schaden resp der Ersatz desselben lt Welser unzureichend ist. Auch trotz der vielen Möglichkeiten, bestehende sondergesetzliche Vorschriften in den Regelungsbereich der Gentechnik einfließen zu lassen, ist der Schutz oft lückenhaft und eher zufällig denn beabsichtigt.[421]
Eine verschuldensabhängige Haftung wird der potentiellen Gefährlichkeit von GVO und Sachen aus GVO bei weitem nicht gerecht. Aber auch vertikale Gefährdungshaftungsregeln greifen nur lückenweise im Bereich der Gentechnik. Immer wieder wird festgestellt, daß die Ausklammerung der Umwelthaftung (mit Verweis auf ein zu erlassendes Umwelthaftungsgesetz) einen „gravierenden gesetzlichen Mangel“ darstellt.[422] Ein – wie in Deutschland – in das Gentechnikrecht integriertes Haftungsregime, das auf dem Prinzip der Gefährdungshaftung basiert, wäre wünschenswert.
4.2 – Patentierung
Sinn der Patentierung von Erfindungen ist, daß der Erfinder den Gegenstand der Erfindung exklusiv verwerten kann, um so seine bei Forschungs- und Entwicklungsarbeiten angefallenen Investitionen amortisieren zu können.
Im Patentgesetz 1970 idgF (PatG) wird die Patentierung – auch von gentechnologischen – Erfindungen geregelt.
4.2.1 – Allgemeine Voraussetzungen
Gem § 1 Abs 1 PatG sind „Erfindungen, die neu sind […], sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind“, patentierbar.
Zuerst ist also zu klären, ob GVO, gentechnologische Verfahren und Genprodukte die allgemeinen Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen. Es muß in diesem Sinne
1. sich um eine Erfindung handeln. Im Gegensatz zur Entdeckung darf sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Die bloße Identifizierung einer DNA-Sequenz gilt als Entdeckung. Damit eine technische Anwendung aber möglich wird, müssen die sog Introns, die unter Umständen bei der Expression eines Gens im Wirtsorganismus störend sein können, aus dieser Sequenz eliminiert werden. Diese Leistung ist keine bloße Entdeckung mehr, sondern eine Erfindung.
2. die Erfindung neu sein, also nicht zum Stand der Technik gehören.
3. die Erfindung gewerblich anwendbar sein. Für die gewerbliche Anwendung, aber auch für die Offenbarung, auf Grund derer der Fachmann die Erfindung ausführen kann, wird das Kriterium der Wiederholbarkeit aufgestellt. Diese Anforderung wird bei zu patentierenden Mikroorganismen etwas zurückgeschraubt. Statt der Offenbarung (Beschreibung und Nachvollziehbarkeit) genügt unter Umständen auch bloß die Hinterlegung einer Kultur des Mikroorganismus (§ 87a Abs 2 PatG).
Man kann erkennen, daß die Kriterien recht stark an den Stand der Technik und somit die Technik überhaupt angelehnt sind. Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung stellt eine Erfindung „die Lösung einer technischen Aufgabe mit technischen Mitteln“[423] dar. Die belebte Natur war schon oft Thema des Patentrechts und wird es auch immer öfter sein. Der Begriff „technisch“ wird also insofern weiter interpretiert, als technische Verfahren auch an lebender Materie als technisch gelten, ebenso die Produkte dieser Verfahren und unter anderem auch Lebewesen.
4.2.2 – Spezielle Voraussetzungen und Sittenklausel
Im Rahmen der Gentechnologie stellen sich im Zusammenhang mit der Patentierung die speziellen Fragen, ob Lebewesen patentierbar sind, und ob diverse gentechnische Verfahren und daraus resultierende Produkte patentierbar sind.
§ 2 Z 3 PatG nimmt Pflanzensorten und Tierarten (Tierrassen) sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit aus. Im zweiten Teilsatz wird – als Ausnahme des ersten Teilsatzes – festgelegt, daß Mikroorganismen sowie mikrobiologische Verfahren und deren Produkte patentierbar sind.
Dabei ist anzumerken, daß in der Praxis des Europäischen Patentamtes (EPA) zwischen Pflanzensorten und Pflanzen unterschieden wird. Pflanzensorten, die sich auf Grund bestimmter Merkmale von anderen Sorten derselben Pflanze unterscheiden, fallen unter den Sortenschutz und sind vom Patentschutz ausgenommen. Wird aber eine neue Pflanze geschaffen, kann also nicht nur eine bestimmte Sorte, sondern können alle Sorten dieser Pflanze in einer Eigenschaft verändert werden, so ist diese Erfindung sehr wohl patentierbar.
Der Sortenschutz stellt gegenüber dem Patentschutz wesentlich weniger weitreichende Ansprüche zur Verfügung. 1. bleibt das Landwirteprivileg [424] erhalten, 2. ist es auf Grund des Züchtervorbehaltes möglich, die geschützte Pflanze als Ausgangsmaterial für die Weiterzüchtung zu verwenden und 3. wird durch den Forschervorbehalt sichergestellt, daß mit der geschützten Sorte weitergeforscht werden kann.[425]
Da Pflanzensorten bereits gewerblich geschützt werden konnten, hatte das EPA keine Bedenken, auch Pflanzen als solche gewerblich zu schützen – eben durch das Patentrecht[426]. Für Tierarten gibt es aber keine vergleichbare Regelung. Es stellte sich die Frage, ob mit dem Terminus „Tierarten“ bloß Tierarten oder auch der Oberbegriff „ Tiere “ gemeint war.[427] Es wurde der grammatikalischen Interpretation der Vorzug gegeben, womit nur Tierarten vom Patentschutz ausgenommen sind, Tiere als solche aber patentierbar sind.[428]
Eine allgemeine, aber für die spezielle Thematik besonders bedeutsame Regelung wird in § 2 Z 1 PatG getroffen: Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, sind nicht patentierbar.
Die Patentierung von Tieren kann gegen die guten Sitten verstoßen – wie das in der Diskussion um die Patentierung der „ Havard-Krebs-Maus “[429] von manchen vertreten wird. Diese Klausel ist zur Verhinderung von Patenten auf Tiere aber nicht sehr wirksam.[430] Sittenwidrigkeit wird nämlich nicht vom Patentamt, sondern von der Gesellschaft, resp dem Gesetzgeber vorgegeben[431]. Daß die Sittenwidrigkeit kein ausschlaggebendes Kriterium ist, ist auch festzustellen, wenn man bedenkt, daß zB Atombomben patentiert werden.[432] So läßt sich auch ein Tier züchten und patentieren, „das gar keinen Lebensanspruch als Kreatur mehr erfüllen kann“[433]. Das Patentamt kann und darf solche Rahmenbedingungen nicht aufstellen, es kann nur gegen den gesellschaftlichen Konsens extrem verstoßenden Erfindungen die Patentierung verweigern.[434] Das Problem, das sich dabei ergibt, ist, daß es zum Thema Gentechnologie im großen und ganzen – in Europa[435] – noch keinen Konsens gibt.[436]
Zudem hat der Gesetzgeber – zumindest im Falle der Mikroorganismen – ausdrücklich klargestellt, daß ethische Bedenken der Patentierung von Lebewesen nicht prinzipiell entgegenstehen.
Es bleibt darauf hinzuweisen, daß Patente auf Lebewesen nichts Neues sind. Bereits im 19. Jahrhundert gab es zB Patente auf Hefe, später – im Rahmen der Antibiotikaerzeugung – auch auf höherentwickelte Mikroorganismen.[437]
In den USA wird die Meinung vertreten, daß „auch in der Natur nicht vorkommende, vom Menschen hervorgebrachte Lebensformen patentfähige Erfindungsgegenstände sind“[438]. Jedoch kann es aber auch in den USA vorkommen, daß so ein „Produkt“ nicht patentierbar ist. In diesem Fall strebt man danach, den vorangehenden Prozeß zur Herstellung dieses Produkts patentieren zu lassen. Nun war es aber bis 1995 – auf Grund eines äußerst restriktiv interpretierten Urteils – sehr schwer, ein Patent auf den Herstellungsprozeß zu bekommen. Seit 1995 ist es wesentlich leichter, ein Patent über einen Herstellungsprozeß zu erlangen.[439]
Mikroorganismen an sich sind gem § 2 Z 3 2. Teilsatz PatG patentierbar. Zellkulturen von höheren Organismen, also Pflanzen und Tieren, sind nach dem Wortlaut nicht betroffen; sie gelten nicht als Mikroorganismen, (vorerst) auch nicht dann, wenn mit ihnen im mikrobiologischen Bereich, der in Zukunft eine wichtige Rolle für die Abgrenzung patentierbarer (mikrobiologischer) und nicht patentierbarer (biologischer) Organismen spielen könnte, gearbeitet wird.[440]
Mit den mikrobiologsichen Verfahren sind mikrobiologische Verfahren an Mikroorganismen gemeint. Diese Mikroorganismen, erzeugen durch ihren Stoffwechsel bestimmte Stoffe („Genprodukte“). Sowohl die Erzeugnisse als auch die Verfahren zur Erzeugung der Genprodukte sind gem § 2 Z 3 PatG patentierbar.
Waren biotechnologische und somit später auch gentechnologische Verfahren zur Herstellung von bestimmten Stoffen schon früher patentierbar, so sind für die dabei anfallenden Stoffe erst seit dem Fallen des Stoffschutzverbots im Oktober 1987 Patente zu erlangen.
Eine Ausnahme von der Patentierbarkeit von mikrobiologischen Verfahren ergibt sich durch § 2 Z 2 PatG. Demnach sind Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers sowie diagnostische Verfahren am tierischen oder menschlichen Körper nicht patentierbar.
4.2.3 – Volkswirtschaftlicher Nutzen der Patentierung
Zum volkswirtschaftlichen Nutzen der Patentierbarkeit in sog Schlüsseltechnologien ist zu sagen, daß die Patentierung nicht – wie oft argumentiert[441] – von Nachteil, sondern – im Vergleich zum Patentierungsverbot – zum Vorteil der Gesellschaft ist. Denn Investitionen werden nur dort getätigt, Forschung wird nur dort betrieben, wo positive Rahmenbedingungen, incentives für die Forschung bestehen. Ohne diese Anreize ist die Forschung nicht attraktiv, weil nicht lukrativ. Besteht einmal ein Patent, bedeutet dies nicht, daß es keine Forschung mehr auf diesem Gebiet gibt. Wie bei einem Monopol wird versucht, das Patent zu umgehen, das Verfahren oder das Produkt zu verbessern.[442] Die Dauer eines Patents beträgt gem § 28 PatG längstens 20 Jahre ab dem Anmeldetag. Durch lange Verfahren wie etwa bei der Krebs-Maus wird das Patent erst entsprechend später erteilt, was die effektive Dauer des Schutzes verringert.
Es ist jedoch zu beachten, daß dieser gesellschaftliche Vorteil nicht immer mit der Patentierung verbunden ist und auch nicht immer den Grund für eine weitere Rücknahme der Patentierungsverbote darstellt. So wird vermutet, daß Patentierungsverbote vielmehr auch durch Druck „seitens der Industrie, und zwar sowohl auf die Patentverwaltung als auch auf den Gesetzgeber“[443] als infolge neuer Erkenntnisse aufgehoben werden. Berichtet wird beispielsweise, daß das Patentierungsverbot für Arzneimittel in Deutschland auf Grund massiven Drucks von seiten der Industrie aufgehoben wurde.[444]
Dennoch kann der Trend, Lebewesen als solche zu patentieren, neben ethischen auch soziale und wirtschaftliche Probleme mit sich bringen. Aus diesem Grund ist eine EU-Richtlinie über den weitgehenden Schutz biotechnologischer Erfindungen derzeit im Entstehen.
Hier sei kurz der Komplex der Hybridzüchtung, die durch die Gentechnik noch forciert werden kann, deren Probleme aber bereits heute evident sind, angeführt. Saatgut- und Züchtungsindustrie sind bestrebt, die Hybridzüchtung möglichst voranzutreiben und breitere Anwendungsbereiche zu finden. Hybride sind in diesem Sinne Mischlinge, die alle ein bestimmtes gewünschtes Merkmal aufweisen (gleicher Phänotyp). Entweder geht dieses Merkmal in der nächsten Generation wieder verloren oder die Hybride sind überhaupt unfruchtbar. Es wird damit verhindert, daß der Abnehmer des Züchters die gekauften Stämme mit ihren Eigenschaften nach Belieben selbst vermehren kann. So muß zB der Bauer seine Samen wieder beim Züchter kaufen, wenn er auf diese Eigenschaft nicht verzichten will. Man spricht in diesem Zusammenhang vom Verlust des „farmer’s privilege".[445]
5. Kapitel – Kritik und Ausblick
5.1 – Kritik
Das GTG regelt neben den durch die beiden EU-RL vorgeschriebenen Themenkreisen Freisetzung von GVO und Inverkehrbringen von GVO-Erzeugnissen sowie Anwendung von GVM in GS auch Arbeiten mit anderen GVO im GS und die Gentherapie und -analyse am Menschen.
Das im internationalen Vergleich recht weitreichende Regelwerk ist neben den beiden RL vor allem am deutschen GenTG orientiert, geht mit der Regelung der humanmedizinischen Anwendung der Gentechnologie über dieses hinaus und bleibt in bezug auf die gentechnisch-spezifische Haftungsregelung hinter diesem zurück.
In dieser Arbeit sind einige Umsetzungsdefizite bei der Transformation der beiden EU-RL in nationales Recht aufgezeigt worden.[446] ZB gibt es Differenzen bei der Fristenhemmung im Rahmen des Anhörungsverfahrens. Der Begriff des Inverkehrbringens des GTG ist enger gefaßt als dies in der FS-RL vorgesehen ist (vgl § 4 Z 21 u Art 2 Z 5 FS-RL). Die Ausnahmen von den Genehmigungs- und Wartefristen gem § 24 weichen von den Fristen gem Art 11 Abs 4 u 5 S-RL ab. Die Regelung der sozialen Unverträglichkeit gem § 63 Abs 1 existiert in der FS-RL überhaupt nicht und widerspricht Art 16 FS-RL.
Es sei darauf hingewiesen, daß insofern ein Anpassungsbedarf der österreichischen Regelung an die der EU erforderlich ist. Solange diese Anpassung noch nicht erfolgt ist, können in diesen Fällen die EU-RL unter Umständen unmittelbare Wirkung entfalten.[447] Die Voraussetzungen dafür sind, daß die Umsetzung nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erfolgt ist; daß die betreffende Bestimmung der RL inhaltlich unbedingt und hinreichend bestimmt ist.
Alle diese Voraussetzungen sind zB im Fall der Genehmigungs- und Wartefristen gegeben, woraus folgt, daß die Ausnahmen zB in § 24 Abs 4 nicht gelten dürften. Jedoch gibt es nach der Rechtsprechung des EuGH keine unmittelbare Wirkung zu Lasten, sondern nur zugunsten Dritter. Daher sind die gem S-RL für den Dritten strengeren Regeln nicht anzuwenden.[448] Problematisch wird diese Regel aber, wenn sich die nicht umgesetzte Vorschrift einer EU-RL für den einen vorteilhaft, für den anderen nachteilig auswirkt.[449]
Die Entscheidung, ein eigenes Gentechnikgesetz zu erlassen, ist im Hinblick auf die Alternative einer konfusen Streunormierung eine gute. Löblich ist auch die umfangreiche Vorbereitungsarbeit für dieses Gesetz. Unverständlich bleibt es jedoch, wieso auf die vielen fundierten Analysen oftmals nicht oder nur ungenügend zurückgegriffen wurde. Wieso sind manche Vorschläge zB der Enquete-Kommission, die auch EU-rechtskonform wären, nicht umgesetzt worden? Es fehlen von der Warte der Enquete-Kommission aus insb ein maßgeschneidertes Anlagenregime, ein ebensolches Haftungsregime und die Behandlung von Menschenwürde- und Patentierungsfragen.
Ein weiteres Problem ist das Nebeneinander von zuständigen Entscheidungsträgern, das auf der einen Seite durchaus positive Auswirkungen zeigen, auf der anderen Seite jedoch eine Salami- und Hinhaltetaktik hervorbringen kann. So kommen Verordnungen nur im Einvernehmen mit anderen Ressorts zustande, diese blockieren sie, weil sie Regelungen der EU nicht vorwegnehmen wollen – jüngst geschehen im Zusammenhang mit den beiden Kennzeichnungsverordnungen des BMGK. Innerhalb der EU – dieselben Verhaltensweisen: man wartet auf den ersten Schritt anderer, zB der USA. Man will die Entscheidung einem anderen überlassen.
Es zeigt sich, daß ein Konsens Zeit benötigt. Je mehr Gremien – Walter–Mayer (Rz 152) sehen eine Besetzung von Gremien durch Interessensvertreter nicht als Erweiterung der demokratischen Legitimationsbasis, sondern als Einführung ständestaatlicher Strukturen – eingesetzt werden, sei es national oder international, desto länger dauern die Verfahren, was in Anbetracht mancher virulenter Probleme von immensem Nachteil sein kann.
Viele der vorgesehenen Durchführungsverordnungen zum GTG sind noch nicht erlassen, obwohl manche durch sie zu regelnde Vorschriften dringend einer Ausformulierung bedurften.
5.2 – Ausblick
Die Reglementierung der Gentechnologie – sowohl inter- und supranational als auch national – ist noch lange nicht abgeschlossen. Es steht eine lange und in bezug auf ihre Ergebnisse nicht absehbare Phase der Verbesserungen und Anpassungen bevor. Anpassungen nicht nur an die wissenschaftlich-technischen und ökonomischen Gegebenheiten, sondern insb auch im Hinblick auf die Haltung der Bevölkerung gegenüber der Gentechnik. Denn die Bevölkerung bestimmt über den wirtschaftlichen Erfolg und Mißerfolg der Gentechnik und ihrer Erzeugnisse. Dort, wo von der Mehrheit durch die Anwendung der Gentechnik gestifteter (allgemeiner) Nutzen gesehen wird, ist die Gentechnik mit ihren Produkten (zB Arzneimittel) auf einer breiten Basis akzeptiert. In jenen Bereichen, wo dieser Nutzen nicht gesehen wird, ist die Bevölkerung dementsprechend skeptisch. Es liegt in diesen Fällen – wie so oft – in den Händen der „Opinion-leader“, die Bevölkerung von der einen oder anderen Warte zu überzeugen. Denn so sehr sich ein Betreiber um die Sicherheit bemühen mag; es werden den noch so gravierenden Vorteilen immer – wenn auch mit der Zeit hoffentlich geringer werdende – Nachteile gegenüberstehen.
Viele grundsätzliche Fragen der Ethik sind noch zu klären, viele biologische Auswirkungen der Gentechnik mit all den unabsehbaren Wechselwirkungen in den Ökosystemen sind abzuwarten, zu beurteilen und Schlußfolgerungen sind daraus zu ziehen.
Zwei äußerst wichtige Punkte in der Gentechnikdebatte sind momentan das kritisierte Zulassungsverfahren zur Inverkehrbringung von Gentechnik-Produkten, mit Schwerpunkt auf den Verzehrprodukten, und die Pflicht zur Kennzeichnung derselben, wiederum mit Schwerpunkt auf den Verzehrprodukten. Diese äußerst kontrovers verhandelten Themen werden uns noch länger beschäftigen. Ein möglicher Nachfolger für Novel-Food als Träger der Gentechnikdebatte wird vielleicht in absehbarer Zeit das Verbot der Keimbahntherapie sein.
Verzeichnis der verwendeten Literatur
Adamovich, Ludwig – Funk, Bernd-Christian: Allgemeines Verwaltungsrecht. Wien et al : Springer, 19873
Backhaus, Horst: „Freisetzung: Risikobeherrschung und Zulassungskriterien“ in Umweltbundesamt [Hg]: Umweltauswirkungen gentechnisch veränderter Organismen. Freisetzungskriterien international und in Österreich. Wien : Umweltbundesamt, 1994, pp 22-31
Biochemie GmbH: „Stellungnahme“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 214-216
Birnstiel, Max L.: „Einführungsvortrag“ in Enquete-Kommission, Band 2 pp 27-42
Bobek, Ernst: „Kennzeichnungspflicht für gentechnisch behandelte Lebensmittel“ in Club Niederösterreich [Hg]: Zankapfel Erdapfel – Gentechnik im Pflanzenbau. Wien : Club Niederösterreich, 1996, Heft 5/96, pp 24-28
Bolognese-Leuchtenmüller: „Gutachten zum Themenschwerpunkt Gesellschaft, Demokratie und Grundrechte“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 115-134
Borchardt, Klaus-Dieter: Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union. Heidelberg : C.F. Müller, 1996
Braun, Rudolf – Fuchs, Werner: „Umweltbiotechnologie“ in Umweltbundesamt [Hg]: Gen- und Biotechnologie. Nutzungsmöglichkeiten und Gefahrenpotentiale. Handlungsbedarf für Österreich zum Schutz von Mensch und Umwelt. Wien : Umweltbundesamt, 1991, pp 1-80
Breier, Siegfried zu Art 145-153 EGV in Lenz, Carl Otto [Hg]: EG-Vertrag. Kommentar zu dem Vertrag zur Gründung über die Europäischen Gemeinschaften. Köln : Bundesanzeiger, 1994, pp 1047-1061
Brünner in StenProtNR XVIII 168, pp 19695-19697
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung [Hg]: Gentechnologie im österreichischen Recht. Wien : BMWF, 1991
Bußjäger, Peter: „Welche Konsequenzen ergeben sich aus OGH 11. 10. 1995, 3 Ob 508/93 für die Praxis im Anlagenrecht?“ in Manz [Hg]: Recht der Umwelt. Wien : Manz, 1996, pp 121-123
Club Niederösterreich [Hg]: Zankapfel Erdapfel – Gentechnik im Pflanzenbau. Wien : Club Niederösterreich, 1996, Heft 5/96
Eberbach, Wolfram – Lange, Peter – Ronellenfitsch, Michael [Hg]: Gentechnikrecht (GenTR). Heidelberg : C.F. Müller, Lbl Stand Februar 1996
Elkington–Burke: The Green Capitalists. How to Make Money – and Protect the Environment. London : Victor Gollancz Ltd , 1989
Endres, Andreas – Rehbinder, Eckhard – Schwarze, Reimund: Haftung und Versicherung für Umweltschäden aus ökonomischer und juristischer Sicht. Berlin et al : Springer, 1992
Enquete-Kommission: Bericht der parlamentarischen Enquete-Kommission betreffend „Technikfolgenabschätzung am Beispiel der Gentechnologie“. 740 BlgNR XVIII. GP (Enquete-Kommission, Band 1)
Enquete-Kommission: Anlage zum Bericht der parlamentarischen Enquete-Kommission betreffend „Technikfolgenabschätzung am Beispiel der Gentechnologie“. Auszugsweise Darstellungen der Beratungen. 740 BlgNR XVIII. GP (Enquete-Kommission, Band 2)
Enquete-Kommission: Anlage zum Bericht der parlamentarischen Enquete-Kommission betreffend „Technikfolgenabschätzung am Beispiel der Gentechnologie“. Gutachten und Stellungnahmen. 740 BlgNR XVIII. GP (Enquete-Kommission, Band 3)
Epiney, Astrid – Möllers,Thomas M.J.: Freier Warenverkehr und nationaler Umweltschutz. Zu dem den EG-Mitgliedstaaten verbleibenden Handlungsspielraum im Europäischen Umweltschutzrecht unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnismässigkeitsprüfung. Köln et al : : Carl Heymanns, 1992
Feil, Erich: Österreichisches Lebensmittelrecht. Band 1. Wien : Linde, 19954(Feil, LMR I)
Feil, Erich: Österreichisches Lebensmittelrecht. Band 2. Wien : Linde, 1995, Stand 1. 6. 1996 (Feil, LMR II)
Feil, Erich: Gentechnikgesetz (GTG). Wien : Linde, 1994 (Feil, GTG)
Gassen, Hans Günter – Martin, Andrea – Sachse, Gabriele: Der Stoff aus dem die Gene sind. München : Schweitzer, 1986
Gaugitsch, Helmut: „Einführung in die Thematik und Ausgangspunkt der Studie“ in Umweltbundesamt [Hg]: Umweltauswirkungen gentechnisch veränderter Organismen. Frei-setzungskriterien international und in Österreich. Wien : Umweltbundesamt, 1994
Gehrlich, Peter: „Gutachten zum Themenschwerpunkt Gesellschaft, Demokratie und Grundrechte“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 135-142
Geiger, Rudolf: EG-Vertrag. Kommentar zum Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft. München : Beck, 1993
Genser, Bernd – Holzmann, Robert: „Öffentlicher Sektor: Finanz- und Sozialpolitik“ in Nowotny, Ewald – Winckler, Georg [Hg]: Grundzüge der Wirtschaftspolitik Österreichs. Wien : Manz, 1994, pp 203-248
Global 2000, Broschüre vom 20. Juni 1996
Goy, Ahl Patricia – Duesing, John, H: „Assessing the Environmental Impact of Gene Transfer to Wild Relatives“ in Bio/Technolgy Vol. 14 January 1996, pp 39-40
Grabitz, Eberhard – Hilf, Meinhard [Hg] in: Kommentar zur Europäischen Union. C.H. Beck : München, Stand Oktober 1995
Groeben, Hans von der – Thiesing, Jochen – Ehlermann, Claus-Dieter [Hg]: Kommentar zum EWG-Vertrag. Baden-Baden : Nomos, 19914
Hakenberg, Waltraud: Grundzüge des europäischen Wirtschaftsrechts. München : Vahlen, 1994
Hallman, William K.: „Public Perceptions of Biotechnology: Another Look“ in Bio/Technolgy Vol. 14 January 1996, pp 35-38
Harnier,Otto zu Art 145 EGV in Groeben, Hans von der – Thiesing, Jochen – Ehlermann, Claus-Dieter [Hg]: Kommentar zum EWG-Vertrag. Baden-Baden : Nomos, 19914, pp 4239-4253
Haupt, Herbert in StenProtNR XVIII 166, pp 19379-19382
Heberle-Bors, Erwin: „Transgene Pflanzen“ in Umweltbundesamt [Hg]: Umweltauswirkungen gentechnisch veränderter Organismen. Freisetzungskriterien international und in Österreich. Wien : Umweltbundesamt, 1994, pp 16-18
Henke, Jörg: EuGH und Umweltschutz. Die Auswirkungen der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften auf das Umweltschutzrecht in Europa. München : V. Florenz, 1992
Hetmeier, Heinz zu Art 189b EGV in Lenz, Carl Otto [Hg]: EG-Vertrag. Kommentar zu dem Vertrag zur Gründung über die Europäischen Gemeinschaften. Köln : Bundesanzeiger, 1994, pp 1232-1239
Hey, Christian: Umweltpolitik in Europa. Fehler, Risken, Chancen. München : Beck, 1994
Höhne, Thomas: „Umweltschützer im Talar“ in Trend 10/96, p 273
Huber, Susanne – Stelzer, Manfred: „Öffentlich-rechtliche Rechtsfragen der Gentechnologie“ in Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung [Hg]: Gentechnologie im österreichischen Recht. Wien : BMWF, 1991, pp 1-189
Hummer,Waldemar zu Art 155 EGV in Grabitz, Eberhard – Hilf, Meinhard [Hg] in: Kommentar zur Europäischen Union. C.H. Beck : München, Stand Oktober 1995
Ibelgaufts, Horst: Gentechnologie von A-Z. 1., korrigierter Nachdr.,Studienausg. Weinheim et al : VCH, 1992
Idel, Anita – Katzek, Jens: „Auswirkung der Freisetzung gentechnisch manipulierter Organismen“ in Umweltbundesamt [Hg]: Gen- und Biotechnologie. Nutzungsmöglichkeiten und Gefahrenpotentiale. Handlungsbedarf für Österreich zum Schutz von Mensch und Umwelt. Wien : Umweltbundesamt, 1991, pp 256-336
Idel, Anita: „Gentechnik und gentechnisch hergestellte Produkte im Bereich der Landwirtschaft“ in Umweltbundesamt [Hg]: Gen- und Biotechnologie. Nutzungsmöglichkeiten und Gefahrenpotentiale. Handlungsbedarf für Österreich zum Schutz von Mensch und Umwelt. Wien : Umweltbundesamt, 1991, pp 191-370
Johnson, Emma: „Oncomouse patent in limbo – but does it matter?“ in Bio/Technolgy Vol. 14 January 1996, pp 20 f
Kamphausen, Rolf: „Patentierung von Tieren“ in Umweltbundesamt [Hg]: Gen- und Biotechnologie. Nutzungsmöglichkeiten und Gefahrenpotentiale. Handlungsbedarf für Österreich zum Schutz von Mensch und Umwelt. Wien : Umweltbundesamt, 1991, pp 239-248
Katscher, Friedrich: „Die Gefahr der Diskriminierung von erbkranken ,Zukunftspatienten’“ in Wiener Zeitung vom 14. 8. 1996, p 40
Katscher, Friedrich: „Eltern, nicht Ärzte entscheiden über eine Abtreibung erbkranker Kinder“ in Wiener Zeitung vom 25. 9. 1996, p 40
Kerschner, Ferdinand – Raschauer, Bernhard: „Konsequenzen“ in Manz [Hg]: Recht der Umwelt. Wien : Manz, 1996, pp 44-45
Knodel, Hans, Bayrhuber, Horst [Hg]: Linder Biologie Teil 3. Wien : Gustav Swoboda, 1989
Koch, Frank A – Ibelgaufts, Horst.: Gentechnikgesetz. Kommentar mit Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien. Weinheim et al : VCH, Lbl 1992
Koenig, Christian – Haratsch, Andreas: Einführung in das Europarecht. Tübingen : Mohr, 1996
Krekeler, Nikola: Die Genehmigung gentechnischer Anlagen und Arbeiten nach dem GenTG unter Berücksichtigung europarechtlicher Vorgaben. Frankfurt am Main et al : Lang, 1994
Krenn, Ferdinand: „Gentechnik-freie Zone Österreich“ in Wiener Zeitung vom 2.7.1996, Beilage Nr 30 Parlament Juli 1996, pp 6 f
Kresbach, Georg: „Gewerblicher Rechtsschutz und Gentechnologie nach österreichischem Recht“ in Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung [Hg]: Gentechnologie im österreichischen Recht. Wien : BMWF, 1991, pp 225-263
Lange, Peter: „EG-Richtlinie ,Freisetzung genetisch veränderter Organismen’“ in Eberbach, Wolfram – Lange, Peter – Ronellenfitsch, Michael [Hg]: Gentechnikrecht (GenTR). Heidelberg : C.F. Müller, Lbl Stand Februar 1996, Teil D II, pp 1-19
Langenohl, Ewald „Gutachten zum Themenschwerpunkt Risikoforschung und Sicherheit“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 50-86
Langguth, Gerd zu Art 3b EGV in Lenz, Carl Otto [Hg]: EG-Vertrag. Kommentar zu dem Vertrag zur Gründung über die Europäischen Gemeinschaften. Köln : Bundesanzeiger, 1994, pp 19-29
Leitner, Ernst in Enquete-Kommission, Band 2 pp 124-127
Lelley, Tamàs: „Für einen verantwortungsvollen Einsatz der Gentechnik im Pflanzenbau“ in Club Niederösterreich [Hg]: Zankapfel Erdapfel – Gentechnik im Pflanzenbau. Wien : Club Niederösterreich, 1996, Heft 5/96, pp 16-21
Lenz, Carl Otto [Hg]: EG-Vertrag. Kommentar zu dem Vertrag zur Gründung über die Europäischen Gemeinschaften. Köln : Bundesanzeiger, 1994
Leskien, Dan in Enquete-Kommission, Band 2 pp 287-289
Leskien, Dan: „Gutachten zum Themenschwerpunkt Gesellschaft, Demokratie und Grundrechte“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 143-168
Lubitz, Werner – Halfmann, Gabriele: „Gutachten zum Themenschwerpunkt Risikoforschung und Sicherheit“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 87-100
Lubitz, Werner: „Gentechnisch veränderte Mikroorganismen“ in Umweltbundesamt [Hg]: Umweltauswirkungen gentechnisch veränderter Organismen. Freisetzungskriterien international und in Österreich. Wien : Umweltbundesamt, 1994, pp 12-15
Luf, Gerhard – Potz, Richard: „Probleme der Verrechtlichung der Gentechnologie“ in Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung [Hg]: Gentechnologie im österreichischen Recht. Wien : BMWF, 1991, pp 363-428
Luf, Gerhard: „Die rechtliche Situation der Gentechnik“ in Club Niederösterreich [Hg]: Zankapfel Erdapfel – Gentechnik im Pflanzenbau. Wien : Club Niederösterreich, 1996, Heft 5/96, pp 36-40
Nentwich, Michael: „Spezifische nationale Spielräume bei der Umsetzung der EG-Richtlinie „über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt“ (RL 90/220/EWG) anläßlich eines EWR- bzw. EG-Beitritts Österreichs.“ in Umweltbundesamt [Hg]: Spezifische nationale Spielräume bei der Umsetzung der EG-Richtlinie „über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt“ (RL 90/220/EWG) anläßlich eines EWR- bzw. EG-Beitritts Österreichs. Wien : Umweltbundesamt, 1993
Nowotny, Ewald in StenProtNR XVIII 168, pp 19692-19693
Nowotny, Ewald – Winckler, Georg [Hg]: Grundzüge der Wirtschaftspolitik Österreichs. Wien : Manz, 1994
Öhlinger, Theo: „Gentechnik im österreichischen Recht. Ergebnisse des Forschungsprojektes und Überlegungen pro futuro“ in Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung [Hg]: Gentechnologie im österreichischen Recht. Wien : BMWF, 1991, pp 429-458
Pernthaler, Peter – Weber, Karl – Wimmer, Norbert: Umweltpolitik durch Recht – Möglichkeiten und Grenzen. Rechtliche Strategien zur Umsetzung des Umweltmanifests. Wien : Manz, 1992
Pernthaler, Peter in Pernthaler, Peter – Weber, Karl – Wimmer, Norbert: Umweltpolitik durch Recht – Möglichkeiten und Grenzen. Rechtliche Strategien zur Umsetzung des Umweltmanifests. Wien : Manz, 1992
Perthold-Stoitzner, Bettina: Die Auskunftspflicht der Verwaltungsorgane. Wien : Manz, 1993
Pumberger in StenProtNR XVIII 168, pp 19673-19678
Rafeiner, Othmar in Enquete-Kommission, Band 2 pp 287-289
Ramsauer, Petra: „Gen-Erdäpfel: Zweiter Versuch“ in Kurier vom 17 7. 1996, p 19
Reiß, Thomas: Perspektiven der Biotechnologie. Wo steht die Bundesrepublik?. Köln : TÜV Rheinland, 1990
Rhomberg, Klaus: „Gutachten zum Themenschwerpunkt Gesundheitswesen“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 185-198
Rosenkranz, Walter: „Gutachten zum Themenschwerpunkt Gesundheitswesen“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 180-184
Rützler, Hanny – Schmatzberger, Alice: Gentechnik in der Produktion von Lebensmitteln. Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich : Wien, 19952
Schellander, Karl: „Transgene Tiere“ in Umweltbundesamt [Hg]: Umweltauswirkungen gentechnisch veränderter Organismen. Freisetzungskriterien international und in Österreich. Wien : Umweltbundesamt, 1994, pp 19-21
Schenek, Matthias: Das Gentechnikrecht der Europäischen Gemeinschaft. Gemeinschaftliche Biotechnologiepolitik und Gentechnikregulierung. Berlin : Duncker & Humblot, 1995
Schmitt von Sydow, Helmut zu Art 155 EGV in Groeben, Hans von der – Thiesing, Jochen – Ehlermann, Claus-Dieter [Hg]: Kommentar zum EWG-Vertrag. Baden-Baden : Nomos, 19914
Schober, Walter – Lopatta, Hans [Hg]: Umweltinformationsgesetz mit Anmerkungen. Wien : Österreichische Staatsdruckerei, 1994
Schwarzer, Stephan: Die Genehmigung von Betriebsanlagen. Wien : Manz, 1992
Schweitzer, Michael zu Art 148 EGV in Grabitz, Eberhard – Hilf, Meinhard [Hg] in: Kommentar zur Europäischen Union. C.H. Beck : München, Stand Oktober 1995
Schwimmer, Walter in StenProtNR XVIII 168, pp 19689-19691
Sorell, Louis S. – Seide Rochelle K.: „Patenting Biotechnology Process Inventions“ in Bio/Technology Vol. 14 February 1996, pp 158 f
Spangenberg, Joachim – Leskien, Dan – et al: „Gesetzliche Regelungen zur Gentechnik in Europa“ in Umweltbundesamt [Hg]: Gen- und Biotechnologie. Nutzungsmöglichkeiten und Gefahrenpotentiale. Handlungsbedarf für Österreich zum Schutz von Mensch und Umwelt. Wien : Umweltbundesamt, 1991, pp 371-489
Stacher, Alois – Karlic, Heidrun: „Gutachten zum Themenschwerpunkt Gesundheitswesen“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 169-179
Stelzer, Manfred: „Die Freisetzung genetisch veränderter Organismen in der österreichischen Rechtsordnung“ in Umweltbundesamt [Hg]: Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen. Wege zur Beurteilung ökologischer Auswirkungen. Wien : Umweltbundesamt , 1992, pp 69-73
Stelzer, Manfred: „Das Gentechnikgesetz zwischen Verfassungsrecht, Europarecht und Sicherheit“ in Rummel, Peter [Hg]: Juristische Blätter. Wien : Springer 1995, pp 756-766
Stelzer, Manfred: „Umfang der Öffentlichkeitsbeteiligung und Parteistellung im gentechnikrechtlichen Genehmigungsverfahren“ in Rill, Heinz Peter [Hg]: Zeitschrift für Verwaltung. Wien : Orac, 1996, pp 17-22
Stenographisches Protokoll der 166. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich. XVIII. Gesetzgebungsperiode. vom 25./26./27. Mai 1994 (StenProtNR XVIII 166)
Stenographisches Protokoll der 168. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich. XVIII. Gesetzgebungsperiode. vom 15./16. Mai 1994 (StenProtNR XVIII 168)
Tappeser, Beatrix: „Gutachten zum Themenschwerpunkt Risikoforschung und Sicherheit“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 101-107
Teschemacher, Rudolf in Enquete-Kommission, Band 2 pp 278-282, 284-287, 289-291
Teschemacher, Rudolf: „Patente im Bereich der Gentechnik. Grundzüge der Praxis des Europäischen Patentamts“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 208-210
Thienel, Rudolf: „Massenverfahren – typische Probleme und mögliche Lösungen“ in Rill, Heinz Peter [Hg]: Zeitschrift für Verwaltung. Wien : Orac, 1996, pp 1-17
Torgersen, Helge: „Erläuterungen zum abgeschlossenen Projekt ,Beurteilungskriterien für Freisetzungen gentechnisch veränderter Organismen’“ in Umweltbundesamt [Hg]: Umweltauswirkungen gentechnisch veränderter Organismen. Frei-setzungskriterien international und in Österreich. Wien : Umweltbundesamt, 1994
Umweltbundesamt [Hg]: Gen- und Biotechnologie. Nutzungsmöglichkeiten und Gefahrenpotentiale. Handlungsbedarf für Österreich zum Schutz von Mensch und Umwelt. Wien : Umweltbundesamt, 1991
Umweltbundesamt [Hg]: Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen. Wege zur Beurteilung ökologischer Auswirkungen. Wien : Umweltbundesamt, 1992
Umweltbundesamt [Hg]: Beurteilungskriterien für Freisetzungen gentechnisch veränderter Organismen. Wien : Umweltbundesamt, 1993
Umweltbundesamt [Hg]: Spezifische nationale Spielräume bei der Umsetzung der EG-Richtlinie „über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt“ (RL 90/220/EWG) anläßlich eines EWR- bzw. EG-Beitritts Österreichs. Wien : Umweltbundesamt, 1993
Umweltbundesamt [Hg]: Umweltauswirkungen gentechnisch veränderter Organismen. Frei-setzungskriterien international und in Österreich. Wien : Umweltbundesamt, 1994
Umweltbundesamt [Hg]: „Gentechnischer Jahresrückblick“ in: UBA-Info Jänner 1996. Wien : Umweltbundesamt, 1996, pp 2-4
Umweltbundesamt [Hg]: „Gentechnischer Überblick“ in: UBA-Info September 1996. Wien : Umweltbundesamt, 1996, pp 14-17
Vallazza, Brigitte: „Die Genies von Österreich“ in Trend 6/96, pp 26-33
Virt, Günter: „Gutachten zum Themenschwerpunkt Ethik/Bioethik“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 199-207
Waginger: Umwelt- und Sozialverträglichkeit Skriptum zum Proseminar. Wien : Institut für Technologie und Warenwirtschaftslehre,1995
Walter, Robert – Mayer, Heinz: Grundriß des österreichischen Bundesverfassungsrechts. Wien : Manz, 19927
Weinhandl, Martina: "Die Mahlzeit aus dem Gen-Labor. Ist Gen-Essen gefährlich?“ in Wirtschaft & Umwelt 2/96, pp 28 f
Weizsäcker, Christine von in Enquete-Kommission, Band 2 pp 25-31, 36-38, 41-43, 46-47, 51
Weizsäcker, Christine von: „Einführungsvortrag am 8. April 1992“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 43-49
Welser, Rudolf: „Gentechnologie und schadenersatzrechtliche Haftung“ in Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung [Hg]: Gentechnologie im österreichischen Recht. Wien : BMWF, 1991
Wimmer, Norbert in Pernthaler, Peter – Weber, Karl – Wimmer, Norbert: Umweltpolitik durch Recht – Möglichkeiten und Grenzen. Rechtliche Strategien zur Umsetzung des Umweltmanifests. Wien : Manz, 1992
Winacker, Ernst-Ludwig: Gene und Klone. Eine Einführung in die Gentechnologie. Weinheim : VCH, 1982
Wohlfahrt, Dagmar: „Der Kampf um die Gen-Bohne“ in Wiener Zeitung, Beilage Nr 32 Parlament November 1996, pp 15-17
Wolf, Karl in Enquete-Kommission, Band 2 p 291
Zacherl, Nikolaus: „Gutachten zum Themenschwerpunkt Forschung – Entwicklung – Industrie“ in Enquete-Kommission, Band 3 pp 108-114
Zacherl, Nikolaus in Enquete-Kommission, Band 2 pp 165-167
[...]
[1] Elkington–Burke p 192
[2] Langenohl in Enquete-Kommission, Band 3 p 51
[3] Biochemie GmbH in Enquete-Kommission, Band 3 p 214
[4] Humaninsulin wurde erstmals 1982 von der Firma Eli Lilly, dem größten Erzeuger von Humaninsulin auf den Markt gebracht. Vgl Stacher–Karlic in Enquete-Kommission, Band 3 p 171 und Vallazza p 29
[5] Vgl dazu Spangenberg–Leskien in UBA 91 pp 476 f
[6] Stacher–Karlic in Enquete-Kommission, Band 3 p 171
[7] Vallazza p 28
[8] Zahlen und Pro-und -Kontra-Diskussion in Spangenberg–Leskien in UBA 91 pp 484 ff
[9] Vgl Idel in UBA 91 pp 207 ff
[10] Weinhandl p 28
[11] Rützler–Schmatzberger pp 46 ff u 40
[12] Gassen et al p 104. Es handelt sich hiebei um rekombinante Bakterien der Gattung Pseudomonas.
[13] Braun–Fuchs in UBA 91 p 43. Auf Grund einer verbesserten Resistenz gegen Arsen-Verbindungen ist eine verbesserte Laugung von Arsenopyriten durch Thiobacillus ferrooxidans möglich.
[14] Rosenkranz in Enquete-Kommission, Band 3 p 184; eher skeptisch: Stacher–Karlic in Enquete-Kommission, Band 3 p 175
[15] Vallazza p 29
[16] Vgl Vallazza p 27 und Salzburger Nachrichten vom 14. 5. 1996, p 1. Ältere, wohl noch optimistischere Schätzungen aus den frühen Achzigern sprechen von 2 Billionen Schilling (vgl Spangenberg–Leskien in UBA 91 p 475).
[17] Brünner in StenProtNR XVIII 168 p 19696 und Vallazza p 27
[18] Vallazza p 27
[19] Vgl zum folgenden Abschnitt vor allem Gassen et al pp 13-32; Knodel–Bayrhuber pp 25 ff
[20] Chimäre ist ein Fabelwesen der griechischen Mythologie, eine Mischung aus Löwe, Ziege und Schlange. Der Begriff wird auch als Synonym für „Ungeheuer“ verwendet. Wie man sieht, ist in manchen Bereichen die Gentechnik nicht nur für die nicht informierte Mehrheit negativ besetzt.
[21] Salzburger Nachrichten vom 14. 5. 1996, p 17
[22] Idel in UBA 91 pp 197 f
[23] Gassen et al p 55
[24] Vgl dazu unten: 3.1.4.3 – Gentransfer
[25] Introns kommen hauptsächlich in Genen von Eukaryonten vor. Es handelt sich dabei um DNA-Abschnitte, die zwar keine genetische Information tragen, aber trotzdem übersetzt werden und dann dem Transcript entfernt werden. Dieser Eliminierungsprozeß heißt Spleißen (splicing). Manche eukaryontischen Gene (zB das menschliche a-Interferon-Gen) enthalten keine solchen Introns und sind daher leichter in Porkaryonten zu exprimieren (Ibelgaufts pp 274 f).
[26] Huber–Stelzer p 9
[27] Lange Teil D II Einleitung Rz 2
[28] Birnstiel in Enquete-Kommission, Band 3 p 32
[29] So beginnen diese (unverbindlichen) Richtlinien mit folgenden – auch für den heutigen Stand teilweise noch – bezeichnenden Sätzen: „Die Sicherheit bei Arbeiten mit rekombinanter DNA hängt von den Personen ab, die sie durchführen. […] Motivation und ein gutes Urteilsvermögen sind die wichtigsten Voraussetzungen für den Schutz der Gesundheit und Umwelt.“ (Vgl Rhomberg in Enquete-Kommission, Band 3 p 187)
[30] Rhomberg in Enquete-Kommission, Band 3 p 187
[31] Bolognese-Leuchtenmüller in Enquete-Kommission, Band 3 p 125
[32] Lange Teil D II Einleitung Rz 6 f
[33] Vgl zB Langenohl in Enquete-Kommission, Band 3 p 64 oder Lubitz–Halfmann in Enquete-Kommission, Band 3 p 100
[34] Rhomberg in Enquete-Kommission, Band 3 p 187
[35] Lange Teil D II Einleitung Rz 8
[36] Vgl unten: 3.1.4.1 – Risikobeurteilung
[37] Lange Teil D II Einleitung Rz 12, vgl auch unten 3.1.4.1 Risikobeurteilung.
[38] So ist nicht die zB in § 39 Abs 4 erwähnte EFTA-Überwachungsbehörde zu informieren, sondern gem Art 9 Abs 1 FS-RL die EU-Kommission. Hier kommt der RL also Direktwirkung zu (zur unmittelbaren Wirkung vgl unten 5.1 – Kritik).
[39] Bereits bevor dieser Abstimmungsfehler gemacht wurde, waren weit über 100 Abänderungsanträge gestellt worden (vgl Haupt in StenProtNR XVIII 166 p 19380)
[40] Vgl Huber–Stelzer p 40
[41] Vgl Pernthaler p 29
[42] Erl p 46
[43] Stelzer in UBA 92 p 72. Vgl zu weiteren eklatanten kompetenzrechtlichen Problemen Stelzer in JBl 1995 pp 757 ff.
[44] Stelzer in UBA 92 p 73
[45] Öhlinger p 440
[46] Vgl Pernthaler p 31
[47] Vgl Pernthaler p 32
[48] Erl RV p 46
[49] So steht in der Stellungnahme des BMUJF (Zl. 14 3641/33-II/5/92) auf Seite 3: „Die einzige österreichische Behörde, die bereits jetzt über Fachkräfte verfügt, die die ökologischen Auswirkungen von […] Freisetzungen von GVO beurteilen können, ist der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie mit dem Umweltbundesamt (UBA).“ Und weiters, nachdem konstatiert wird, daß das UBA als Sachverständiger fungieren soll: „Das UBA zwar für Arbeiten heranzuziehen, dem BMUJF jedoch keinerlei Kompetenzen einzuräumen, ist jedenfalls kein gangbarer Weg!“
[50] Vgl Walter–Mayer Rz 598, zitiert aus Erkenntnis- und Beschlußsammlung des Verfassungsgerichtshofes Nr 4375. Vgl auch Art 18 Abs 2 B-VG und Adamovich–Funk p 115.
[51] Als Folge der doppelten, sowohl negativen als auch positiven Abgrenzung, kommt die Gemeinschaft nicht schon dann zum Zug, wenn die Gemeinschaftsebene zur Realisierung der Ziele besser geeignet ist, sondern erst dann, wenn diese Ziele zugleich auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können (vgl Langguth Art 3b EGV Rz 12 ff).
[52] ZB Langguth Art 3b EGV Rz 18
[53] Zu diesen und weiteren Argumenten vgl Schenek pp 110 ff.
[54] Vgl Luf–Potz p 414, Gehrlich in Enquete-Kommission, Band 3 p 141, Reiß p 190
[55] Vgl dazu unten: 2.2.3.6 – Stand der Technik
[56] Zacherl in Enquete-Kommission, Band 3 p 113
[57] Vgl zB Nowotny in StenProtNR XVIII 168 p19692; Vallazza p 33
[58] Weizsäcker in Enquete-Kommission, Band 2 pp 41 f
[59] Zacherl in Enquete-Kommission, Band 3 p 113
[60] Vgl die Stellungnahme der Firma Biochemie Gmbh in Enquete-Kommission, Band 3 p 216: „Bei einer rigorosen Handhabung der Gentechnik in Österreich wird die entsprechende Forschungsaktivität – aus Wettbewerbsgründen – im Ausland stattfinden. Das gleiche gilt mit geringer zeitlicher Verzögerung auch für die Produktion“. Allerdings sind solche Aussagen nicht immer als leere Drohungen zu verstehen. Die Firma Waldheim Pharmazeutika führt als Grund für ihren Rückzug aus der Gentechnik-Forschung, die schon in ziemlich erfolgreichen Produkten resultierte, unter anderem das „strenge heimische Gentechnikgesetz“ an (Hermann Mucke von Waldheim Pharmazeutika zitiert in Vallazza p 33). Auch die Firma Immuno stellt in Aussicht, zumindest die klinische Prüfung ihres neu entwickelten Impfstoffes nicht in Österreich, sondern in einem anderen Mitgliedstaat der EU durchführen zu lassen (Hans Eibl zitiert in Vallazza p 33)
[61] Reiß p 188
[62] Reiß p 187
[63] Reiß p 187
[64] Reiß p 187
[65] Leskien in Enquete-Kommission, Band 3 p 162
[66] Leskien in Enquete-Kommission, Band 3 p 165
[67] Die Eigenschaften der in Verkehr gebrachten Erzeugnisse sind wesentlich detaillierter geregelt. Darauf wird ausführlich unter 3.2.1.2 – Verpackung und Kennzeichnung eingegangen.
[68] Vgl dazu unten: 2.2.5.4 – Gentechnische Anlagen.
[69] Zur Geltung der FS-RL im rechtsfreien Raum vgl Schenek p 219
[70] Ebenso: Schenek p 153, vgl auch UBA 93 p 8, Lange D II Rz 50 ff
[71] Ein unabsichtliches Ausbringen wäre demnach ein „Unfall bei Arbeiten mit GVO“ gem § 4 Z 12.
[72] Auch hier wird – wie schon beim Arbeiten mit GVO (in geschlossenen Systemen) – die Definition davon abhängig gemacht, daß noch keine Genehmigung für die nächste Stufe vorliegt. Dadurch soll wohl ein zB im geschlossenen System ausreichend getesteter und zur Freisetzung freigegebener GVO unter das für die Freisetzung geltende Regime fallen. Jedoch geht dies aus dem Gesetz nicht eindeutig hervor. Demnach ist nach dem Wortlaut des Gesetzes die Handhabung dieses GVO weder gemäß den Regeln der Arbeiten mit GVO in geschlossenen Systemen noch denen der Freisetzung zu unterwerfen, was eine sehr unglückliche Lösung darstellt, da sich dieser GVO dann im (gentechnik)rechtsfreien Raum „bewegt“.
[73] Ein Abänderungsantrag sah hier nicht nur den Schutz der Gesundheit des Menschen und seiner Nachkommenschaft vor, sondern auch von Tieren und Pflanzen und deren Nachkommenschaft.
[74] Mit „Nachkommenschaft“ ist nicht bloß die Leibesfrucht gemeint, sondern durchaus auch die „kommenden Generationen“ (Erl RV zu § 1).
[75] Vallazza p 27
[76] Dies obwohl in einem (abgelehnten) Abänderungsantrag auch „sonstige von diesem Bundesgesetz erfaßte Tätigkeiten“ dem Vorsorgeprinzip unterworfen waren (Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr Madeleine Petrovic et al zum Ausschußbericht 1730 BlgNR).
[77] Zum Vorsorgeprinzip im Rahmen der S-RL und der FS-RL vgl Schenek pp 199 ff
[78] Erl RV, p 41
[79] Vgl dazu unten: 2.2.7 – Exkurs: Forschungsfreiheit und Grundrechte
[80] Die FS-RL verwendet im englischen Text den Begriff „containment“. In der Literatur ist auch der Begriff „confinement“ üblich.
[81] Die Enquete-Kommission hat in ihrem Bericht (Enquete-Kommission, Band 1 p 15) zum Stichwort Öffentlichkeitsbeteiligung festgestellt, daß „die Beteiligung der Öffentlichkeit als Parteien im Verfahren gewährleistet sein“ muß. – Dies allerdings nur in jenen Bereichen, din denen mittlerweile durch das GTG eine Anhörung vorgeschrieben ist, also nicht für alle gentechnischen Arbeiten und auch nicht für das Inverkehrbringen. Vgl weiters: unten: 3.1.3.2 – Exkurs: Anhörung
[82] Mit „Mitgliedstaaten“ und „Mitgliedern“ sind iSd S-RL und der FS-RL die Mitglieder des EWR gemeint. Es handelt sich dabei momentan um die 15 Mitgliedstaaten der EU auf der einen Seite (Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Irland, Dänemark, Griechenland, Spanien, Portugal, Finnland, Schweden und Österreich) und um 3 Mitglieder der Europäischen Freihandelszone (EFTA; Island, Norwegen, Liechtenstein) auf der anderen Seite (vgl Borchardt pp 15 ff und Erl RV zu § 55 und § 54 Abs 4). S-RL und FS-RL sind zwar EG-Recht, gelten aber durch die Aufnahme in den acquis communautaire des EWR zwischen allen Unterzeichnerstaaten des EWR-Abkommens.
[83] Die EU-Richtlinien sprechen beide, sowohl in den Erwägungsgründen als auch im Text selbst, immer bloß von „anzuhören“ resp „Anhörung“. Vgl S-RL Erwägungsgrund 13 u Art 13, FS-RL Erwägungsgrund 18 u Art 7.
[84] Dieses Fälle sind fast auschließlich Arbeiten im großen Maßstab und höheren Sicherheitsstufen (Zu den Einteilungen vgl weiter unten).
[85] Es sei an dieser Stelle klargestellt, daß im Rahmen dieser Arbeit anstelle der Begriffe EG-Recht, EG-RL etc meistens die Begriffe EU-Recht, EU-RL etc verwendet werden. Es sei aber festgehalten, daß die EU – egal ob sie als solche ein Völkerrechtssubjekt ist oder nicht (dafür: zB Borchardt pp 49 f; dagegen: zB Hakenberg p 11) – die in dieser Arbeit erwähnten Rechtsakte nicht erlassen hat und nach dem derzeitigen Stand des Primärrechts auch nicht erlassen könnte.
[86] Für das Inverkehrbringen ist also ausnahmslos der BMGK zuständig.
[87] § 100 Z 1 spricht ausnahmsweise von der Arbeit mit GVO im GS und von der Freisetzung von GVO – also im Singular anstatt wie üblich im Plural –, um dann mit dem Prädikat „erfolgen“ im Plural klarzustellen, daß der BMWVK nicht nur in bezug auf die Freisetzung keine allumfassende Kompetenz hat, sondern auch in bezug auf gentechnische Arbeiten im GS nur dann Behörde iSd GTG ist, wenn diese von oder in wissenschaftlichen Einrichtungen des Bundes betrieben werden.
[88] Wenn die Behörde nicht zur bescheidmäßigen Erledigung des Antrags verpflichtet ist, der Antragsteller somit kein Recht auf einen Bescheid hat, kann die Behörde nicht säumig werden und der Antragsteller keine Säumnisbeschwerde einbringen (Adamovich–Funk p 455).
[89] Walter–Mayer Rz 1031
[90] Im Falle der Freisetzung dürfen gem § 51 im Rahmen der Überprüfung Proben nicht nur direkt am Ort der (vermuteten) Freisetzung vorgenommen werden, sondern auch in der Umgebung und auch nach der Freisetzung.
[91] Die Festlegung von Standards in Form von Verordnungen kann allerdings auch ohne ausdrückliche Verordnungsermächtigung vorgenommen werden, da Art 18 Abs 2 B-VG die generell generell zu Durchführungsverordnungen im Rahmen ihres Wirkungskreises ermächtigt (vgl Walter–Mayer Rz 598, Adamovich–Funk p 115, Schwarzer p 318)
[92] Wimmer p 95
[93] Schwarzer p 283
[94] Schwarzer p 289
[95] Dies sind die Sachverständigen und fachlich qualifizierten Vertreter. Es soll damit „eine ausreichende fachliche Expertise gesichert“ werden (vgl Erl RV zu § 83).
[96] Als man es nur mit Arbeiten in GS und noch nicht mit Freisetzungen zu tun hatte, waren die Schranken darauf ausgerichtet, daß die Organismen außerhalb des GS nicht überleben konnten. Die Aminosäureauxotrophien genügten diesem Anspruch. Der Organismus ist unfähig, eine bestimmte, lebenswichtige Aminosäure zu generieren, und bedarf daher bei sonstigem Absterben der kontinuierlichen Versorgung mit dieser Aminosäure im Nährmedium. Heute, wo biologische Schranken auch bei Freisetzungen verwendet werden, bestehen viel differenziertere Ansprüche. Es geht nicht mehr unbedingt um das Halten im GS, sondern auch um die Verringerung resp Verhinderung der Ausbreitung des Organismus und seines genetischen Materials über die Zielökosysteme hinaus (Braun–Fuchs in UBA 91 pp 61 f).
[97] Selbstmordgene heißen so, weil sie den Organismus (vorzugsweise Bakterien) veranlassen, sich selbst zu töten. Durch bestimmte Umwelteinflüsse, wie zB Temperaturschwankungen, wird das eigens zu diesem Zweck eingebaute Gen aktiviert. Die Genexpression bringt ein für das Bakterium tödliches Protein hervor und das Bakterium wird abgetötet. Diese Methode ist auch für Anwendungen außerhalb von GS sehr sinnvoll, zB bei der Schadstoffbeseitigung außerhalb von GS. Finden die Bakterien keinen zu vernichtenden Schadstoff mehr, sterben sie ab. (vgl Backhaus in UBA 94 p 30 und Braun–Fuchs in UBA 91 pp 62 f)
[98] So ist die in der vorangehenden Fußnote erwähnte Empfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen als biologsiche Schranke durch die tropische Algenart „ Caulerpa taxifolia “ in Frage gestellt worden. Die kälteempfindliche Alge konnte sich – entgegen allen Vorhersagen – im Mittelmeer behaupten. Scheinbar wurde die Temperaturschranke versetzt (vgl Weizsäcker in Enquete-Kommission, Band 2 p 29).
[99] Vgl dazu UBA 93 p 86
[100] Die Anhänge II bis V werden dem Stand der Technik angepaßt. Das Verfahren dazu ist in Art 21 S-RL normiert (vgl unten, 3.2.1.1 – Genehmigungsverfahren). Der Unterschied zum Art 21-Verfahren der FS-RL besteht lediglich darin, daß das Verfahren der S-RL ein Regelungsausschußverfahren der Variante b ist, dh Vorschläge der EU-Kommission vom Rat nicht nur einstimmig, sondern mit einfacher Mehrheit wirksam abgelehnt werden können.
[101] Die Formulierung des § 14 Abs 3 ist etwas unglücklich geraten. Ist mit „jeweils“ ein Beauftragter oder Stellvertreter je Arbeit, je Sicherheitsstufe oder einer für Arbeiten im großen und einer für Arbeiten im kleinen Maßstab gemeint? Möglicherweise muß je Arbeit ein Beauftragter oder Stellvertreter anwesend oder kurzfristig erreichbar sein. Ab einer Zahl von drei gleichzeitigen Arbeiten reicht die Minimallösung mit einem Stellvertreter nicht mehr aus. In diesen Fällen wird dann auch klar, warum der Betreiber nicht bloß einen, sondern „mindestens einen Stellvertreter“ (§ 14 Abs 1) bestellen soll.
Mit dieser Auffassung stellt sich jedoch ein Problem: Die Abgrenzung des Beauftragten vom Projektleiter ist kaum mehr möglich, denn es ist Aufgabe des Projektleiters, eine bestimmte Arbeit zu beaufsichtigen. Es ist wohl kaum anzunehmen, daß der Beauftragte, der ja einen umfassenderen Aufgabenbereich hat, die Arbeit des eigens dafür bestellten Projektleiters noch einmal ausführen soll. Daher ist es wahrscheinlicher, daß (zumindest?) ein Beauftragter und zumindest ein Stellvertreter anwesend oder kurzfristig erreichbar sein müssen. Jedoch ist auch diese Lösung nicht befriedigend, weil erstens die Formulierung (zumindest ein Beauftragter bei bloß einem zu bestellenden Beauftragten) fraglich ist, und sich zweitens die Frage stellt, wieso zumindest der Beauftragte und ein Stellvertreter anweisend sein sollen. Bei nahezu identischem Aufgabenbereich könnte man ja beide mit „Beauftragter für die biologische Sicherheit“ titulieren.
Am sinnvollsten, aber wohl auch nicht korrekt, wird es sein, das Wort „jeweils“ einfach zu ignorieren, woraus folgen würde, daß der Beauftragte oder einer der Stellvertreter anwesend sein soll, es aber durchaus wünschenswert wäre, wenn mehrere dieser Personen anwesend wären.
[102] Zu den Begriffen „großer Maßstab“ und „kleiner Maßstab“ vgl unten: 2.2.5.2 – Klassifizierungen im GTG.
[103] Interessant ist, daß das Kriterium der kurzfristigen Erreichbarkeit nach dem Wortlaut des Gesetzes die persönliche Anwesenheit vollständig ersetzen kann. Als kurzfristig erreichbar kann auch der auf einem Kongreß in den USA befindliche Beauftrage gelten, wenn er telephonisch erreichbar ist. Die – allerdings nicht verbindlichen – Erl zu § 14 stellen klar, daß mit der kurzfristigen Erreichbarkeit nicht nur diese selbst, sondern auch die Möglichkeit des Eintreffens in der gentechnischen Anlage „in einer angemessen kurzen Zeit“ nach der Benachrichtigung gemeint ist. So etwa, wenn der Beauftragte sich momentan an einem anderen Universitätsinstitut in derselben Stadt befindet.
[104] Dennoch wird in Anlage I sowohl für erstmalige (1.2.1.) als auch für weitere Arbeiten (2.2.1.) mit GVM der Sicherheitsstufe 1 im großen Maßstab unverständlicherweise die Angabe des Namens des Projektleiters verlangt.
[105] Dies jedoch nur im Falle des Wechsels der Person. Wird aber eine gentechnische Anlage neu eröffnet, so bedarf es lt Anlage I (A 1.1.2.2., 1.1.3.2., (1.2.1.2.,) 1.2.2.2. und1.2.3.2.; B 1.1.2.) nur der Angabe des Namens des Projektleiters, nicht aber seiner Qualifikationen. Für die Einreichung weiterer Arbeiten ist die Angabe der Qualifikationen ohnehin nicht erforderlich, weil ja derselbe Projektleiter zuständig ist. Sollte er ausgetauscht werden, so müssen ohnehin gem § 15 Abs 4 iVm Abs 1) Angaben über die Qualifikationen gemacht werden.
[106] Man beachte das Qualifikationsgefälle vom Beauftragten für die biologische Sicherheit bis zum Komitee. Während ersterer noch über „mindestens zweijährige praktische Erfahrung“ (§ 14 Abs 2) mit Arbeiten mit GVO verfügen muß, muß der Projektleiter „ausreichend praktische Erfahrung“ (§ 15 Abs 1) und ein Komiteemitglied nur noch „Kenntnisse“ (§ 16 Abs 3) auf dem Gebiet vorweisen.
[107] Die Bewilligung ist am einfachsten doppelt negativ zu erklären. Eine beantragte Arbeit resp eine angemeldete Arbeit wird nicht untersagt; dh es wird kein negativer Bescheid erlassen. Positiv formuliert bedeutet die Bewilligung von Arbeiten, für die ein Genehmigungsantrag gem § 20 der Behörde vorgelegt wurde, einen positiven (Genehmigungs-)Bescheid, von Arbeiten, die bloß anzumelden waren, keine (negative) Reaktion der Behörde oder eine Zustimmung zum Beginn der Arbeiten bereits vor der Stillhaltefrist.
[108] Was passiert, wenn das Komitee nicht einverstanden ist, wird nicht explizit geregelt. Aus den in § 24 Abs 4-7 erwähnten Rechtsfolgen der internen Freigabe folgt aber, daß der Betreiber den Vorschlag zur Sicherheitseinstufung in der Anmeldung resp im Antrag auf Genehmigung der Arbeiten auch ohne die interne Freigabe machen kann. Da das Beifügen der internen Freigabe zu den Anmeldungs- resp Anmeldungsunterlagen Vorteile verspricht (vgl unten), scheint es erstrebenswert, eine interne Freigabe zu erlangen. Wird dies vorerst nicht erreicht, kann es für den Betreiber durchaus angebracht sein, eine den Forderungen des Komitees entsprechende Einstufung dem Komitee erneut zur Überprüfung vorzulegen. Ob er dabei wieder den Umweg über den Projektleiter nehmen muß, ist nicht geklärt.
Auch im Falle jener Arbeiten, die weder einer Anmeldung bei der noch einer Genehmigung durch die Behörde bedürfen, ist keine interne Freigabe erforderlich. Es handelt sich dabei allerdings ausschließlich um bestimmte weitere Arbeiten, für die ja die Sicherheitseinstufung wohl weniger relevant ist als für erstmalige Arbeiten.
[109] Vgl unten, Abb 7
[110] Anzunehmen ist, daß es parallel zu den vier Sicherheitsstufen auch vier Risikogruppen gibt (kein/geringes/mäßiges/hohes Risiko gem § 5), denn gem § 6 Abs 6 „richtet sich die Sicherheitseinstufung dieser Arbeiten nach der Risikogruppe der verwendeten GVO“.
[111] Merke: Nicht bloß Humanpathogenität, sondern Pathogenität „für Menschen, Tiere und Pflanzen“ dürfen die GVM nicht erwarten lassen. Hier wird der Schutz von Tieren und Pflanzen wieder explizit angesprochen (§ 6 Abs 3 Z 1).
[112] Dieser wird wohl bloß eine Herabstufung beantragen. Dies wird der Fall sein, wenn sich im Laufe der Arbeiten die Sicherheitsumstände verändern, oder wenn die von ihm vorläufig festgesetzte Einstufung im Laufe des behördlichen Verfahrens abgeändert wird.
[113] Diese Litergrenzen könnten unter Umständen relativ zu niedrig sein. So braucht etwa die Firma Immuno mindestens 1.200 Liter Kulturvolumen für Arbeiten in der Sicherheitsstufe 1, um wirtschaftlich arbeiten zu können (vgl Pumberger in StenProtNR XVIII 168 p 19677).
[114] Daß die Legaldefinition des großen Maßstabs nicht auf die des kleinen Maßstabs folgt, ist auf den Einschub der Z 10 (s unten) zurückzuführen, der in der Regierungsvorlage noch nicht vorgesehen war, dann aber just zwischen den beiden Definitionen eingefügt wurde.
[115] Die Formulierung der Z 11 ist etwas verwirrend, bei genauerer Betrachtung aber dennoch klar. Man könnte nämlich, wenn man § 4 Z 11 isoliert betrachtet, meinen, daß alle anderen als die unter Z 9 angeführten Arbeiten mit GVM Arbeiten im großen Maßstab seien. Dann wären davon auch Arbeiten mit transgenen Pflanzen und Tieren betroffen, was aber nicht sein kann, da diese definitiv dem kleinen Maßstab zuzuordnen sind. Es bleibt nur diese Interpretation möglich, die folgendermaßen besser formuliert wäre: „alle anderen Arbeiten mit GVM als die unter Z 9 angeführten“.
[116] Enquete-Kommission, Band 1 p 9; vgl auch p 16
[117] Erstmalige Arbeiten sind gentechnische Arbeiten in Anlagen, welche zum ersten Mal für solche Arbeiten benützt werden. Dh das Attribut „erstmalig“ bezieht sich eigentlich auf die Anlage in ihrer Verwendung als gentechnische Anlage und nicht auf die Arbeiten. Die Unterscheidung in erstmalige und weitere Arbeiten hat daher den Sinn, daß bei erstmaligen Arbeiten insbesondere auch die gentechnische Anlage und ihre Sicherheitseinrichtungen einer Prüfung zu unterziehen sind. Aus diesem Grund sind die Fristen, des den erstmaligen Arbeiten vorangehenden behördlichen Verfahrens regelmäßig länger als die von Verfahren vor weiteren Arbeiten (vgl die Fristen gem S-RL in Abb 6).
[118] Handelt es sich bei den transgenen Tieren um Wirbeltiere, so sind die Arbeiten meldepflichtig. Weitere Arbeiten mit transgenen Wirbeltieren sollen auch in der Sicherheitsstufe 1 der Behörde bekannt sein.
[119] In Österreich besteht für alle gentechnischen Arbeiten Aufzeichnungspflicht gem § 34. Da sie in der S-RL – bis auf die Aufzeichnungspflicht bei weiteren Arbeiten des Typs A in der Gruppe I – nicht geregelt ist, stellt § 34 eine EG-rechtskonforme Regelung über den Bereich der S-RL hinaus dar.
[120] In Anlehnung an Leskien in Enquete-Kommission, Band 3 p 157
[121] Auf eine detaillierte Darstellung der Warte- und Genehmigungsfristen des GTG wurde auf Grund der komplizierten Ausnahmeregelungen verzichtet. Näheres dazu s unten.
[122] So sind zB Arbeiten des Typs A in der Sicherheitsstufe 4 in Österreich erst 90 Tage nach ihrer Anmeldung zu beginnen (§ 24 Abs 1) statt nach 60 Tagen (Art 11 Abs 5 lit a). Der einen Erschwernis stehen aber im GTG zahlreiche Erleichterungen gegenüber. Zwar sind gem § 24 Abs 5 alle Arbeiten erst nach der behördlichen Genehmigung zu beginnen und dauert das Verfahren höchstens 90 Tage, wie das auch in der S-RL (Art 11 Abs 4 2. SpStr u Abs 5 lit b) vorgesehen ist, durch die Vorlage der internen Freigabe, wird die Entscheidungsfrist der Behörde jedoch auf 60 Tage verkürzt. Die zahlreichen Ausnahmen in § 24 Abs 4 Sätze 2-4 u Abs 6 f) sind nicht mit der S-RL vereinbar. Die 30-Tage-Frist gem § 24 Abs 2 ist keine Abweichung von der S-RL, weil sie transgene Pflanzen und Tiere betrifft, die ja nicht in den Regelungsbereich der S-RL fallen.
[123] Arbeiten im großen Maßstab sind per definitionem Arbeiten des Typs B, weil Arbeiten im großen Maßstab gem § 4 Z 11 Arbeiten mit GVM sind und Arbeiten mit GVM, die nicht im kleinen Maßstab stattfinden, gem § 4 Z 10 Arbeiten des Typs B sind. Arbeiten im kleinen Maßstab können hingegen Arbeiten mit GVM sein (Literbeschränkung), aber auch Arbeiten mit transgenen Pflanzen oder Tieren (vgl § 4 Z 9). Daher ist diesen kein Typ zuzuordnen, weil sie entweder Typ A oder Typ B oder überhaupt Arbeiten mit anderen GVO sind.
[124] Im Gesetz heißen sie Wartefristen (§ 24) oder Untersagungsfristen (§ 33).
[125] Vgl oben: 2.2.5.1 – Pflichten des Betreibers einer gentechnischen Anlage
[126] Davon gibt es allerdings wieder eine Ausnahme, nämlich erstmalige Arbeiten des Typs A in der Sicherheitsstufe 2. Für diese besteht aber gem § 24 Abs 6 die Möglichkeit, ebenfalls unter Vorlage der internen Freigabe, bloß eine Anmeldung mit einer Stillhaltefrist von ebenfalls 60 Tagen vorzunehmen.
[127] Dies gilt fast ausschließlich für genehmigungspflichtige Arbeiten. Nur bei der Anmeldung von erstmaligen Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 im großen Maßstab und weiteren Arbeiten der Sicherheitsstufen 3 und 4 im kleinen Maßstab wird ein Gutachten des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses erstellt.
[128] Diese Regelung weicht von der S-RL ab: Art 11 Abs 6 FS-RL bestimmt, daß unter anderem die Zeitspanne der Anhörung nicht berücksichtigt wird. Gem § 25 ist der Fortlauf der Frist in diesem Fall aber für die Zeitspanne zwischen Mitteilung des Ergebnisses der Anhörung und darauf bezogener Stellungnahme des Antragstellers gehemmt. Es liegt hier eine mangelhafte Umsetzung vor.
[129] Eine Verlängerung um ein weiteres Jahr ist aus wichtigem Grund und bei Vorliegen von dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen möglich (§ 104 Abs 2).
[130] Genaugenommen: Bei bereits begonnenen Arbeiten und bei noch nicht begonnenen Arbeiten vor Ablauf dieser 3-Jahres-Frist.
[131] Der Unterschied erklärt sich daraus, daß im Falle des § 104 wohl weniger investiert wurde als im Falle des § 33. Es soll dort, wo bereits erhebliche Investitionen getätigt wurden, die Kontinuität gewahrt werden.
[132] In der Regierungsvorlage zum UVP-Gesetz war die Behandlung von gentechnischen Anlagen ursprünglich vorgesehen. Man einigte sich jedoch auf die Regelung der Anlagen im später zu erlassenden GTG. Lt Verfechtern dieser Vorgangsweise ist im GTG nun stattdessen eine „dynamische“ Anlagenprüfung verankert (Schwimmer in StenProtNR XVIII 168 p 19691).
[133] Vgl Schenek pp 155, Krekeler p 40
[134] In der Folge ist, wenn von somatische Gentherapie oder von Genanalyse die Rede ist, immer die somatische Gentherapie am Menschen resp die Genanalyse am Menschen gemeint.
[135] Zur Erklärung der Retroviren vgl Gassen et al p 42.
[136] Stacher–Karlic in Enquete-Kommission, Band 3 p 176
[137] Vererbbare Krankheiten sind nicht deshalb für die somatische Gentherapie prädestiniert, weil sie vererbbar sind und man damit auch die folgenden Generationen sozusagen gleich mitbehandeln könnte (der Eingriff in Keimzellen ist ja verboten; vgl unten), sondern weil man bei Erbkrankheiten oft genau weiß, wo der Gendefekt liegt.
[138] Eigentlich ist nur die Herstellung von Embryonen außerhalb des Körpers einer Frau verboten. Eine medizinsich assistierte in-vivo -Befruchtung (Herstellung innerhalb des Körpers einer Frau) mittels dieser Keimzellen wäre demnach erlaubt.
[139] Vgl Leskien in Enquete-Kommission, Band 3 p 161
[140] Vgl Nature Biotechnology, Volume 14 June 1996, p 686
[141] Rosenkranz in Enquete-Kommission, Band 3 p 181
[142] Die Einteilung in zwei Gruppen erfolgt aus dem Grund, daß bei Analysen der ersten Gruppe zusätzliche Anforderungen, zB in der Beratung der zu Untersuchenden, zu erfüllen sind. Es soll damit dem Umstand Rechnung getragen werden, daß es sich bei dieser Gruppe vorwiegend um Untersuchungen bezüglich Erbkrankheiten handelt.
[143] …oder deren gesetzlichen Stellvertreters (§ 65 Abs 4). Bei pränatalen Untersuchungen im Sinne der 1. Gruppe von Genanalysen ist Einwilligung und Bestätigung von der Schwangeren zu geben (§ 65 Abs 3).
[144] Als anonymisiert gelten auch Proben, die nur mit einem Code versehen sind, der ausschließlich in der jeweiligen Einrichtung, in der die Analysen durchgeführt werden, mit dem Spender in Verbindung gebracht werden kann. Liegt eine ausdrückliche, schriftliche (vgl oben) Zustimmung vor, bedarf es auch bei der Veröffentlichung nicht der Anonymität.
[145] Auch hier sind wieder besondere Anforderung im Zusammenhang mit der ersten Gruppe mit dem Ziel der Adäquaten Betreuung zu bemerken.
[146] Über Analysen zu anderen Zwecken als jenen der Gruppe 1 ist nicht Bericht zu erstatten. Auch sind Zulassungen für Einrichtungen zu Genanalysen zu anderen als zu medizinischen Zwecken nicht gem GTG zu beantragen.
[147] Da nur Genanalysen zu wissenschaftlichen und zu medizinischen Zwecken im GTG geregelt sind, und hier eindeutig andere Zwecke verfolgt werden, als medizinische, gilt bei der Genanalyse nicht die Beschränkung auf ausschließliche Veranlassung durch einen Arzt.
[148] Ein weiterer Grund ist auch die Aufrechterhaltung der Versicherungsmärkte, die insb durch die sog „adverse Selektion“ zusammenbrechen könnten. Andererseits entsteht durch die durch diese Regelung erreichte asymmetrische Information das Problem des „moralischen Risikos“ (vgl Nowotny–Winckler pp 205 f; vgl auch Katscher in Wiener Zeitung vom 14. 8. 1996, p 40).
[149] Davon sind auf jeden Fall Arbeitgeber und Versicherer gem § 67 ausgeschlossen. Sie dürfen auch auf diese Weise nicht Einsicht in die Analysedaten erhalten.
[150] Vgl auch „Eugenik von unten“, die keine von politisch-volkswirtschaftlichen Überlegungen getragene ist, sondern mehr eine „Mitleidseugenik“ ist (Bolognese-Leuchtenmüller in Enquete-Kommission, Band 3 p 130). Es sei damit nochmals darauf hingewiesen, daß die Entscheidung über Leben oder Tod eines Fötus nicht bei den Ärzten liegt, sondern bei den Eltern (vgl auch Katscher in Wiener Zeitung vom 25. 9. 1996 p 40).
[151] Die Quelle spricht hier von einer „autosomal rezessiv vererbten Erkrankung mit einer Häufigkeit von 1:10.000“. Dies entspricht lt Knodel–Bayrhuber (p 56) genau der Phenylketonurie (1:10.000) und in etwa dem etwas bekannteren Albinismus (1: 15.000).
[152] Rosenkranz in Enquete-Kommission, Band 3 p 181.
[153] Vgl Enquete-Kommission, Band 1 p 12 („Der Schutz der Persönlichkeit […] und der Schutz von Leben und Gesundheit gehen im Konfliktfall der Freiheit der Wissenschaft und Forschung vor.“), vgl außerdem Enquete-Kommission, Band 1 p 8 und UBA 91 p ii.
[154] Leskien in Enquete-Kommission, Band 3 p 149. Hier werden Quellen angeführt, die von der „Flucht in die Menschenwürde“ und der „inflationäre[n] Verwendung des Menschenwürdearguments“ sprechen. Die Berufung auf die Menschenwürde wäre nur dann zulässig, wenn es dazu einen „verfassungsrechtlichen Fundamental konsens“ gäbe, was allerdings nicht anzunehmen ist.
[155] VfSlg 3068/1956 u 3191/1957. Vgl auch Huber–Stelzer p 26.
[156] Walter-Mayer Rz 1448
[157] Huber–Stelzer p 26
[158] VfSlg 1777/1949. Vgl auch Huber–Stelzer p 27
[159] VfSlg 8136/1977. Vgl auch Huber–Stelzer p 27
[160] Huber–Stelzer p 28
[161] Huber–Stelzer p 27
[162] VfSlg 10401/1985 u B 1218/86. Vgl auch Huber–Stelzer p 28.
[163] Huber–Stelzer p 28
[164] Huber–Stelzer p 30
[165] Dies wird zB von Rhomberg in Enquete-Kommission, Band 3 p 187 kritisiert. Ebenso Bolognese-Leuchtenmüller in Enquete-Kommission, Band 3 p 125: „Die ökonomische Dimension [„ökonomische Dimension“ im Original hervorgehoben] der Gentechnologieentwicklung ist durchaus imstande, das Kräfteverhältnis zwischen der Bereitschaft zur Selbstkontrolle und dem Gebot wissenschaftlicher Konkurrenzfähigkeit nachhaltig zu beeinflussen“.
[166] Teschemacher in Enquete-Kommission, Band 2 p 296: So haben die National Institutes of Health DNA-Sequenzen zur Patentierung eingereicht, um – wie der beantragende Mitarbeiter versichert – eine Grundsatzdiskussion auszulösen (vgl Teschemacher in Enquete-Kommission, Band 2 p 282).
[167] Drittwirkung und Ansätze von Gewährleistung (vgl Adamovich–Funk p 153) von Grundrechten gibt es allerdings in der österreichischen Rechtsordnung auch (vgl unten).
[168] Vgl im folgenden vor allem Walter–Mayer Rz 1328 ff.
[169] Walter–Mayer Rz 1329
[170] Vgl dazu Huber–Stelzer pp 36 ff
[171] VfGH 11. 3. 1987, G 169/86, V 70/86
[172] VfGH 1. 10. 1988, B 954, 1339/88-9
[173] VfGH 9. 3. 1989, G 220/88u.a.
[174] Huber–Stelzer p 37
[175] Man bedenke, daß im allgemeinen Sprachgebrauch (und auch in der FS-RL) die Freisetzung der Überbegriff für das Inverkehrbringen ist. Sie umfaßt „jede Art von absichtlichem Ausbringen“ (Art 2 Z 3 FS-RL). Im GTG ist die Freisetzung definiert als „das absichtliche Ausbringen von […] GVO […], sofern noch keine Genehmigung für deren Inverkehrbringen erteilt wurde“ (§ 4 Z 20; der letzte Teilsatz bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf alle drei litterae, es dürfte sich um einen Satzfehler handeln). Aus diesem Grund ist in diesem 3. Kapitel die Freisetzung nicht als Überbegriff von Inverkehrbringen zu verstehen. Wird an anderer Stelle von Freisetzungsproblematik etc gesprochen, so sind damit meistens auch Aspekte des Inverkehrbringens gemeint.
[176] Gaugitsch in UBA 94, p 5
[177] Wiener Zeitung vom 20. 2. 1996, p 7
[178] Idel in UBA 91 p 209
[179] Krenn p 7, UBA -Info September 1996, p 16
[180] Global 2000, Broschüre vom 20. Juni 1996, p 2
[181] Krenn p 7
[182] Krenn p 7, Vallazza p 27
[183] Ramsauer p 19
[184] Die Fristen dürften eine Einzelfallbeurteilung vor allem bei neuartigen Fällen kaum zulassen, wodurch die Behörde neben der Fristüberschreitung vor allem zwei Möglichkeiten hat: Sie kann das case-by-case-Prinzip vernachlässigen oder sie kann „für Zeit- und Kapazitätsprobleme den Verlängerungsgrund der Unvollständigkeit der Antragsunterlagen vorschieben“ (Leskien in Enquete-Kommission, Band 3 p 156).
[185] Kurier vom 14. 5. 1996, p 23
[186] Bobek p 24
[187] Mauritz, Ernst: „Keine Genpflanzen auf Felder“ in Kurier vom 14. 5. 1996, p 23
[188] Vgl Wiener Zeitung vom 12. . 1996 p 7 und Vallazza p 27
[189] Ramsauer p 19
[190] Bobek, Ernst zitiert in Salzburger Nachrichten vom 14. 5. 1996, p 17
[191] „Es gibt aber niemanden, der sagen kann, sie [die Erdäpfel der Zuckerforschung Tulln ] wären ohne jedes Risiko. Deshalb lehne ich sie ab“ (Krammer, zitiert in Kurier vom 14. 5. 1996, p 23). „Wenn man […] sie [die Wissenschaftler] genauer fragt, ziehen sie sich meistens auf den Standpunkt zurück, daß Risken nicht völlig ausgeschlossen werden könnten“ (Bobek zitiert in Salzburger Nachrichten vom 14. 5. 1996 p 17). Es erhebt sich die Frage „Wie sicher ist sicher genug?“
[192] Vgl RV p 39: „Dieses Gesetz bezweckt eine adäquate gesetzliche Regelung, die eine zufriedenstellende Integration dieser Technologie und ihrer Produkte in unserer Gesellschaft erlaubt.“
[193] Vgl § 40 Abs 1 Satz 2: „Die Genehmigung ist [Hervorhebung durch den Verfasser] zu erteilen“. Vgl auch Erl zu § 40, 2. Absatz
[194] Zum Stand der Technik vgl oben 2.2.3.6 – Stand der Technik.
[195] Vgl Erl RV zu § 1
[196] Vgl Adamovich–Funk p 59
[197] Lt Schenek (p 200) ist es umstritten, ob damit ein absolutes oder ein der Verhältnismäßigkeit unterliegendes Gebot der Gefahrenminimierung vorliegt. In diesem Zusammenhang sei auf die deutsche Rechtslage verwiesen. ZB in § 16 Abs 1 Nr 3 werden die schädlichen Einwirkungen auf die Gesundheit in Verhältnis gesetzt mit dem Zweck der Freisetzung. Genau diese Regelung im GenTG wurde von der EU als nicht mit Art 4 Abs 1 FS-RL vereinbar gerügt, aber nicht weiter verfolgt (vgl Nentwich p 10). Mit „Zweck der Freisetzung“ ist selbstverständlich nicht der mikroökonomische sondern der gesamtwirtschaftliche Zweck gemeint. Es wäre absurd den Nutzen eines einzelnen mit der Gesundheitsgefährdung der gesamten Nation zu messen.
[198] Das mögliche Gegenargument, daß bei den gentechnischen Arbeiten die Sicherheit durch das Containment – vor allem des biologische – gegeben sei, kann nicht gelten gelassen werden. Wie der Fall „Caulerpa taxifolia“ (vgl Fußnote 98) zeigt, ist auch diese als am sichersten geschätzte Form des Containments nicht absolut zuverlässig.
[199] Vgl dazu oben: 2.2.7 – Exkurs: Forschungsfreiheit und Grundrechte
[200] Salzburger Nachrichten 14.5.96 p 17
[201] UBA -Info Jänner 1996, p 2
[202] UBA -Info September 1996, p 14
[203] Krenn p 6
[204] Ein kompromißloses und generelles Importverbot für Gentechnikerzeugnisse – sowohl für Endprodukte als auch für Rohstoffe und Zwischenprodukte – aller Art ist mehr als illusorisch.
[205] Vgl Krenn pp 6 f
[206] Zur Abwanderungsproblematik vgl oben, 2.2.1.1 – Gesetzgebungskompetenz, Rechtssicherheit und Abwanderungsproblematik
[207] Vgl Bangemann, Martin zitiert in Kopeinig, Margaretha: „,Die Gentechnik ist die Zukunft’“ in Kurier vom 8. 7. 1996, p 5
[208] Vgl Enquete-Kommission, Band 3 p 9
[209] Vgl oben, 2.2.7 – Exkurs: Forschungsfreiheit und Grundrechte
[210] Die Definitionen sowohl des Unfalls bei Arbeiten im GS als auch des Unfalls im Zuge von Freisetzungen setzen vor allem an der Ausbreitung außerhalb des GS, resp des Versuchsbereichs an. Ob der Unfall absichtlich oder nicht absichtlich herbeigeführt wurde, ist lt diesen beiden Definitionen egal. In § 4 Z 13 könnte man in der Formulierung „unvorhergesehene Abweichung“ ev die Forderung sehen, daß es an Vorsatz mangeln muß.
[211] Vgl dazu auch oben: 3.1.2 – Exkurs: „Freisetzungsmoratorium“
[212] Voraussetzung ist, daß man in den beiden Formulierung in lit a: „die Anmeldung mit dieser Richtlinie übereinstimmt und daß die Freisetzung erfolgen kann“ und lit b: „die Freisetzung den Auflagen dieser Richtlinie nicht entspricht und daß die Anmeldung daher abgelehnt wird“ eine Schlußfolgerung sieht, der Wortfolge „und daß“ eine konsekutive Bedeutung beimißt, also „und (daß) daher“ darunter versteht.
[213] Vgl die graphische Darstellung des Verfahrens in Lange D II p 14.
[214] Parallel dazu die Hemmung des Fristenlaufes gem § 25 (vgl oben: 2.2.5.3 – Anmeldung und Genehmigung von gentechnischen Arbeiten).
[215] Mit EU-Kommission oder Kommission ist die „Kommission der europäischen Gemeinschaften“ („Kommission“) gem Art 9 des Vertrags zur Einsetzung eines Gemeinsamen Rates und einer Gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (67/443/EWG; „Fusionsvertrag“) gemeint. Die Kommission hat sich aber mit Beschluß vom 17. 11. 1993 den Namen „Europäische Kommission“ gegeben. Die Rechtmäßigkeit dieses Beschlusses wird von Koenig–Haratsch (p 42) angezweifelt.
[216] Vgl unten
[217] In § 39 Abs 3 wird eine Ausnahme angeführt: Im Fall eines vereinfachten behördlichen Verfahrens gem § 42 (vgl unten), ist keine Anhörung durchzuführen. Diese Ausnahme bezieht sich allerdings – was im Gesetzestext nicht hinreichend klargestellt wird – nicht zugleich auch auf das Gutachten des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses. Jenes ist auf jeden Fall einzuholen (vgl Erl RV zu § 39).
[218] Diese Mitteilungspflicht der Behörde ist im GTG nicht normiert, was wohl zur Folge hat, daß die Bestimmung der FS-RL direkt anzuwenden ist.
[219] Vgl oben: 2.2.5.3 – Anmeldung und Genehmigung von gentechnischen Arbeiten
[220] Im Falle des Genehmigungsverfahrens von gentechnischen Arbeiten sind auch noch die Mitglieder des Komitees für biologische Sicherheit (§ 28 Abs 2), im Falle des Genehmigungsverfahrens einer Freisetzung, das BMUJF zu laden (§ 39 Abs 5 lit b).
[221] Vgl Erl RV p 44
[222] Stelzer in ZfV 1996 p 19
[223] Vgl Zacherl in Enquete-Kommission, Band 2 p 166, Erl RV p 44
[224] Vgl Stelzer in ZfV 1996 p 21 und Erl RV p 44
[225] Stelzer in ZfV 1996 p 21
[226] Stelzer in ZfV 1996 p 21
[227] Es stellt sich die Frage, ob dies wirklich nur im Rahmen des Anhörungsverfahrens oder vielleicht auch im Rahmen von anderen Genehmigungs- oder Anmeldeverfahrens möglich ist. Dazu wäre die – wohl eher zu verneinende – Frage zu klären, ob die Tatsache, daß ein Anhörungsrecht im Materiegesetz implizit nicht gewährt werden soll, Auswirkungen auf eine mögliche Parteienstellung nach dem AVG hat.
[228] Stelzer in ZfV 1996 p 21
[229] Probleme und etwas fragliche Lösungen im Zuge von resp für Massenverfahren werden von Thienel (pp 1-77) angeführt (so erwägt er (p 9) einerseits eine Bündelung nach dem Vorbild des § 19 Abs 4 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G), andererseits verwirft er diesen Gedanken mit dem – zutreffenden Argument –, daß es problematisch und mit dem Gebot effektiven Rechtsschutzes unvereinbar wäre, „wenn eine Person ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen kann, sondern durch eine mit eigener Parteistellung ausgestatteten ,Sammelpartei’ mediatisiert wäre“. Andere Möglichkeiten der Bündelung erkennt er als weniger problembehaftet, kann aber keine überzeugende Lösung für diese aufwarten.). Thienel schlägt aber auch umsetzbare und im unten erörterten Entwurf zur Anhörungsverordnung verwendete Lösungen vor. So zB 1. die Vereinfachungen für Zustellung und Parteiladung (p 12 ff) die in den §§ 2 (öffentliche Bekanntmachung) u 4 (öffentliche Ladung) des Entwurfs verwirklicht wurden und 2. die Bindung der „Parteistellung“ an Abgabe von Erklärungen (p 12), die schon in den §§ 28 Abs 1 u 43 Abs 1 GTG vorgesehen war und auch in den Entwurf zur Anhörungsverordnung (§ 4 Abs 1) übernommen wurde.
[230] Lt § 3 GT-AnhVE sind auch alle vom Betreiber bis spätestens einen Tag vor Ende der Auflegungsfrist nachgereichten Unterlagen zur Einsichtnahme aufzulegen. Diese Unterlagen sind jedoch wie alle anderen nur bis zum Ende der Auflegungsfrist, im Extremfall also nur einen Tag lang, aufzulegen.
[231] In beiden Fällen muß natürlich darauf geachtet werden, daß gem §§ 105 f vertrauliche Daten der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden.
[232] Vgl Erl § 4 GT-AnhVE.
[233] Wiener Zeitung vom 16. Mai 1996, p 4
[234] Man beachte die Erl § 3 GT-AnhVE: Zuerst wird konstatiert, Sitz der Behörde ist Wien. Dann wird im nächsten Satz jenen (und nicht nur jenen), „die – aus welchen Gründen immer – von der Möglichkeit zur Einsichtnahme nicht Gebrauch machen (können)“ die Option gegeben, eine Kurzfassung des Antrags anzufordern. Es ist naheliegend zu vermuten, daß sich die Behörde der aus der regionalen Distanz zwischen Sitz der Behörde und Zentrum der am meisten Betroffenen resultierenden Problematik bewußt ist.
[235] Derselben Meinung ist auch Stelzer (in ZfV 1996 p 19), der die bisherige Regelung zu Recht als „in gewisser Weise prohibitiv“ bezeichnet.
[236] Grundsätzlich haben solche Informationen gem § 5 Abs 4 Umweltinformationsgesetz (UIG) unentgeltlich zu erfolgen. Allerdings steht die Möglichkeit offen, für Mitteilungen von Umweltdaten (vgl § 2 insb Z 2 u 3 UIG), die einen größeren Aufwand erfordern – wie dies insb bei der Information von Umweltschutzorganisationen der Fall sein kann –, (von der Bundesregierung verordnete,) pauschalierte Kostenersätze einzuheben.
[237] Dies ist manchmal unmöglich, wenn die beantragte Freisetzung an mehreren Orten stattfinden soll, wie dies zB der Fall gewesen wäre bei dem Vorhaben der Firma AgrEvo (vgl Krenn p 7).
[238] Ausnahme: Vereinfachtes Verfahren gem § 42 zur Genehmigung von Freisetzungen. Vgl § 39 Abs 3.
[239] Auf die Problematik des nationalen Alleingangs soll im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden.
[240] Erl RV p 41
[241] Man mag aber weniger erstaunt darüber sein, daß der Anwendungsbereich der Anhörung einmal die Risikoklassen 2-4, ein anderes Mal bloß die Risikoklasse 4 umfaßt (vgl oben, Abb 7), wenn man bedenkt, daß die Urheber des GTG selbst Zweifel an der effektiven Erfüllung der Anforderung der risikoäquivalenten Abstufung der Öffentlichkeitsbeteiligung zu haben schienen, als sie diese Anforderung im Konjunktiv formulierten, während dies bei den übrigen Anforderungen durchwegs nicht der Fall ist. Nur die Forderung nach Früherkennung von sozialer Unverträglichkeit wird noch mit einem „sollte“ gefordert.
[242] Vgl zB Leskien in Enquete-Kommission, Band 3 p 153, zitiert aus Führ, Public Participation in Approval Procedures for ,Contained Use’ of GEOs, in Leskien–Spangenberg (Hg), European Workshop on Law and Genetic Engineering – Proceedings, 1990
[243] Folgt man dieser Argumentation unkritisch, so wäre es viel leichter möglich, ein Anhörungsverfahren auch beim nationalen Teil des Inverkehrbringungsverfahrens vorzusehen, da dies ja nicht als geregelt angesehen wird. Es erhebt sich die Frage, warum dies vom nationalen Gesetzgeber verabsäumt wurde.
[244] Schenek (p 137) kritisiert, daß die beiden RL verschiedene Rechtsgrundlagen haben.
[245] Argumente pro und kontra Vollharmonisierung vgl Nentwich pp 8 ff.
[246] Vgl unter 3.1.3.3 Stufenprinzip
[247] Vgl Nentwich p 12
[248] Reiß pp 185 f
[249] Gehrlich in Enquete-Kommission, Band 3 p 140
[250] Gehrlich in Enquete-Kommission, Band 3 p 140
[251] Leskien in Enquete-Kommission, Band 3 p 153
[252] Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß in Deutschland für gentechnische Anlagen und Arbeiten zu Forschungszwecken prinzipiell keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist (Spangenberg–Leskien in UBA 91 p 438).
[253] Vgl Schenek p 158: „Freisetzung ist der Oberbegriff, d.h. die sachliche Vorstufe zum spezielleren Tatbestand des ,Inverkehrbringens’.“ In Art 4 Abs 1 FS-RL werden allederdings die beiden Begriffe nebeneinandergestellt („damit die absichtliche Freisetzung oder das Inverkehrbringen von GVO keine Gefährdung […] zur Folge hat“), was diese Sichtweise nicht unbedingt untermauert.
[254] Das ist nicht ganz genau. In Art 10 Abs 1 1. SpStr FS-RL wird nicht die Freisetzung an sich, sondern nur eine Zustimmung zur Anmeldung für eine Freisetzung verlangt (vgl auch Fußnote 300) oder zumindest eine Risikoanalyse für eine Freisetzung.
[255] Schenek p 213
[256] Rhomberg in Enquete-Kommission, Band 3 p 187
[257] Schenek p 207
[258] Lange Teil D II Einleitung Rz 12 ff
[259] Die Risikobewertung der OECD-Guidelines werden in der Systemrichtlinie nahezu vollständig übernommen (Schenek p 207)
[260] Daß die Risikobeurteilung von der Behörde durchgeführt werden muß, steht nicht explizit in Art 10 Abs 1 1. SpStr FS-RL. Der – bezüglich der Kriterien angeführte – Verweis auf Teil B (dort ist in Art 6 Abs 1 2. SpStr FS-RL von einer Beurteilung der Risken der Freisetzung durch die Behörde die Rede), gibt jedoch berechtigten Anlaß darauf zu schließen, daß nur die Behörde eine für diesen Fall relevante Risikobeurteilung durchführen kann (Ebenso Schenek p 213).
[261] Vgl dazu Torgersen in UBA 94, p 9 und Lubitz in UBA 94, p 18
[262] Vgl Idel–Katzek in UBA 91 p 284
[263] Tappeser in Enquete-Kommission, Band 3 p 102
[264] Tappeser in Enquete-Kommission, Band 3 p 103
[265] ZB UBA 94 pp 22 ff; Goy-Duesing p 39.
[266] Vgl Endres–Rehbinder–Schwarze pp 4 ff
[267] Vgl Backhaus in UBA 94 p 24
[268] Vgl zu der Problematik Backhaus in UBA 94, p 26
[269] Vgl Waginger p 72
[270] Man denke an die Einschätzung der Gefährlichkeit von Handfeuerwaffen in den USA und betrachte dazu die diesbezügliche Gesetzeslage. Dann vergleiche man dies mit Einschätzung und rechtlicher Lage in Österreich.
[271] Vgl Backhaus in UBA 94 pp 23 f. Vgl auch 3.1.3.2 – Exkurs: Anhörung.
[272] Lubitz–Halfmann in Enquete-Kommission, Band 3 p 100
[273] Lubitz in UBA 94 p 13
[274] Nach Gassen (zitiert in Tappeser in Enquete-Kommission, Band 2 p 122) ist „[d]ie Rückholbarkeit veränderter oder natürlicher […] Organismen […] bei genauer Betrachtung weder für Tiere und Pflanzen noch für Mikroorganismen gewährleistet“.
[275] Biochemie GmbH in Enquete-Kommission, Band 3 p 215, Leitner in Enquete-Kommission, Band 2 p 126
[276] Damit sind die sog Sicherheitsstämme gemeint. Sie besitzen keine beim Wildtyp vorkommenden pathogenen Eigenschaften mehr. Im Falle des Escherichia Coli-Bakteriums heißt der Sicherheitsstamm Escherichia Coli K 12 (E. Coli K 12). Vgl dazu Leitner in Enquete-Kommission Band 2 pp 125 f.
[277] Vgl oben: 2.2.5 – Arbeiten mit GVO in geschlossenen Systemen
[278] Langenohl in Enquete-Kommission, Band 3 p 60
[279] Vgl im folgenden vor allem: Idel–Katzek in UBA 91 pp 280 ff
[280] Vgl oben: 1.4 – Grundlagen der Biotechnologie
[281] Langenohl in Enquete-Kommission, Band 3 p 61
[282] Vgl im folgenden: Langenohl in Enquete-Kommission, Band 3 p 63
[283] Prokaryonten sind Organismen, die keinen durch eine Membran von der übrigen Zelle getrennten Zellkern haben. Im Gegensatz dazu haben Eukaryonten schon einen Zellkern.
[284] Lubitz in UBA 94 p 15
[285] Vgl dazu: Lubitz in UBA 94 pp12 ff
[286] Vgl zu diesem Absatz: Heberle-Bors in UBA 94 pp16 ff
[287] Vgl dazu: Schellander p 19 ff
[288] Vgl Langenohl in Enquete-Kommission, Band 3 p 4 und Lubitz–Halfmann in Enquete-Kommission, Band 3 pp 99 f
[289] In der Folge ist, wenn „Erzeugnisse, die aus GVO bestehen oder solche enthalten“ angesprochen sind, mit GVO immer ganze GVO gemeint. Gem der Legaldefinition in § 4 Z 3 iVm Z 1 sind GVO vermehrungsfähige Einheiten, woraus generell folgt, daß mit GVO niemals zugleich auch bloße Teile von GVO gemeint sind. Explizit ist diese Unterscheidung § 62 Abs 4 zu entnehmen. Dort werden den GVO der Begriff der „Teile von GVO“ gegenübergestellt. Es folgt daraus, daß das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die aus Teilen von GVO bestehen oder solche enthalten, nicht genehmigungspflichtig ist, diese Erzeugnisse in Hinkunft aber kennzeichnungspflichtig sein können.
[290] UBA 93 p 88
[291] Schenek pp 159 f
[292] Die FS-RL bestimmt, daß „[j]edes neue Erzeugnis, das die gleichen GVO […] enthält oder daraus besteht, aber für einen anderen Zweck bestimmt ist, [bedarf] einer getrennten Anmeldung“ bedarf. Ausnahmen gibt es keine. Man beachte zudem den feinen Unterschied, der allerdings ohne Auswirkungen bleibt: Lt GTG sind diese Erzeugnisse bereits genehmigte Erzeugnisse, die einer gesonderten Genehmigung bedürfen (§ 54 Abs 2). In der FS-RL ist so ein Erzeugnis ein neues Erzeugnis, das einer getrennten Anmeldung bedarf (Art 11 Abs 4 FS-RL).
[293] Dabei nehmen solche Nachkommen und drehe „Vorfahren“ ihren Ursprung wohl immer in einem GVO, der, sofern er nicht direkt vom Freisetzer verarbeitet wird, zur weiteren Verarbeitung an Dritte weitergegeben, also in Verkehr gebracht werden und dazu genehmigt werden muß. Diesen GVO hatte man bei der Formulierung „Nachkommen von GVO“ wohl vor Augen.
[294] Als Beispiel für „Nachkommen von GVO“ führen die Erl RV zu § 54 „das Mehl eines transgenen Getreides“ an. Dieses – an und für sich korrekte – Beispiel ist insoferne unglücklich gewählt, als daß dieses Mehl nicht aus GVO besteht oder solche enthält und somit ohnehin nicht genehmigungspflichtig wäre.
[295] Vgl dazu auch die graphische Darstellung in Lange D II pp18-19.
[296] Vgl § 2 Z 2 UIG: „[Umweltdaten sind Informationen über] Vorhaben oder Tätigkeiten, die Gefahren für den Menschen hervorrufen oder hervorrufen können oder die Umwelt beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, insbesondere durch […] gefährliche Organismen“. Mit Vorhaben sind vor allem auch die Genehmigungsanträge und die Anmeldungen gemeint (vgl Schober–Lopatta § 2 UIG Rz 5).
[297] Die Geltung dieser Vorschriften ist aber auch bei Verfahren zu Arbeiten im GS oder zu Freisetzungen von Interesse, insb dann, wenn die Auflegungsfrist bereits verstrichen ist. Das Recht auf Auskunftserteilung, resp der freie Zugang zu Umweltdaten, ist nämlich nicht an Fristen gebunden, woraus folgt, daß man sowohl vor als auch nach der Auflegungsfrist Einsicht in die Unterlagen nehmen oder sich in sonst geeigneter Weise informieren kann. Die Frist zur Erhebung von Einwendungen gem §§ 28 Abs 1 u 43 Abs 1 wird dadurch allerdings nicht berührt.
[298] Die jeweils geschützten Rechtsgüter (Datenschutz versus Schutz der Gesundheit etc) sind sorgfältig gegeneinander abzuwägen. „Beispielsweise werden Mitteilungen immer dann zu geben sein, wenn die angefragten Informationen solche Umweltbelastungen offenlegen würden, die eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit [Hervorhebung durch den Verfasser] von Menschen darstellen“ (Schober–Lopatta § 4 UIG Rz 16). Würde die Behörde dieses Beispiel als Minimallösung verstehen, wäre Einsicht in diese Daten nur möglich, wenn die Behörde den Antrag ohnehin wegen Gefährdung der Sicherheit abweisen müßte. Zur Amtsverschwiegenheit vgl Perthold-Stoitzner pp 133 ff.
[299] Wohlfahrt p 16
[300] Von Kombinationen von GVO ist hier nicht mehr die Rede, bloß von einem GVO.
[301] Demnach bedarf es einer in einem Mitgliedstaat genehmigten und durchgeführten Freisetzung oder bloß des Nachweises des Vorliegens der Voraussetzungen für die Genehmigung einer Freisetzung nach österreichischen Vorschriften. Dies bezieht sich auf Art 10 Abs 1 1. SpStr FS-RL, wo entweder eine Zustimmung zur Freisetzung nach der RL gefordert wird oder bloß eine Risikoanalyse zur Freisetzung, allerdings in einem beliebigen Mitgliedstaat. Insofern besteht als im GTG ein kleiner Widerspruch zur FS-RL.
[302] Primär ist wohl an die Einigung auf Zulassung des Inverkehrbringens gedacht worden. Vorstellbar wäre aber auch, daß die Mehrheit (oder eine Minderheit) der zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten Einwendungen erheben und sich mit er nationalen Behörde des Antragstellers un den anderen befürwortenden nationalen Behörden auf eine Ablehnung der Zulassung einigen.
[303] Es handelt sich hiebei um das sog Regelungsausschußverfahren in der Variante a (Verfahren III a) gem Art 2 des Komitologiebeschlsses (Beschluß des Rates vom 13. Juli 1987; 87/373/EWG). Vgl dazu Harnier Art 145 EGV Rz 29 ff, Geiger p 515, Hummer Art 155 EGV Rz 56 ff, Schmitt von Sydow Art 155 EGV Rz 60. Vgl auch Lange D II pp18-19
[304] Welch vielfältigen Aspekten die Stimmenwägung Rechnung tragen soll, ist in Schweitzer Art 148 EGV Rz 5 nachzulesen.
[305] Mit EU-Ministerrat etc ist der „Rat der europäischen Gemeinschaften“ („Rat“) gem Art 1 Fusionsvertrag gemeint.
[306] Vgl Lange Teil D II Einl. p 19. Österreich ist in diesem Ministerrat durch den BMUJF vertreten. National ist jedoch vor allem der BMGK zuständig, woraus sich die Notwendigkeit einer Absprache ergibt.
[307] Daß der Rat beim IIIa -Verfahren zur Ablehnung der von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen der Einstimmigkeit bedarf, wird in der Literatur nicht explizit genannt (vgl Harnier Art 145 EGV Rz 29, Hummer Art 155 EGV Rz 58, Schmitt von Sydow Art 155 EGV Rz 64; Borchardt (p 165) spricht fälschlicherweise überhaupt nur von einem Regelungsausschußverfahren, bei dem lediglich einfache Mehrheit zur Ablehnung genügen soll). Einerseits ist anzunehmen, daß mangels anderslautender Bestimmung einfache Mehrheit genügt (Art 148 Abs 1 EGV), die Einstimmigkeit also in jedem einzelnen Fall vorgeschrieben sein muß, andererseits enthält Art 189a EGV wiederum eine Einschränkung dieses Prinzips: Wird der Rat kraft EGV auf Vorschlag der Kommission tätig, so kann er (vorbehaltlich des Art 189b Abs 4 u 5) Änderungen dieses Vorschlags nur einstimmig beschließen. Ob diese Regel auf die Ausschußverfahren anzuwenden ist, scheint jedoch fraglich, weil der Rat ja nicht kraft des Gründungsvertrages, sondern des Komitologiebeschlusses (87/373/EWG) tätig wird.
Jedenfalls gehen sowohl Praxis als auch Literatur von dem Erfordernis der Einstimmigkeit für die Ablehnung im IIIa Verfahren aus. Hummer (Art 155 EGV Rz 58) zB stellt zum IIIb-Verfahren fest: „Beim besonderen Regelungsausschußverfahren kann der Rat sogar [meine Hervorhebung] durch einfachen Mehrheitsbeschluß verhindern, daß die tertiäre Auffangkompetenz der Kommission wieder auflebt“. Schließlich wäre die Variante b überflüssig, wenn schon bei der Variante a eine Ablehnung mit einfacher Mehrheit erreicht werden könnte. Auch die Systematik des Komitologiebeschlusses – die Anordnung der Verfahren in Art 2 des Beschlusses (Beratender Ausschuß (I), Verwaltungsausschuß (IIa+b), Regelungsausschuß (IIIa+b)) entspricht dem stufenweisen Zuwachs der Mitwirkungsmöglichkeiten des Rates – spricht dafür.
[308] Hummer (Art 155 EGV Rz 57) spricht von einer primären Kommissionskompetenz, einer sekundären Ratskompetenz und einer tertiären Kommissionskompetenz.
[309] Vgl zB Schenek p 222
[310] Allerdings gilt auch die Ablehnung der Genehmigung in der gesamten Gemeinschaft (Schenek p 222).
[311] Die FS-RL spricht im Zusammenhang mit Inverkehrbringen fast immer vom Produkt. In der Definition von Inverkehrbringen (Art 2 Z 5 FS-RL) fehlt der Produktbegriff allerdings. Für das GTG hat Gesetzgeber statt „Produkt“ das Wort „Erzeugnis“ gewählt, was aber kaum einen Unterschied darstellt.
[312] Gentechnische Arbeiten und Freisetzungen lassen sich auch länger und vor allem unwiderruflich mit solchen nachträglichen Auflagen behindern (§§ 33 u 48).
[313] Sollte es bei diesem Verfahren zur Befassung des Rates kommen, dann kann die Beschlußfassung insgesamt natürlich länger als drei Monate dauern, da allein der Rat bis zu drei Monate Zeit zur Beschlußfassung hat.
[314] Zu beachten ist, daß das GTG generell anderen Gesetzten nicht derogiert (§ 110 Abs 2). Bis auf wenige Ausnahmen, wie der Datenschutz (vgl § 71 Abs 2), aber auch die Verfahrenskonzentrationen der §§ 26 f u 58 Abs 8 oder die Nichtanwendung des § 62 Abs 2 f bedeutet das GTG zumeist zusätzlichen bürokratischen Aufwand.
[315] Die Behörde kann unter bestimmten Voraussetzungen auf die Angabe unter anderem des Verpackungsvorschlages oder bestimmter Teile des Kennzeichnungsvorschlages verzichten (§ 55 Abs 5). Das bedeutet aber nicht, daß diese nicht angegebenen Kennzeichnungteile bei der endgültigen Kennzeichnung ausgelassen werden dürfen. Die Kennzeichnung von Erzeugnissen hat alle fünf Punkte zu umfassen (vgl § 62 Abs 2).
[316] Darunter ist der Importeur zu verstehen, der von außerhalb des EWR Erzeugnisse in den EWR einführt. Bei Importen von einem Mitgliedstaat in einen anderen ist demnach vor allem der Hersteller in der Kennzeichnung zu nennen.
[317] Vgl Erl RV zu § 61
[318] Vgl oben, 3.2.1 – Gesetzliche Regelung des Inverkehrbringens
[319] Mit den beiden Kennzeichnungsverordnungsentwürfen wird ersichtlich, daß man im BMGK eher die allgemeinverständliche Bezeichnung im Sinne hat (vgl unten). Vgl auch von Weizsäcker: „Ab welcher Semesterzahl eines Biochemiestudiums soll die Freiheit […] denn anfangen?“ (in Enquete-Kommission, Band 3 p 48).
[320] Die im Entwurf befindliche Verordnung verwendet übrigens den Terminus „Produkt“.
[321] Der Begriff „gewerbsmäßige Abgabe“ ist dem Begriff „Inverkehrbringen“ iSd § 4 Z 21 gleichzusetzen. Auch das Einführen nach Österreich ist damit erfaßt. Dies folgt zB aus dem Entwurf zur Gentechnik-Kennzeichnungsverordnung (§ 3 lit a iVm § 1 Abs 2 leg cit).
[322] Zur Gentechnikkennzeichnungsverordnung vgl unten, 3.2.1.3 – Exkurs: Kennzeichnungsverordnungen.
[323] § 55 Abs 2 Z 7 lit d sublit cc wurde auf zwei Punkte aufgeteilt, so daß es nun sechs Punkte sind.
[324] Hier stellt sich wieder die Frage, ob es sich bei der FS-RL um eine teil- oder eine Vollharmonisierung handelt (vgl oben: 3.1.3.2 – Exkurs: Anhörung).
[325] Schenek p 161
[326] Vgl zu dieser Thematik zB Epiney pp 50 ff. Vor allem wäre es anzuraten die Kennzeichnungsverordnungen noch vor der Novel-Food-Verordnung in Geltung zu setzen, um so dem Auslegungsstreit um das Wort „anzuwenden“ in Art 100a EGV zu entgehen.
[327] Damit wäre in diesem Bereich das Problem der mangelhaften Umsetzung in bezug auf die Kennzeichnung behoben.
[328] Im GT-KennzVE wird nun der in der FS-RL gebräuchliche Terminus „Produkte“ verwendet, der im GTG übliche Begriff „Erzeugnisse“ wurde in Klammer nachgestellt.
[329] Jene Kennzeichnungselemente, die in § 62 Abs 1 erwähnt sind, hätten demnach keine Drittwirkung. Diese würden nur für den Bescheidempfänger gelten.
[330] Das GTG enthält zwar keine explizite Verordnungsermächtigung für die Kennzeichnung von Erzeugnissen, die aus GVO bestehen oder solche enthalten, diese ist aber gem Art 18 Abs 2 B-VG nicht notwendig (vgl Walter–Mayer Rz 598, Adamovich–Funk p 115; vgl auch oben: 2.2.3.6 – Stand der Technik).
[331] Dies entspricht im großen und ganzen auch den Forderungen der Enquete-Kommission (Band 1 pp 15 f). Diese forderte allerdings auch die Kennzeichnung von Produkten, die mit Hilfe von GVO erzeugt werden. Vgl dazu unten bei der GT-ErzKennzV.
[332] Z 1 ist sprachlich adaptiert, weil es sich ja um Produkte handelt, die nicht GVO, sondern Teile von GVO enthalten, und es wird die genaue Bezeichnung verlangt. Z 2 ist wortwörtlich übernommen worden. Z 3 verlangt nicht die Angabe der besonderen Eigenschaften des Erzeugnisses, sondern des GVO. Daß diese drei Punkte aus dem GTG übernommen wurden, wird auch daran ersichtlich, daß hier wieder der Begriff „Erzeugnis“ verwendet wird, obwohl zuvor im Absatz noch von „Produkten“ die Rede war.
[333] Es bleibt zu fragen, warum dies auch nicht für die Angaben gem § 1 Abs 2 Z 1-3 GT-KennzVE gelten soll.
[334] Auch wenn hier nicht von einer gewerbsmäßigen Abgabe die Rede ist, ist wohl eine solche gemeint. Bei den verpackten Produkten ist nicht einmal die Abgabe erwähnt. Daß aber kommerzielle Zwecke verfolgt werden müssen, damit die Produkte kennzeichnungspflichtig werden, folgt aus den Formulierungen der § 1 Abs 1 GT-KennzVE („in Verkehr gebracht“; vgl Inverkehrbringen gem § 4 Z 21; der kommerzielle Bezug gilt daher auch für das Einführen) und Abs 2 GT-KennzVE („gewerbsmäßig […] abgegeben“).
[335] Hallman p 35; vgl auch oben: 3.1.4.1 – Risikobeurteilung
[336] Vgl von Weizsäcker in Enquete-Kommission, Band 3 p 3 u Band 2 p 51
[337] Damit nämlich Produkte aus GVO bestehen oder GVO enthalten können (vgl § 62 Abs 1 u 2 iVm § 54 Abs 1 und § 1 Abs 1 GT-KennzVE), müssen diese GVO in den Produktionsprozeß einfließen. Bei der Erzeugung von Produkten, die aus Teilen von GVO bestehen, resp Teile von GVO enthalten (vgl § 1 Abs 2 GT-KennzVE), müssen zwar bloß Teile von GVO einfließen, aber § 1 Abs 2 GT-KennzVE besagt, daß kennzeichnungspflichtige Produkte nicht nur aus Teilen von GVO bestehen oder solche enthalten müssen, sondern außerdem aus ganzen GVO hergestellt werden müssen.
[338] Diese Vorschrift deckt sich mit der des GT-KennzVE. Die Definition des Wortes „verpackt“ ist der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LMKV) zu entnehmen (§ 2 Abs 2 GT-ErzKennzVE).
[339] Einrichtungen der Gemeinschaftsversorgung sind Anstaltsküchen, Werksküchen etc (vgl Feil, LMR II p 9).
[340] Vgl Feil, LMR II p 10
[341] Auf jeden Fall muß der Hinweis auch an gut sichtbarer Stelle und deutlich lesbar, nicht nur dauerhaft auf der Verpackung oder einem Etikett angebracht sein.
[342] Hier ist der kommerzielle Bezug explizit angeführt, auch für verpackte LVZ ist er durch § 1 Abs 1 u 2 GT-ErzKennzVE gegeben (jeweils: „in Verkehr gebracht“). Dieses „in Verkehr gebracht“ gilt aber auch für nicht verpackte LVZ. Wenn mit Inverkehrbringen jene Legaldefinition des § 4 Z 21 angesprochen ist, ergibt sich hier ein Widerspruch. Der Begriff „Inverkehrbringen“ iSd GTG enthält nämlich jene gewerblichen Vorbereitungshandlungen, die in § 4 lit b GT-ErzKennzVE angeführt werden (Lagern, Feilhalten, Verkauf, Verwenden für andere etc) nicht. Dafür ist diese Auffassung von Inverkehrbringen mit jener der FS-RL im Einklang (vgl Art 2 Z 5 FS-RL, s auch 3.2.1 – Gesetzliche Regelung des Inverkehrbringens).
[343] Vgl im folgenden den Entwurf einer Empfehlung für die zweite Lesung betreffend den gemeinsamen Standpunkt des Rates vom 23. Oktober 1995 im Hinblick auf den Erlaß einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten.
[344] Zum Kodezisionsverfahren gem Art 189b EGV vgl zB Hetmeier Art 189b.
[345] Die hierfür benutzte Quelle ist ein Ratsdokument vom 26. 11. 1996.
[346] Im Geänderten Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten vom 19. 1. 1994 war an dieser Stelle als alternatives Kriterium vorgesehen, daß die Erzeugnisse durch eine bedeutende Veränderung in Zusammensetzung, Nährwert oder Bestimmung bewirkende, unübliche Verfahren hergestellt wurden. Diese Passage ist nun unter lit f leicht modifiziert angeführt (vgl unten).
[347] Die Regelung der Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die aus GVO hergestellt wurden, aber keine enthalten, entspricht in etwa § 1 Abs 2 GT-ErzKennzVE. Der Unterschied liegt im wesentlichen darin, daß hier nicht Lebensmittel und Verzehrprodukte, sondern Lebensmittel und Lebensmittelzutaten angesprochen sind.
[348] Der Mitgliedstaat kann auch die EU-Kommission ersuchen, eine Prüfung in Auftrag zu geben (Art 6 Abs 2 UAbs 1 NF-VE).
[349] Nach dem Wortlaut des Art 6 Abs 4 UAbs 2 NF-VE kommt die EU-Kommission in die interessante Situation, daß sie ihre Bemerkungen/Einwendungen sich selbst übermittelt.
[350] Der alte Entwurf (1. Dezember 1993) sah zudem noch weitreichende Befugnisse EU-Kommission vor, was zu weiteren, grundsätzlichen Diskussionen führte und das Zustandekommen der Verordnung zusätzlich verschleppte. Es sollten der Kommission zB weitreichende Befugnisse zugestanden werden, die die Mitgliedstaaten auf Erlassung vorläufiger Maßnahmen beschränken. Das ließ sich nicht mit dem in Art 3b normierten und immer mehr betonten Subsidiaritätsprinzip vereinbaren (vgl oben, 2.2.1.1 – Gesetzgebungskompetenz, Rechtssicherheit und Abwanderungsproblematik). Vielmehr stellte der alte Entwurf (1. 12. 1993) eine weitläufige Durchbrechung des Subsidiaritätsprinzips dar, die man fast schon als Umkehrung desselben zu sehen geneigt sein konnte (vgl Schenek pp 175 u 181).
[351] Merkwürdig ist, daß hier der Antragsteller unterrichtet wird, daß er das Erzeugnis in den Verkehr bringen darf, obwohl die Regelung nur Sinn macht, wenn das Erzeugnis generell, also von jedem in den Verkehr gebracht werden darf.
[352] Vgl oben: 3.2.1.1 – Genehmigungsverfahren
[353] Was nicht gleichwertig im genannten Sinn ist, wird gleich unter lit a definiert: Ein Novel-Food „ist bestehenden Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten nicht mehr gleichwertig […], wenn durch eine wissenschaftliche Beurteilung […] nachgewiesen werden kann, daß im Vergleich zu bestehenden Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten Abweichungen von den obengenannten Merkmalen oder Eigenschaften […] festzustellen sind“.
[354] Die Ausnahme, „wenn der Genehmigung ein Verfahren nach Art 7 iVm Art 13 NF-VE vorangegangen ist und in diesem festgestellt wurde, daß nicht lediglich eine Veränderung der agronomischen Merkmale vorliegt“ wurde gestrichen.
[355] Dabei kann bei der Erlassung von Durchführungsbestimmungen gem Art 8 Abs 3 iVm Art 13 NF-VE die sekundäre Kompetenz des Rates aufleben. Bis auf diesen – kaum nennenswerten Fall – hat also die Kommission bei der Zulassung dieser Lebensmittel und Lebensmittelzutaten die alleinige Kompetenz.
[356] Immerhin wurde die Frist von 12 Monaten zwischen Veröffentlichung im Amtsblatt und Inkrafttreten auf Grund der Dringlichkeit auf 90 Tage reduziert.
[357] Vgl Kurier vom 28. 11. 1996 p 24. Die Frage, wie schnell ein Unternehmen auf die Nachweisbarkeit mit einer entsprechenden Etikettierung zu reagieren hat, wird wohl noch einigen Diskussionsstoff liefern.
[358] Vgl Kurier vom 28. 11. 1996 p 24
[359] Oftmals wird diese auch Positiv-Kennzeichnung genannt. Man vergleiche das Problem „negativer Aidstest – positiver Aidstest“.
[360] Schenek p 176
[361] Vgl oben: 2.2.1.1 – Gesetzgebungskompetenz, Rechtssicherheit und Abwanderungsproblematik
[362] Schenek p 178
[363] Vgl Nentwich p 20. Vgl auch Bartenstein zitiert in Wiener Zeitung vom 20. 6. 1996 p 4 u Krammer zitiert in Standard vom 26. 11. 1996 p 5.
[364] Ausfuhrbeschränkungen spielen beim nationalen Protektionismus eine untergeordnete Rolle (vgl Hakenberg p 90).
[365] Mit „Maßnahmen gleicher Wirkung“ soll betont werden, daß alle Maßnahmen mit derselben Wirkung von mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen verboten sind. egal wie sie motivert sein mögen. Kriterium ist einzig und allein die Wirkung, egal ob sie beabsichtigt oder unbeabsichtigwaren, egal was mit den sie hervorrufenden Maßnahmen intendiert war.
[366] Hakenberg p 90
[367] EuGH, Urteil vom 11. 7. 1974, 8/74, Slg p 837
[368] Vgl Hakenberg p 91
[369] Hakenberg (p 92) führt drei sehr anschauliche Beispiele an, von denen hier eines übernommen werden soll: „Margarine wird in Belgien nur in Form von Würfeln von 10´10´10 cm zugelassen (in Wirklichkeit wird nur in Belgien Margarine auf diese Art und weise verpackt)“.
[370] Urteil vom 12. 3. 1987, 178/84, Slg p 1227
[371] Hakenberg p 93
[372] Urteil des EuGH vom 20. 2. 1979m 120/78, Slg p 649
[373] Henke p 170
[374] „Pfandflaschen-Urteil“; Urteil vom 20. 9. 1988, 302/86. Vgl auch Henke p 171.
[375] Henke p 174
[376] Wie bereits oben (vgl 3.2.1.1 – Genehmigungsverfahren) erwähnt, ist im Regelungsausschußverfahren IIIa entweder die Kommission zu überzeugen oder Einstimmigkeit im Ministerrat zu erzielen,
[377] Krammer zitiert in Wohlfahrt p 16
[378] Vgl im folgenden Abschnitt vor allem UBA -Info September 1996 pp 14 ff
[379] Entscheidung der Kommission vom 6. Februar 1996 über das Inverkehrbringen eines genetisch veränderte Organismen enthaltenden Produkts – herbizidresistente Rapshybride Samen (Brassica napus L. oleifera Metzq. MS1Bn ´ RF1Bn) gemäß der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (96/158/EG)
[380] Entscheidung der Kommission vom 20. Mai 1996 über das Inverkehrbringen eines genetisch veränderter männlich-steriler Chicoree-Pflanzen (Cichorium intybus L.) mit teilweiser Toleranz gegenüber dem Herbizid Glufosinatammonium gemäß der RL des Rates 90/220/EWG (96/424/EG)
[381] Entscheidung der Kommission vom 3. April 1996 über das Inverkehrbringen genetisch veränderter Sojabohnen (Glycin max. L.) mit erhöhter Verträglichkeit des Herbizids Glyphosat nach der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (96/281/EG)
[382] Wohlfahrt p 15
[383] Mauritz, Ernst: „Nestlé verzichtet auf Gen-Soja“ in Kurier vom 29. 10. 1996, p 24
[384] Mauritz, Ernst: „Ist ,Nein zu Gen-Food’ realistisch?“ in Kurier vom 17. 10. 1996, p 24
[385] Dieser Mais ist mittels eines Gens des Bakteriums „ Bacillus thuringiensis “ (B.th.) gegen den Maiszünsler resistent. Außerdem ist er gegen das Totalherbizid „ Basta “ der Firma Höchst resistent und drittens weist er noch eine Antibiotikaresistenz gegen das Antibiotikum „ Ampicilin “ auf, die aus dem bakteriellen Produktentwicklungsstadium stammt. Die Herbizidresistenz wird wegen der Möglichkeit zum erweiterten Spritzmitteleinsatz kritisiert, der die Einsparungen durch die Insektenresistenz überkompensieren könnte. Weiterer Kritikpunkt ist die Antibiotikaresistenz, die sich unter Umständen auf die Darmbakterien übertragen könnte (vgl Bartenstein, Martin, zitiert in Mauritz, Ernst: „Gen-Mais: Widerstand gegen die Zulassung“ in Kurier vom 24. 6. 1996 p 21; Wiener Zeitung vom 26. 6. 1996 p 1).
[386] Es wurden unter anderem neuere wissenschaftliche Erkenntnisse über den horizontalen Gentransfer von Antibiotikaresistenzgenen vorgelegt (vgl UBA -Info September 1996, p 17).
[387] Vgl dazu Schenek pp 143 f
[388] Welser pp 194 f
[389] Neuerdings ist dies nicht mehr so sicher (vgl unten: 4.1.2.3 – Gefährdungshaftung für Anlagen).
[390] Vgl Eberbach–Lange–Ronellenfitsch Band 3 Entscheidungssammlung; Nr 2 zu § 16 GenTG p 1. Zur Sozialadäquanz gentechnischer Restrisiken vgl auch Eberbach Teil A I Rz 60 ff.
[391] Welser p 194
[392] Feil, GTG p 87
[393] Welser p 200 u Stelzer (mit weiteren Verweisen) in ZfV 1996 p 21
[394] Welser p 202
[395] Welser pp 193 f
[396] Welser p 199
[397] Welser p 195
[398] Welser p 194
[399] Das gibt zu bedenken, daß, wenn der prima-facie-Beweis widerlegt wurde, dem Geschädigten der Vollbeweis obliegt (vgl Koch–Ibelgaufts p 283).
[400] Welser p 196
[401] Vgl Welser pp 197 f
[402] Die Phrase „Naturprodukte, die GVO sind“ mag etwas widersprüchlich klingen. Mit Naturprodukten sind „natürlich gewachsene“ Produkte gemeint, ohne Rücksicht darauf, was das Ausgangsprodukt war.
[403] Oftmals wird es sich zweifellos ergeben, daß Naturprodukte, die GVO oder Teile davon enthalten oder aus solchen bestehen, also keine GVO als Ganze sind, bereits verarbeitet sind und somit ohnehin ein Produkt iSd PHG darstellen.
[404] Aus diesem Grund – so sollte man meinen – müßten die Hersteller freiwillig eine umfassende Kennzeichnung ihrer gentechnischen Produkte vornehmen.
[405] Welser p 212
[406] Man vergleiche mit dem Standpunkt des BMGK in bezug auf die Genehmigung von Freisetzungen von GVO. Da die Zulassungsbehörde ohnehin kein größeres Risiko zuläßt, ist es unwahrscheinlich, daß es je zu einer Haftung nach dem PHG kommen wird.
[407] Welser p 212
[408] Welser p 218
[409] Höhne p 273
[410] OGH 11. 10. 1995, 3 Ob 508/93 in RdU 1996 pp 39-45 mit Glosse Kerschner–Raschauer (pp 44 f)
[411] Kerschner–Raschauer p 44
[412] Die Entscheidung bezieht sich auf einen deliktischen Schadenersatzanspruch. Die Übertragbarkeit auf die nachbarrechtlichen Unterlassungsansprüche resp stattdessen gewährten, verschuldensunabhängigen Schadenersatzansprüche gem § 364a ABGB ist aber gegeben (Bußjäger p 122).
[413] Es werden in § 364a ABGB im wesentlichen Unterlassungsansprüche gegen das ortsübliche Maß übersteigende Beeinträchtigungen verwehrt und stattdessen verschuldensunabhängige Ersatzansprüche gewährt., auch wenn die Beeinträchtigung auf „Umstände […] auf die bei der behördlichen Verhandlung keine Rücksicht genommen wurde“, zurückzuführen sind. Immissionen, die Leben oder Gesundheit von Nachbarn gefährden, können nach Kerschner (in Juristische Blätter (JBl) 1993 p 218) aber durch die behördliche Genehmigung auf keinen Fall nicht gedeckt sein.
[414] Bußjäger p122
[415] Anderer Meinung sind Kerschner–Raschauer (p 44): „Hier und nur hier [gemeint ist die nachträgliche Änderung der Sach- oder Rechtslage] hatten die Nachbarn kein Recht auf Gehör!“. Dies entspricht aber nicht der Begründung des OGH (vgl RdU 1996 p 43), der nur dann keine Ansprüche aus § 364a gewährt, wenn weder eine Änderung der Sachlage eintrat noch dem Nachbarn das rechtliche Gehör zustand. „Trotzdem eingetretene Schäden können vom Nachbarn […] gem § 364a ABGB liquidiert werden“ (vgl RdU 1995 p 43).
[416] Kerschner–Raschauer p 44
[417]
[418] Vgl § 3 Nr 9 GenTG. Potentiell haftpflichtig ist jene Person, die gentechnische Anlagen betreibt, gentechnische Arbeiten oder Freisetzungen durchführt oder ohne Genehmigung GVO-Produkte erstmalig in den Verkehr bringt. Jemand, der Produkte, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen, und für die eine Genehmigung zum Inverkehrbringen (auch der Nachkommen) erteilt wurde, erstmalig in Verkehr bringt, ist hingegen nicht Betreiber iSd § 3 Nr 9 GenTG. Schäden aus genehmigten Produkten sollen nämlich nach der (deutschen) Produkthaftung geregelt werden (§ 37 Abs 2 GenTG).
[419] Welser p 220
[420] Brünner in StenProtNR XVIII 168 p 19696.
[421] Dieser Meinung ist Welser (p 202) zB beimNachbarschutz. Vgl auch Welser p 218
[422] ZB Luf p 40
[423] Kresbach p 234
[424] Vgl unten „farmer’s privilege“
[425] Virt in Enquete-Kommission, Band 3 p 206
[426] Hier liefen die grammatikalische und die teleologische Interpretation auf dasselbe Ergebnis hinaus: Patentschutz für Pflanzen als solche.
[427] Hier waren die Resultate der grammatikalischen und der teleologischen Interpretation unterschiedlich. Erstere läßt Patentschutz für Tiere als solche zu, letztere negiert den patentrechtlichen Schutz für Tiere allgemein.
[428] Vgl dazu unten.
[429] Es handelt sich bei der „ Krebs-Maus “ um einen Organismus, dem ein Krebsgen eingesetzt wurde und der daher eine höhere Krebsanfälligkeit aufweist, als herkömmliche Mäuse (Kamphausen in UBA 91 pp 241 f). Der Antrag wurde 1985 eingereicht, wurde 1989 ursprünglich wegen der Auffassung des EPA, daß Tiere nicht patentierbar wären, abgelehnt, nach einer Neuinterpretation des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ 1973) durch die Beschwerdekammer und einer Prüfung in bezug auf ethische Bedenken (vgl nächste Fußnote) durch die Prüfungsabteilung wurde das Patent dann 1991 erteilt. Bis Februar 1993 lief die Einspruchsfrist, nach der wieder einige Verfahren stattfanden. Erst im November 1995 gab es eine Anhörung beim EPA. Vgl Teschemacher in Enquete-Kommission, Band 2 p 281 und Johnson p 20.
[430] Es wurde im damaligen Prüfungsverfahren kontrolliert, ob die transgene Maus eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellt. Auf Grund ihrer ausschließlichen Verwendung in Labors wurde dies verneint. Da medizinische Forschung an sich generell nicht als sittenwidrig empfunden werde und der Zweck der Erfindung ihre Nachteile überwiege, wurde das Patent erteilt (Teschemacher in Enquete-Kommission, Band 2 p 281).
[431] So kann ein neuartiges Messer patentiert werden, auch wenn es als Mordwaffe verwendet werden kann (vgl Wolf in Enquete-Kommission, Band 2 p 291).
[432] Enquete-Kommission, Band 3 p 23
[433] Enquete-Kommission, Band 3 p 23
[434] Ein – nicht direkt zum Themenkreis Patentierung gehörender – ethischer Aspekt sei hier noch kurz angeführt: Tieren werden mittlerweile menschliche Gene eingepflanzt (vgl Wiener Zeitung vom 26. 7. 1996 p 24). Für den Fall, daß solche Tiere oder andere Produkte mit menschlichen Genen jemals für den Verzehr bestimmt sein sollten, bleibt zu fragen, ab wievielen menschlichen Genen im Verzehrprodukt beim Verzehr Kannibalismus zu erwägen wäre.
[435] In den USA und in Japan ist die Patentierung auch von sog „desease models“ erlaubt. Aus diesen Gründen wird die diesbezügliche Forschung oft in die USA verlegt. Obwohl es die Konzerne auf Grund diverser Umgehungsmöglichkeiten nicht oder nur kaum trifft, daß die Patentierung von Tierarten und Tieren in Europa (vorerst) nicht resp nur schwer möglich ist, setzen sie sich für die Beseitigung der Patentierung entgegenstehender Bestimmungen ein. Vgl Johnson pp 20 f.
[436] Weitere Argumente gegen Patentierbarkeit und Sortenschutz von Tieren: Kamphausen in UBA 91 pp 245 ff
[437] Teschemacher in Enquete-Kommission, Band 2 p 278.
[438] Kamphausen in UBA 91 p 241, zitiert aus einer Entscheidung des US Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interferences (PTO) vom 3. 4. 1987
[439] Vor 1985 wurde bei einem „alten“ Prozeß die Neuheit und die Nichtoffensichtlichkeit fingiert, wenn entweder das Ausgangsmaterial oder das Ergebnis des Prozesses neu und „unobvious“ war. Man sprach vom sog „analogous process“. Im „Durden-Urteil“ des Berufungsgerichts wurde 1985 die Patentierbarkeit eines Prozesses mit neuem Ausgangs- und Endmaterial verneint. Neue, patentierbare Ausgangs- und Endmaterialien müssen nicht unbedingt einen alten Prozeß patentierbar machen. Dieses Urteil wurde in der Folge vom PTO derart angewandt, daß praktisch kein „analogous process“ mehr patentiert wurde. Der 1995 verabschiedete „Biotechnology Process Patent Protection Act“ bestimmt nun, daß – wie vor dem „Durden-Urteil“ von der Praxis gehandhabt – Prozesse patentierbar sind, wenn das Ausgangs- oder das Endmaterial neu und nicht offensichtlich und daher patentierbar ist (vgl Sorell–Seide pp 158 f).
[440] Vgl dazu Kresbach p 231.
[441] Diesem Argument hing wohl auch der Gesetzgeber an, bis 1987 das sog Stoffschutzverbot aufgehoben wurde. Nun konnten unter anderem auch Arzneimittel als solche patentiert werden. Dennoch sind vom Gesetzgeber bestimmte medizinische Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (§ 2 Z 2 PatG). Diese sind aber mehr aus jenen Gründen ausgeschlossen, die eigentlich die einzigen Gründe für einen Patentierungsvorbehalt darstellen sollten, nämlich aus ethischen Gründen.
[442] Rafeiner in Enquete-Kommission, Band 2 p 287
[443] Leskien in Enquete-Kommission, Band 2 p 287
[444] Leskien in Enquete-Kommission, Band 2 p 287
[445] Teschemacher in Enquete-Kommission, Band 2 p 297
[446] Zu manchen Defiziten vgl auch Stelzer in JBl 1995 pp 761 ff.
[447] Vgl Krekeler pp 204 ff
[448] Vgl Leskien in Enquete-Kommission, Band 3 p 155
Häufig gestellte Fragen zu dieser Sprachevorschau zur Biotechnologie und Gentechnikregelung
Was ist Biotechnologie und Gentechnik gemäß dieser Sprachevorschau?
Biotechnologie umfasst den Einsatz wissenschaftlicher und technischer Prinzipien zur Herstellung und Bearbeitung von Stoffen durch lebende Organismen, um Güter und Dienstleistungen bereitzustellen. Gentechnik ist eine Teildisziplin der Biotechnologie, die sich mit der Identifizierung, Isolierung, Vermehrung und Nutzung genetischen Materials beschäftigt. Gentechnologie umfasst neben dem rein technischen Aspekt auch soziale, ethische und ökonomische Fragestellungen.
Welche Anwendungsbereiche der Gentechnik werden in der Vorschau genannt?
Die Sprachevorschau nennt folgende Anwendungsbereiche: Pharmazie, Landwirtschaft, Lebensmittelerzeugung, Umweltbiotechnologie, Medizin (Genanalyse und Gentherapie), Kriminalistik.
Welche grundlegenden Gesetze und Richtlinien zur Gentechnik werden besprochen?
Die Sprachevorschau behandelt schwerpunktmäßig das österreichische Gentechnikgesetz (GTG), die europäische Systemrichtlinie (S-RL) und Freisetzungsrichtlinie (FS-RL), sowie das deutsche Gentechnikgesetz (GenTG).
Was sind die Ziele des österreichischen Gentechnikgesetzes (GTG)?
Die Ziele des GTG sind: Schutz der Gesundheit des Menschen und seiner Nachkommenschaft, Schutz der Umwelt vor schädlichen Auswirkungen von GVO, Förderung der Anwendung der Gentechnik durch einen rechtlichen Rahmen für ihre Erforschung.
Welche Grundsätze sind im österreichischen GTG verankert?
Die Grundsätze des GTG sind: Vorsorgeprinzip, Zukunftsprinzip, Stufenprinzip, demokratisches Prinzip und ethisches Prinzip.
Was regelt das GTG in Bezug auf Arbeiten mit GVO in geschlossenen Systemen?
Das GTG regelt die Sicherheitsmaßnahmen, Pflichten des Betreibers gentechnischer Anlagen, Klassifizierungen der Arbeiten (Sicherheitsstufen, Typ A/B, kleiner/großer Maßstab), Anmelde- und Genehmigungsverfahren für gentechnische Arbeiten.
Was sind die wesentlichen Aspekte der Freisetzung von GVO gemäß dem GTG?
Die Freisetzung von GVO ist das absichtliche Ausbringen von GVO. Es gibt ein Genehmigungsverfahren, das das Stufenprinzip, Risikobeurteilung, Pflichten des Antragstellers und Sicherheitsaspekte berücksichtigt. Ein "Freisetzungsmoratorium" wurde verhängt, welches kritisch betrachtet wird.
Wie ist das Inverkehrbringen von Erzeugnissen geregelt, die aus oder mit GVO bestehen?
Das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die aus oder mit GVO bestehen, ist genehmigungspflichtig. Es gelten Regelungen zu Verpackung, Kennzeichnung und einem Genehmigungsverfahren, das die EU-Kommission einbezieht. Die Novel-Food-Regelung der EU ist relevant.
Welche Haftungsregelungen gelten im Bereich der Gentechnik?
Das GTG selbst enthält keine spezifischen Haftungsregelungen. Es kommen allgemeine Haftungsregeln (verschuldensabhängige Haftung, Produkthaftung, Gefährdungshaftung für Anlagen) zur Anwendung. Die Sprachevorschau kritisiert, dass ein integriertes Haftungsregime wünschenswert wäre. Im deutschen GenTG gibt es hier weiterführende Regelungen.
Wie ist die Patentierung von gentechnologischen Erfindungen geregelt?
Das Patentgesetz (PatG) regelt die Patentierung von gentechnologischen Erfindungen. Pflanzen, Tierarten und im Wesentlichen biologische Züchtungsverfahren sind grundsätzlich ausgenommen, Mikroorganismen, mikrobiologische Verfahren und deren Produkte aber patentierbar. Eine Sittenklausel (§ 2 Z 1 PatG) kann die Patentierung verhindern.
Welche Kritik wird am österreichischen GTG geübt?
Die Sprachevorschau übt Kritik an der mangelhaften Umsetzung von EU-Richtlinien, dem Nebeneinander von zuständigen Entscheidungsträgern, fehlenden Durchführungsverordnungen und dem Fehlen eines integrierten Haftungsregimes.
Details
- Titel
- Gentechnikrecht in Österreich
- Hochschule
- Wirtschaftsuniversität Wien
- Note
- Sehr Gut
- Autor
- Bernhard Poszvek (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1996
- Seiten
- 134
- Katalognummer
- V109508
- ISBN (eBook)
- 9783640076895
- Dateigröße
- 987 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Gentechnikrecht in Österreich unter besonderer Berücksichtigung von Freisetzung und Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen
- Schlagworte
- Gentechnikrecht
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Arbeit zitieren
- Bernhard Poszvek (Autor:in), 1996, Gentechnikrecht in Österreich, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/109508
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-