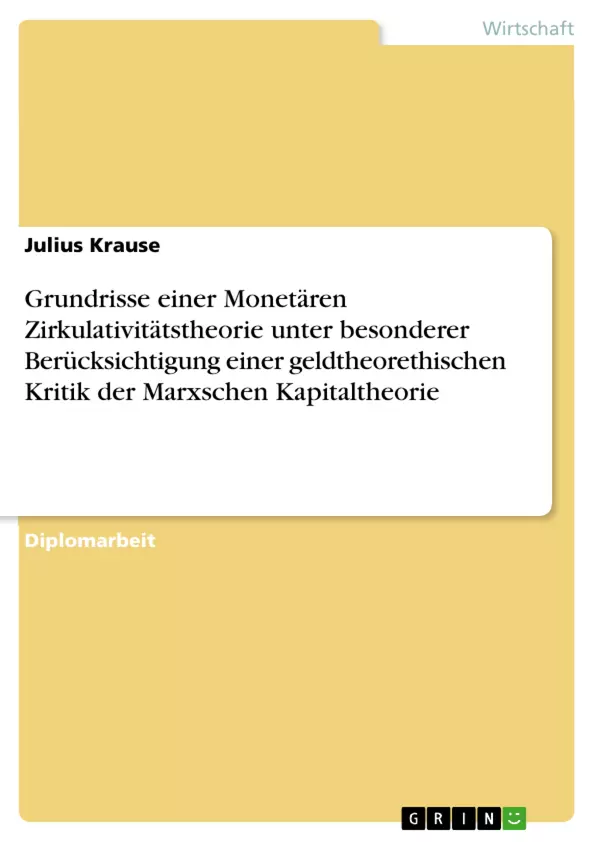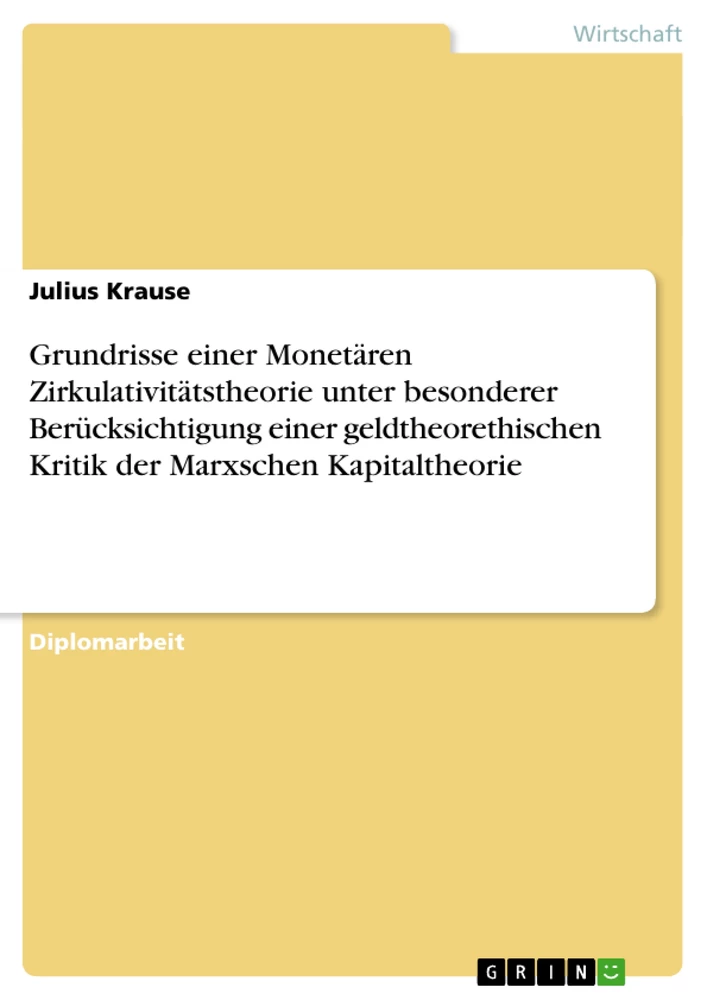
Grundrisse einer Monetären Zirkulativitätstheorie unter besonderer Berücksichtigung einer geldtheorethischen Kritik der Marxschen Kapitaltheorie
Diplomarbeit, 1993
102 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichniss
I. Einleitung
1. Zum Begriff
2. Zur Unterscheidung
2.1. Free Banking
2.2. Silvio Gesell als Ausgangspunkt einer monetären Zirkulativitätstheorie
2.2.1. Keynes über Gesell
2.2.2. Politisch-ökonomische Standortbestimmung
2.2.2.1. Abgrenzung von Weg und Ziel
2.2.2.2. Produktionsfaktordiskussion
3. Problemeingrenzung und Vorgehensweise
II. Zur Kritik des Geldsystems
1. Geld
2. Kontradiktorische Effekte der Wertaufbewahrungsfunktion
2.1. Von der Einschränkung der Quantitätstheorie
2.2. Zur Kritik des Say'schen Theorems
3. Komperative Neutralitätsanalyse
3.1. Prämonetäre Ökonomie
3.2. Geldwirtschaft
3.2.1. Allientabilität und Akzeptabilität
3.2.1.1. Sozialökonomische Differenzierung
3.2.1.2. Die Nutzung der Notwendigkeit
3.2.2. Strukturell asymmetrische Verwendungsprämierung
3.2.3. Der 'Preis' der Nicht-Neutralität
4. Liquiditätstheoretische Geld- und Zinsanlyse
4.1. Zins als Liquidisierungskosten
4.2. Remanente Liquidisierungskosten
4.3. Produktion der Liquidität
4.4. Der Geldzins als Fehlallokationsmechanismus
4.4.1. Monetäres Recycling
4.4.2. Der Preis als Knappheitsindikator von Gütern
4.4.3. Der Zins als Knappheitsindikator 'sofortiger Verfrügungsrechte' über Güter
5. Kapital, Krise und Ökologie
5.1. Monetäre Kapitaltheorie
5.1.1. Primärer und sekundärer Kapitalcharakter
5.1.2. Geldkapitalzins und Sachkapitalertrag
5.2. Monetäre Krisentheorie
5.2.1. Wachstumszwang
5.2.2. Der Krisenmechanismus
5.2.3. Ökologie: Wirtschaftlichkeit oder Rentabilität
III. Inkonsistenzkritik der Geldrelevanz in der Marx'schen Kapitaltheorie
1. Die Verwirklichungsbedingungen der Arbeit
1.1. Der Kapitalvorschuß und der 'Händewechsel'
1.2. Geldzins und 'industrieller Profit'
1.3. 'Fungierender Kapitalist' und 'funktionsloser Investor'
2. Der Doppelcharakter des Geldes
2.1. Geld als Äquivalentform der Ware
2.1.1. Wertmaß und Zahlungsmittel
2.1.2. Schatzbildung
2.2. Geld als Nicht-Äquivalent der Ware
2.2.1. Gesellschaftliche Macht in privater Hand
2.2.2. Asymmetrie von Kauf und Verkauf: James Mill
2.2.3. Egalisierung durch Abstraktion
2.2.4. Die Voraussetzung der Mehrwertaneignung
2.2.5. Der Wert des Geldes
2.2.6. Letztendlich: Die juristische Transaktion
IV. Postkapitalistische Geldpolitik
1. 'Carrying costs' für Geld: Freigeld
1.1. Das Konzept
1.2. Die Wirkung
2. Freigeld in der Praxis
2.1. Renovatio Monetarum: Freigeld 'by accident'
2.2. Die 'Wära-Tauschgesellschaft'
2.3. Das Nothilfeprogramm von Wörgl
V. Kritisches Resümee
Literaturverzeichnis
I. Einleitung
1. Zum Begriff
Der Titel dieser Arbeit ist entlehnt von Hugo Godschalk, der Proudhon und den sich auf diesen beziehenden Silvio Gesell, sowie den in seinen Schriften ebenfalls auf Proudhon zurückführbaren Heinrich Rittershausen, als Zirkulativitätstheoretiker bezeichnet.1
Diese Zirkulativitätstheoretiker versuchen "... Konstruktionsfehler der Geldordnung, wodurch Geld seine eigentliche Funktion als Tauschmittler nur unzureichend erfüllen kann ...",2 als die wesentlichen systematischen bzw. strukturellen Dysfunktionalitäten der als Kapitalismus bezeichneten Wirtschaftsordnung zu identifizieren und in ihren Folgen - in Form von Kreislaufstörungen ökonomischer Austausch- und Transaktionsprozesse - zu analysieren.
Da entsprechend auch der positive Aspekt dieser Zirkulativitätstheorie sein Hauptaugenmerk auf Veränderungen des bestehenden Geldsystems richtet, erscheint m.E., in Anbetracht einer vornehmlich monetären Orientierung, der Begriff 'Monetäre Zirkulativitätstheorie' angebracht.
2. Zur Unterscheidung
Wenn auch sowohl Rittershausen als auch Gesell von der Kernaussage der proudhon'schen Geldbetrachtung ausgehen, das Geld als der 'König des Marktes' habe nicht nur die Eigenschaft eines 'Schlüssels', sondern ebenso die Funktion eines 'Riegels' zum Markt,3 so sind doch die aus ihnen hervorgehenden Richtungen ökonomischer bzw. monetärer Analyse, und die darauf gründenden positiven Theorieansätze und geldpolitischen Konzepte grundsätzlich zu unter- scheiden.
2.1. Free Banking
Aus den Schriften von Rittershausen ging - kurz gesagt - die, beispiels- weise von George A. Selgin so benannte, 'Theory of free Banking' 4 hervor, die vor allem das Phänomen Arbeitslosigkeit, als ein wesentliches Symptom dysfunk- tionaler Allokations- und Distributionsprozesse im Kapitalismus, auf die staatlich monopolisierte Emission von Banknoten und deren Annahmezwang zurückführt.5
Das unter staatlichem Monopol emitierte 'Zwangsannahmegeld' sei seiner Aufgabe, Leistungsangebot und Leistungsbedarf zu vermitteln nicht gewachsen, das, sofern es "... nicht in das Wasser der Inflation springen will, ... in das Feuer der Deflation geworfen ..."6 werde:
Inflation bedinge aus Sicht der Produzenten und Realwertbesitzer Unattraktivität des Austauschs von Realwerten in Geldwerte. Der Anreiz sinkt Leistungspotentiale zur Leistungserstellung zu nutzen. Deflation schaffe für Geldwertbesitzer den Anreiz, den Austausch in Realwerte aufzuschieben, also Leistungspotentiale nicht 'abzurufen'. In beiden Fällen komme es so zu einer Unterversorgung mit 'geeigneten' Zahlungsmitteln.7
Diese Anfälligkeit für Disfunktionalitäten in seinen Vermittlungsdiensten wiese nur das monopolisiert emitierte 'Zwangsannahmegeld' auf. Daraus leitet sich die Forderung nach "... competetive supply of money ... einer wettbewerbli- chen Geldemission ..."8 unter einem einheitlichen Währungsstandard ab.9 Die Wirkung sei, daß solche unter Konkurrenz emitierten Banknoten aus der Volks- wirtschaft verdrängt werden, die (relativ) ungeeignet sind, Austauschprozesse zu ermöglichen. Und zwar durch die Konkurrenz solcher Emittenten, deren Geld dazu besser geeignet ist:10
'Inflationiert' ein Emittent seine Geld- bzw. Zahlungsmittelemission sinkt die Annahmebereitschaft bei Realwertbesitzern, Produzenten und Verkäufern. 'Verknappt' ein Emittent seine Zahlungsmittel um sie 'teuer' zu machen, so werden kreditbedürftige Produzenten zur 'billigeren' Emissionskonkurrenz wechseln. Das bewirke die Unmöglichkeit einer künstlichen Verknappung und Deflationierung, weil die Zurückhaltung von - oder die Unterversorgung der Marktteilnehmer mit - Zahlungsmitteln durch einen Emittent immer zur Substitution durch Konkurrenzemissionen führe.11
Konkurrierende Emission bedinge somit, daß allgemein Zahlungsmittel, die für Austauschprozesse unattraktiv sind, weil sie in ungeeigneter Weise emi- tiert werden, ihre Zahlungsmitteleigenschaft in dem Maße verlieren, in dem die Nachfrage nach ihnen zurückgeht, und dadurch sozusagen ihr Kurs gegenüber der Währung und relativ zu den 'geeigneten' Zahlungsmitteln, die die Markt- anteile der 'ungeeigneten' übernehmen, sinkt.12 Zugleich bleibe die Währung, die als Folge der Trennung vom Zahlungsmittel ausschließlich als Maßstab oder In- dex fungiert, in dem sich die Preise von Realwerten ausdrücken, stabil.13 Zusammengenommen könne es dann keinen durch das Geldsystem induzierten Zustand mehr geben, in dem durch eine Unterversorgung mit 'geeigneten' Zah- lungsmitteln, Leistungspotentiale ungenutzt blieben, solange noch ungedeckter Bedarf besteht.14
Da der wesentliche Zweck der Darstellung dieses 'anderen' zirkulativitätstheoretischen Ansatzes darin besteht, ihn von der auf Gesell zurückgehenden Richtung unterscheiden und abgrenzen zu können, nicht aber um sie zum Schwerpunkt dieser Arbeit zu machen, soll im Rahmen dieser Arbeit die 'THEORY OF FREE BANKING' nicht weiter vertieft werden:
Die Basis der im Rahmen dieser Arbeit versuchten Darstellung der 'Grundrisse einer monetären Zirkulativitätstheorie' soll vielmehr die auf Gesell fußende - von Gerhard Senft so betitelte15 - 'libertär-sozialistische Variante des Freiwirtschaftsmodells' sein, die im Gegensatz zur 'Theory Of Free Banking', weniger das staatliche Emissionsmonopol und den Annahmezwang thematisiert - es im Gegenteil als nützlich betrachtet -, sondern vornehmlich die Geldeigen- schaften und das Emissionskonzept, sowie als einen zweiten Aspekt auch Kon- struktionsfehler der Bodenordnung kritisiert,16 der jedoch, obgleich Gesell beide Aspekte in ihrer bestehenden Form als systematische Stützen eines kapitalistischen Wirtschaftssystems betrachtete, gleich der 'Theory Of Free Banking', nicht weiter behandelt wird.
2.2. Silvio Gesell als Ausgangspunkt einer monetären Zirkulativitätstheorie
2.2.1. Keynes über Gesell
Da bereits eine Vielzahl einleitender Schriften zur Person Gesells und seiner geld- und zinstheoretischen Kritik, sowie seinen daraus resultierenden Politikvorschlägen existiert, soll an dieser Stelle keine weitere hinzugefügt, sondern in Form eines längeren Zitats auf einen Beitrag von John Maynard Keynes zurückgegriffen werden:
"Gesell war ein erfolgreicher deutscher Kaufmann in Buenos Aires, der durch die Krise der späten achziger Jahre ... zur Erforschung der geldlichen Probleme geführt wurde. Sein erstes Buch, Die Reformation im Münzwesen als Brücke zum sozialen Staat, wurde 1891 in Buenos Aires veröffentlicht. Seine grundlegenden Anschauungen über das Geld wurden im gleichen Jahr in Buenos Aires unter dem Titel Nervus Rerum veröffenlicht ... Der erste Teil seines Standardwerkes wurde 1906 in Les Hautes Geneveys in der Schweiz unter dem Titel Die Verwirklichung des Rechts auf den vollen Arbeitsertrag veröffentlicht und der zweite Teil 1911 in Berlin unter dem Titel Die neue Lehre vom Zins. Beide Teile zusammen wurden in der Schweiz während des Krieges (1916) veröffentlicht und er- reichten eine sechste Auflage während seines Lebens unter dem Titel Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. Die englische Ausgabe erschien unter dem Titel The Natural Economic Order. Im April 1919 trat Gesell dem kurzle- bigen Sowjet-Kabinett Bayerns als dessen Finanzminister bei und wurde danach vor ein Kriegsgericht gestellt ... Gesells besonderer Beitrag zur Theorie des Geldes und der Zinsen ist wie folgt. Erstens unterscheidet er deutlich zwischen dem Zinsfuß und der Grenzleis- tungsfähigkeit des Kapitals, und er legt dar, daß es der Zinsfuß ist, welcher der Wachstumsrate des Realkapitals eine Grenze setzt. Dann hebt er hervor, daß der Zinsfuß eine rein geldliche Erscheinung ist, und daß die Eigentümlichkeit des Geldes, von der die Bedeutung des Geldzinsfußes herrührt, in der Tatsache liegt, daß ihr Besitz als Mittel, Reichtum aufzuspeichern, dem Besitzer unbedeutende Durchhaltekosten verursacht, und daß die Formen von Reichtum, wie Vorräte von Waren, die Durchhaltekosten bedingen, tatsächlich wegen des vom Geld gesetzten Standarts einen Ertrag abwerfen. Er führt die verhätnismäßige Beständigkeit des Zinsfußes durch alle Zeitalter als Beweis an, daß er nicht von rein stofflichen Kennzeichen abhängen kann, da die Schwankungen des letzteren von einem Zeitab- schnitt zum anderen unberechenbar größer als die beobachteten Änderungen im Zinsfuß gewesen sein müssen; daß heißt ... der Zinsfuß ... ist beständig geblieben, während die stark schwankenden Kennzeichen, die tatsächlich die Tabelle der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals bestimmen, nicht den Zinsfuß bestimmt haben, sondern die Rate, zu welcher der (mehr oder weniger) gegebene Zinsfuß dem Bestand an Realkapital zu wachsen erlaubt
Er [Gesell] legt dar, daß die Vermehrung von Realkapital durch den Geldzinsfuß aufgehalten wird, und daß, wenn dieses Hemmnis beseitigt würde, die Vermehrung von Realkapital ... so rasch sein würde, daß ein Nullgeldzinsfuß ... innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Zeit gerechtfertigt sei würde. Die Hauptnotwendigkeit ist somit eine Senkung des Zinsfußes, ... dadurch ..., daß man veranlaßt, daß das Geld Durchhaltekosten bedingt
... Das führt ihn zu dem berühmten Vorschlag von 'gestempeltem' Geld, mit dem sein Name hauptsächlich in Zusammenhang gebracht wird, und der die Zustimmung von Professor Irving Fisher erhalten hat. Nach diesem Vorschlag würden Banknoten ... ihren Wert nur bewahren, wenn sie jeden Monat ... gestempelt wurden. Der Preis [des Stempelns] ... sollte ... ungefähr gleich dem Überschuß des Geldzinzsfußes ... über diejenige Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals sein, die einer Rate der Neuinvestitionen, die mit Vollbeschäftigung vereinbar ist Der hinter dem gestempelten Geld liegende Gedanke ist gesund."17
2.2.2. Politisch-ökonomische Standortbestimmung
2.2.2.1. Abgrenzung von Weg und Ziel
Neben dem geld- und zinstheoretischen Ansatz Gesells ist seine politisch-ökonomische Ausrichtung und der einer darauf basierenden monetären Zirkulativitätstheorie ebenfalls in den Ausführungen Keynes' erkennbar, der Gesells Engagement als 'Volksbeauftragter für das Finanzwesen' in der ersten, von Kurt Eisner dominierten, Regierung der bayrischen Räterepublik erwähnt18 - in die er auf Vorschlag von Ernst Niekisch, Gustav Landauer und Erich Mühsam aufgenommen wurde -19 und ihm eine sozialistische Orientierung zuschreibt, dabei aber die Abgrenzung Gesells zu Marx hervorhebt:
"Der Zweck ... kann als die Aufstellung eines anti-marxistischen Sozialismus beschrieben werden, eine Reaktion gegen das laissez-faire, auf theoretischen Grund- lagen aufgebaut, die von jenen von Marx grundverschieden sind, indem sie sich auf eine Verwerfung, statt auf eine Annahme der klassischen Hypothesen stützen, und auf eine Entfesselung des Wettbewerbs, statt auf seine Abschaffung. Ich glaube, daß die Zukunft mehr vom Geiste Gesells als von jenem von Marx lernen wird."20
Darüber hinaus können auch Gesells Zielvorstellungen grob mit Keynes' Worten beschrieben werden, nämlich "... den sanften Tod des Rentners ... und folglich den sanften Tod der sich steigernden Unterdrückungsmacht des Kapitalisten, den Knappheitswert des Kapitals auszubeuten",21 herbeizuführen, was Gesell selbst als die "... Beseitigung des arbeitslosen Einkommens, des sogenannten Mehrwerts, auch Zins und Rente genannt, ... das unmittelbare Ziel aller sozialistischen Bestrebungen ..."22 beschreibt.
Die von Keynes vermutete Abgrenzung zu Karl Marx deutet sich durch Gesells Hinweis an, er sei zur Erreichung seiner Ziele "... auf die gleichen Wege geraten, die Proudhon wandelte ...":23
Nach Gesell schlage "Marx’ Untersuchung des Kapitals ... von Anfang an den falschen Weg ein". Denn der betrachte, "wie der erste Bauer es macht ... das Kapital als ein Sachgut" und sehe "... im Mehrwert einen Raub, die Frucht des Mißbrauches einer Macht, die der Besitz gibt".24 Deshalb müsse Marx annehmen, daß "... mit jeder Vermehrung dieser Sachgüter das Kapital entsprechend gestärkt"25 werde, weshalb "Marx' Ausweg ... die durch Organisation zu schaffende politische Übermacht der Besitzlosen"26 sei.
Im Gegensatz dazu sei Proudhons Weg "... die Beseitigung des Hinder- nisses, das uns von der vollen Entfaltung unser Produktionskraft abhält".27 Ein 'Geld ohne Mehrwert'28 führe zur 'Befreiung der Marktwirtschaft vom Kapitalis- mus',29 indem, noch einmal mit Keynes' Worten, davon ausgehend, daß nur des- halb "... Besitzer von Kapital ... Zinsen erhalten, ... weil das Kapital knapp ist ... wir auf eine Vermehrung der Menge des Kapitals zielen, bis es aufhört knapp zu sein, so daß der funktionslose Investor nicht länger einen Bonus erhalten wird ..."30 und - so Gesell - "... das Kapital bald in einer Kapital-Überproduktion (nicht mit Warenüberproduktion zu verwechseln) ersticken würde",31 "... die Produktionsmittel ihre Kapitaleigenschaft einbüßen", und somit die 'Arbeiter' - das ist nach Gesell "... jeder der vom Erfolg seiner Arbeit lebt - ... das Recht auf den vollen, gemeinsamen Arbeitsertrag ..."32 verwirklichen.
2.2.2.2. Die Produktionsfaktordiskussion
Die oben beschriebene - besonders durch die Einschätzung von Keynes, sowie Gesells eigene Bezugnahme auf Proudhon, gestützte - politischökonomische Ausrichtung Gesells wird noch durch den Standpunkt betont, den die zirkulativitätstheoretische Literatur in der 'Produktionsfaktordiskusssion einnimmt, was nachfolgend in teilweise leicht humoristischer Form, in Anlehnung an Otto Valentin, dargestellt sei:
"Im Gegensatz zu den Naturvorgängen wickelt sich der Wirtschaftsprozeß nicht selbsttätig ab, sondern erfordert ein Tun, ein Handeln des Menschen. Diese Wirtschaftstätigkeit ... benützt ... Dinge der Außenwelt, die Gegenstand des Wirtschaftens und daher Objekte der Wirtschaft sind Da das Wirtschaften eine Tätigkeit ist, da ferner eine andere Tätigkeit als die Produktions- und Verbrauchs- tätigkeit im Bereiche der Wirtschaft weder erkennbar noch denkbar ist, und nur der Mensch diese Tätigkeit ausübt, kann nur der Mensch als Subjekt der Wirtschaft anerkannt werden."33
Im "schraffen Widerspruch" dazu stehe die, Arbeit, Boden und Kapital gleichsetzende Lehre von den drei Produktionsfaktoren, dernach "... nicht ein Subjekt, sondern drei Subjekte der Wirtschaft, Produktionsfaktoren genannt," existieren, unter denen proportional zu ihrem Leistungsbeitrag "... der große Kuchen des Sozialprodukts ..." verteilt werde. Dabei sei es der Leistungsbeitrag der neben Arbeit existierenden Produktionsfaktoren, Produktionsmöglichkeit und Erfolg wesentlich zu beeinflußen, was, wie gesagt in leicht humoristischer Form, widerlegt werden soll:
"Was das Kapital betrifft, so hat man aus der Tatsache, daß ein und diesel- be Tätigkeit je nach den Umständen, unter denen sie sich vollzieht und je nach den Hilfsmitteln, deren sie sich bedient, einen sehr verschiedenen Erfolg zeitigt, auf kei- nem Gebiet menschlicher Tätigkeit jemals den Schluß gezogen, daß jene Umstände oder Hilfsmittel eigene Leistungen verrichten. Auf gebahntem Wege kommt man rascher vorwärts, als über Stock und Stein. Was würde man dazu sagen, wenn je- mand aufgrund dieser Tatsache erklären wollte, man müsse zwischen der Gehleis- tung des Menschen und ... des Weges unterscheiden: der Mensch geht und der Weg geht, beide gemeinsam legen in der gleichen Zeit eine größere Strecke zurück als der Mensch allein Niemand bestreitet, daß es ... Gehleistungen des Weges ... nicht gibt. Nur beim Produzieren will man das ... nicht gelten lassen, sondern spricht den toten Produktionsmitteln Boden und Kapital Produktionsleistungen zu."34
Der Grund dafür sei der Versuch einer "... sozialethischen Rechtfertigung des Zinses ...",35 durch diese Lehre der drei Produktionsfaktoren, die, weil nur ein Produktionsfaktor Leistungen verrichte, Kapital als Produktionsfaktor konstruiere, um die Zahlung von Kapitalzins als eine Gegenleistung zu begründen:36 Dadurch trete "... die Nationalökonomie ..., solange sie sich zu dieser Irrlehre bekennt, als Hüterin persönlicher Interessen auf. Das ist der schwerste Vorwurf, den man einer Wissenschaft machen kann".37
Die tiefergehende Analyse sowohl der ökonomischen Wurzeln als auch der gesellschaftsphilosophischen Fundierung, beispielsweise in den Schriften Landauers,38 Mühsams39 und auch des 'individual-anarchistischen Egoismustheoretikers' Max Stirner,40 ginge über den Rahmen dieser Arbeit hinaus. Zudem erfüllen m.E. die obigen Darstellungen zu genüge den Zweck, die politisch-öko- nomische Perspektive zu verdeutlichen, aus der die Richtung der hier darzustellenden monetären Kritik und Politik hervorgeht.
3. Problembeschreibung und Vorgehensweise
Julius Krause - Grundrisse einer monetären Zirkulativitätstheorie - Seite 12
Dem aus den Titel dieser Arbeit resultierenden Anspruch, die Grundrisse einer monetären Zirkulativitätstheorie darzustellen, soll dadurch entsprochen werden, daß die von Gesell ausgelöste Diskussion in der zirkulativitäts- theoretischen Literatur in einer Form erörtert wird, die versucht den 'roten Faden' der in der relevanten Literatur oftmals divergierenden Aussagen41 zu betonen, um dadurch in ihren Grundlagen die Kritik einer monetären Zirkulativitätstheorie an einem als 'kapitalistisch' bezeichneten Wirtschaftssystem einheitlich zu profilieren.
Die oben angeführte Kritik an der sozialethischen Rechtfertigung des Zinses bedingt für diese 'Profilierung' einen weitgehenden Verzicht auf solche, in der zirkulativitätstheoretischen Diskussion verbreiteten, 'wissenschaftlichen Krücken', die gleichfalls ihre geld- und zinstheoretische Kritik sozialethisch, beispielsweise mit einem 'Grundsatz der wirtschaftlichen Gerechtigkeit',42 begründen.
Der Kern des analytischen Aspekts - und daher auch ein wesentliches Ziel dieser Arbeit - besteht darin, das bestehende Geldsystem als die, die 'kapitalistische' Wirtschaftsordnung konstituierende Institution zu identifizieren, und darüber hinaus deren allokative Dysfunktionalität zu beweisen - was notwendig einen Maßstab der Funktionalität, nicht zuletzt auch für eine aus der Dysfunktionalität abgeleiteten monetäre Politik erfordert:
Dieser Maßstab resultiert aus einer, in der zirkulativitätstheoretischen Literatur gebräuchlichen, modelltheoretischen Unterscheidung zwischen einer analytisch - nicht historisch - 'prämonetären' und einer monetisierten Ökonomie: Der Nutzen wirtschaftlicher Aktivitäten messe sich durch ihren Beitrag zur Bedürfnisbefriedigung. Dabei ist Geld dann funktional, wenn es aus der Sicht eines analytisch prämonetären Leistungsaustausches, als Mittel der Vermittlung des Leistungsaustausches dem Zweck dient, durch die Reduktion von Informa- tions- und Transaktionskosten, Produktions- und Konsumptionsziele in realen - d.h. nicht monetären - Kategorien zu erweitern oder mit geringerem Aufwand zu erreichen.43 Damit wird im Grunde das zum Maßstab der Funktionalität, zum an- gestrebten Soll-Zustand, was als Ist-Zustandsvermutung der Klassik-Neoklassik von der Zirkulativitätstheorie kritisch entschleiert wird: Geld als Schleier über dem realwirtschaftlichen Prozeß von Konsum, Produktion und Transaktion, dem es als 'Schmiermittel' dient, den es aber nicht strukturell verändert.
Die Darstellung des analytischen Aspekts erfolgt, in Teil II , zunächst durch eine eng an Gesell angelehnte geldtheoretische Herleitung des Zinses und und einer daraus abgeleiteten Kritik der Quantitätstheorie und des Say’schen Theorems, als die scheinbaren Säulen des geldtheoretischen 'Schleiers' der Klassik-Neoklassik.
Darauf hin wird versucht die 'Entschleierung' durch eine 'komperative Neutralitätsanalyse' zu stützen, die darauf abzielt die Nicht-Neutralität des Gel- des herauszuarbeiten, um dann über eine liquiditätstheoretisch fundierte Zins- erklärung den Zins als Fehlallokationsmechanismus zu beschreiben, und darüber hinaus, ergänzt um den kapitaltheoretischen Aspekt der monetären Zirkula- tivitätstheorie, den im nicht-neutralen Geld bzw. Geldsystem angelegten Krisen- mechanismus zu thematisieren.
Anknüpfend an den alten Streit zwischen dem 'Elend der Philosophie' und der 'Philosophie des Elends' wird im folgenden Teil III eine Kritik an der Behandlung und Gewichtung geldtheoretischer Aspekte bei Marx vorgenommen, die den in der zirkulativitätstheoretischen Literatur verbreiteten Vorwurf insbeson- dere geldtheoretischer Inkonsistenz untermauern soll. Die perspektivische Dar- stellung bedingt jedoch, daß Marx zwar zitiert wird, aber nicht zu Wort kommt. Denn die primäre Aufgabenstellung hierbei wird sein, ebenfalls im Sinne einer Profilierung, die verschiedenen Kritikansätze in der zirkulativitätstheoretischen Literatur zu systematisieren. Vernachlässigt wird dabei eine tiefergehende Kritik der Marxschen 'Goldgeldtheorie' und seiner Werttheorie.
Unberücksichtigt bleibt ebenfalls eine explizite, gesonderte Auseinandersetzung mit den anderen ökonomischen Schulen z.B. dem Keynesianismus; der teilweise jedoch als 'Formulierungshilfe' herhalten muß. Eine kritische Betrachtung der Klassik-Neoklassik, als der zur Zeit 'herrschenden Lehre' erfolgt dagegen durchgehend, teilweise auch explizit, über die Profilierung der monetären Zirkulativitätstheorie, die in wesentlichen Punkten, etwa dem Gegenwartspräferenzansatz, der allokativen Funktion des Zinses und der Neutralität des Geldes, klassisch-neoklassische Aussagen verwirft.
Ausgehend vom analytischen Aspekt der monetären Zirkulativitäts- theorie wird, in Teil IV, die Konzeption einer aus der Kritik abgeleiteten 'postkapitalistischen' Geldordnug besprochen, sowie einige Ansätze ihrer Realisierung in der Praxis.
War bisher die Darstellungsmethode dadurch gekennzeichnet, den Stand der zirkulativitätstheoretischen Diskussion wiederzugeben und dabei im Sinne einer 'Profilierung' weniger die Divergenzen als vielmehr die grund- legenden Übereinstimmungen zu betonen, sowie z.T. daraus folgend, all das auf eine Weise zu bewerkstelligen, die überwiegend der Argumentationsperspektive der zirkulativitätstheoretischen Diskussion folgt, so kommt es, davon abwei- chend, zum Schluß, in Teil V, zu einem 'kritischen Résumé', das es erlaubt 'offene Fragen' nicht getrennt in jedem Teilbereich, sondern im Zusammenhang diskutieren zu können. Dabei werden auch einige implizite Prämissen einer in Teilbereichen neoklassischen Denk- bzw. Argumentationsweise der monetären Zirkulativitätstheorie bezüglich nicht- monetärer Kategorien, kritisch thematisiert.
II. Zur Kritik des Geldsystems
Die bisherige, gemessen an der Vorgabe, Mittel zum Zweck einer bedarfsgerechten Distribution von 'Gebrauchswerten' zu sein, 'suboptimale' Funktionsweise der marktwirtschaftlich koordinierten, arbeitsteiligen Aktivitäten der Wirtschaftssubjekte, die in Form von Umweltverschmutzung, Arbeitslosigkeit und Verschuldung, eine zu dieser Vorgabe diametral entgegengesezte Wirkung erzielt, sieht die Zirkulativitätstheorie weder in der marktwirtschaftlich koordinier- ten Allokation knapper Ressourcen, noch in den arbeitsteiligen Aktivitäten selbst begründet, sondern in dem, zur Koordination der wirtschaftlichen Aktivitäten zwar notwendigen, in seiner bisherigen Form aber durch strukturelle Dysfunktionali- täten gekennzeichnetem Geld bzw. Geldsystem, dessen Wirkung über die Zirku- lationssphäre auf Produktion und Konsumption einwirke.44
1. Geld
Das derzeitige Geld stelle eine unter staatlichem Monopol emitierte monetäre Anwartschaft auf das Sozialprodukt dar, die, von "... sämtlichen Personen, Sach- und Zeitvariablen" abstrahierend, versehen nur mit dem durch den Währungsnamen bezeichneten zu verrechnenden Geldbetrag, als "... verkehrsgünstiges Verrechnungsmittel"45 fungiere.
Dabei sei ausschließlich solches von der Zentral- bzw. Notenbank emi- tiertes Geld relevant. Sichteinlagen seien eine Form der 'Aufgabe von Liquidität', also, wenn auch sehr kurzfristig rückforderbare, Geldforderungen bzw. Ansprü- che auf Geld, deren buchungstechnische Übertragung auf andere Konten einer Anspruchsübertragung gleichkäme. Geld sei Anspruch auf Teile des Sozial- produkts, Geldforderungen Ansprüche gegenüber Wirtschaftssubjekten auf die Hergabe von Ansprüchen auf solche Teile des Sozialprodukts. Solche Geld- forderungen seien deshalb nur alternativ, nicht additiv nachfragewirksam. Buch- geld sei letztendlich nur eine buchungstechnische Dokumentation der Umlaufge- schwindigkeit einer bestimmten Geldbasis in einer bestimmten Zeit. Buchgeld sei immer nur relative Liquidität, bezogen auf Geld als die absolute Liquidität.46
Dieses Geld erscheine in seinen verschiedenen ihm zugedachten Aufgaben multifunktional, als Zahlungs- und Tilgungsmittel bzw. Tauschmedium oder 'Zirkulationsmittel', als Recheneinheit bzw. Währung und als Mittel zur Wertaufbewahrung bzw. zur Speicherung von Kaufkraft:
"Die funktionalistische Geldauffassung nennt die Tauschmittel- und Zahlungsmittelfunktion, die Funktion als Recheneinheit oder Wertmesser sowie die Wertaufbewahrungsfunktion ..."47
2. Kontradiktorische Effekte der Wertaufbewahrungsfunktion
Aus zirkulativitätstheoretischer Sicht ist diese Dreieinigkeit der Geldfunktionen widersprüchlich, insbesondere aufgrund der derzeitigen Form der Wertaufbewahrungsfunktion werde das Geld als Mittel der Zirkulation zugleich ein Mittel zur Unterbrechung derselben:48
Entgegen der klassisch-neoklassischen Annahme, Geldhaltung sei über ein reines Transaktionsmotiv hinaus, aufgrund der durch die Zinserträge von An- lagealternativen entstehenden Oppurtunitätskosten eine irrationale Ausnahmeer- scheinung, erhalte die Wertaufbewahrungsfunktion dadurch nicht nur konsekuti- ven,49 sondern im derzeitigen Geldsystem faktisch konstitutiven Charakter. Denn der Zins werde gerade dadurch erzwungen, daß der Geldbesitzer als Entschei- der über die Verwendung des Geldes, die Option zur Geldhaltung wahrnehmen könne.50 Durch den Zins kaufe der Geldnehmer, als Anbieter einer Anlagealter- native, dem Geldgeber sozusagen die Option zur Geldhaltung ab. Insofern werde die Fähigkeit bzw. Unfähigkeit des Geldes, insbesondere seine Funktion als Tauschmedium und Zahlungsmittel im realwirtschaftlichen Leistungsaustausch zu entfalten, wesentlich von der Wertaufbewahrungsfunktion bestimmt.51
Die Option zur Geldhaltung und die Notwendigkeit, diese dem Geld- geber abzukaufen, resultiere aus der Eigenschaft des Geldes auf der einen Seite ohne 'Durchhaltekosten' vom Markt zurückgehalten werden zu können, während auf der anderen Seite dieses Geld für den Austausch von Waren notwendig ist, "...die ihrem Erzeuger nur als Tauschmittel von Nutzen sind ..." und bei Zurück- haltung ihren Besitzern Durchhaltekosten aufbürden, so daß für "... den weitaus größten Teil der Arbeitsprodukte ... der Verkaufszwang bedingungslos" 52 sei:
"Widersteht er [der Besitzer der Arbeitsprodukte] diesem Zwange, so wird er bestraft, und die Strafe vollstreckt sein Eigentum, die Ware Dabei ist zu bedenken, daß unausgesetzt neue Waren auf den Markt kommen, ... daß der Besitzlose durch den unmittelbaren Hunger gezwungen ist, täglich zu arbeiten."53
Da aber die marktliche Koordination einer arbeitsteiligen Produktion "... den Absatz, den gegenseitigen Austausch der Arbeitserzeugnisse,"54 durch die Vermittlung des Geldes bedinge, sei die "... Nachfrage nach Waren ... auß- schließlich durch das Geld vertreten".55 Deshalb bestehe seitens der Produ- zenten, in Folge des Angebotszwangs ihrer Ware, eine Zwangsnachfrage nach Geld:
"Die Ware muß also gegen Geld verkauft werden, d.h., es besteht einen Zwangsnachfrage nach Geld, die genau ebenso groß ist, wie der Vorrat an Waren, und der Gebrauch des Geldes ist darum für alle genau ebenso unentbehrlich, wie die Arbeitsteilung für alle vorteilhaft ist. Je vorteilhafter die Arbeitsteilung, umso unent- behrlicher das Geld".56
Somit sei das Angebot von Waren (inkl. der Arbeitskraft), also die Nachfrage nach Geld, faktisch eine "... willenlose Handlung ... [:] ... Ohne Ware kann man die Handlung, die im Angebot liegt, nicht vollführen, und mit Waren muß man sie vollführen."57
Demgegenüber ist das Angebot von Geld, also die Nachfrage nach Waren, bzw. die Nachfrage nach Alternativen der Geldhaltung, d.h. die Über- lassung geldvermittelter 'Nachfragekompetenz' an Wirtschaftssubjekte mit bspw. aufgrund geplanter Investitionen bestehendem Bedarf an Waren und Gütern, "... von solchem Zwange befreit",58 da hierbei "... der Wille des Geldbesitzers zur Geltung"59 komme, der "... dank der Beschaffenheit des herkömmlichen Geldes, die Nachfrage [also das Angebot des Geldes] von einem Tage, von einer Woche, ja sogar von einem Jahre zum anderen verschieben kann, ohne unmittelbare Verluste zu erleiden".60
"Weil dieses Verhältnis den Warenbesitzer in Abhängigkeit vom Geldbesitzer bringt ...",61 verursache dieser Unterschied - einerseits "... der Ware anhaftender Zwang beim Angebot; Freiheit ... von der Zeit bei der Nachfrage" andererseits - den Zins, den der Geldgeber aufgrund dem geldbedingten "... Vorrecht, vom Markte fernbleiben zu können" vom Geldnehmer, der "... diese Freiheit bezahlen ..." müsse, zu verlangen imstande sei:
"Ohne diesen Tribut wird kein Geld angeboten." Indem somit nur der Zins zum Geld führe, das für den Warenaustausch notwendig - und damit auch für die Produktion und Konsumtion bestimmend - sei, werde "... der Zins die allgemeine Voraussetzung des Warenaustausches. Ohne diese Abgabe kein Tausch."62
2.1. Von der Einschränkung der Quantitätstheorie
Sofern der Zins darin begründet liege, daß im Gegensatz zum Ange- botszwang der Produzenten bzw. deren Produkte, und der dadurch bedingten Zwangsnachfrage nach Geld, der Geldgeber nicht unter solchem Angebots- zwang steht, impliziere dies unter den Bedingungen des derzeitigen Geldsys- tems, eine zumindest nur eingeschränkte Gültigkeit der Quantitätstheorie.63
Denn als Folge der Zurückhaltbarkeit des Geldes werde fraglich, ob "... wir das Angebot von Geld derart mit dem Geldbestand für eins erklären"64 kön- nen, daß "... dieses Geldangebot nun auch so ununterbrochen, wie der Geld- bestand eine feste (kontrollierbare) Größe ist" - was sich an der Preisniveaustabi- lität messen ließe -65 und somit "... die verkörperte, scharfgeschnittene Gestalt der Nachfrage" sei, "... wie die Ware das verkörperte, wägbare, berechenbare Angebot ist".66
Da hierbei aber neben "... der Größe des Geldbestandes" auch die "... Schnelligkeit des Geldumlaufes"67 zu berücksichtigen sei, erweise sich, aufgrund der Option zur Geldhaltung, das nachfragende Geldangebot nicht als vom jewieligen Emitenten, z.B. der Zentralbank, kontrollierbar, auch wenn "... der Geldvorrat ... für das Geldangebot nicht gleichgültig"68 sei, sondern als bedingt durch die Ziele der 'Kassenhalter', die den Multiplikator bestimmen, und somit mangels Sicherheit über den tatsächlichen Umlauf der in Verkehr gebrachten Geldmenge, als nur eingeschränkt steuer- und berechenbar:69
"Während der Geldvorrat oft unverändert bleibt, ist das Geldangebot den größten Schwankungen unterworfen".70
Zudem sei durch die Abhängigkeit der Umlaufgeschwindigkeit von den Geldhaltern, "... beim Gelde eine untere Grenze überhaupt nicht zu erkennen, es sei denn, daß man Null als diese untere Grenze ansehen will".71 Statt der "... Primitivgleichung der Quantitätstheorie: alles Geld kauft alle Ware",72 werde so auch der Extremfall, alles Geld kauft keine Ware, möglich, so daß zusammengenommen der Mangel der klassisch-neoklassischen Quantitätstheorie in der Konstantsetzung der am wenigsten konstanten Bedingung, der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, gesehen werden kann:
"Die Quantitätstheorie, die für alle Waren ohne wesentliche Einschränkung als richtig anerkannt wird, hat man auch auf das Geld übertragen und gesagt, daß der Preis des Geldes vom Geldvorrat bestimmt wird; doch hat die Erfahrung gezeigt, daß das Geldangebot vom Geldvorrat nicht so beherrscht wird, wie für solche Quanti- tätstheorie vorausgesetzt wird Wenn aber ... das Geldangebot nicht regelmäßig und ausnahmslos dem Geldvorrat entspricht, so ist auch der Preis des Geldes vom Geldvorrat unabhängig, und die Übertragung der rohen Quantitätstheorie auf das Geld nicht statthaft."73
2.2. Zur Kritik des Sayschen Theorems
In Folge der Kritik der Quantitätstheorie, insbesondere der Annahme konstanten Geldumlaufs, anhand der Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes, aus der resultiere, daß ein Geldbesitzer nicht gezwungen sei Geldeinkommen vollständig - selbst oder durch den Ankauf von Anlagesurrogaten - einer 'wirksamen Nachfrage' zukommen zu lassen, treffe auch "... der Kern der klassischen Makroökonomie - das Saysche Theorem -",74 demnach sich jedes Angebot an Waren seine Nachfrage schaffe, nicht zu.
Denn die diesem Theorem zugrundeliegende Annahme, "... Produktion schaffe Einkommen, und Einkommen schaffe Nachfrage", die wiederum den Absatz der Produktion bedinge, so "... daß sich der Kauf/Verkauf-Prozeß eigentlich als Tausch von Ware gegen Ware vollziehe",75 sei aufgrund der Option zur Geldhaltung, nicht gegeben, da hiermit eine mögliche Nachfragevorenthaltung einhergehe, die bewirke, daß nicht jedes Einkommen zur Nachfrage werde und somit auch nicht jede Produktion absetzbar sei:
"...weniger Geld, als man besitzt, wird man schon anbieten können",76 so daß nicht mit jedem Verkauf ein Kauf einhergehen müsse und folglich von einer Dichotomie zwischen monetärer und realer Sphäre, dernach "... das bloße Einführen einer besonderen Art, Güter gegeneinander Auszutauschen, dadurch daß erst ein Gut gegen Geld und dann das Geld gegen etwas anderes getauscht wird, keinen Unterschied in dem Wesen der Vorgänge macht",77 keine Rede sein könne.78
Vor dem Hintergrund dieser 'Entschleierung' aber sei letztendlich die Annahme, insbesondere der Klassisch-Neoklassischen Geldlehre, von der "Neutralität" des Geldes nicht mehr haltbar, dernach, abgesehen von einer effizienteren Gestaltung, Geld nur einen "Schleier" über die Vorgänge auf dem Gütermarkt lege, ansonsten aber keinen strukturverändernden "... Einfluß auf das reale Geschehen in der Volkswirtschaft nimmt".79
3. Komperative Neutralitätsanalyse
Die Nicht-Neutralität des Geldes zeige sich deutlich durch eine zunächst isolierte Betrachtung des 'realen Geschehens', verbunden mit einem analytischen - nicht historischen - Vergleich der Austauschprozesse von 'Naturalleistungen' zwischen Wirtschaftssubjekten unter den Bedingungen einer hypothetischen Selbstversorgungs-, Tausch- und Geldwirtschaft:
"Ein Vergleich zwischen einer Naturalwirtschaft und einer Geldwirtschaft ergibt wichtige Aufschlüsse über den Nutzen des Geldes und über die Einflüsse des Geldes auf den Tauschprozeß ..."80
3.1. Prämonetäre Ökonomie
Die Selbstversorgungswirtschaft bedinge zunächst starke Einschränkun- gen in der Versorgung mit 'Bedarfsgütern'. Wesentlich sei vor allem, daß man- gels Arbeitsteilung nur konsumiert werden könne, was selbst produziert wurde:81 Damit aber erschweren sich 'transtemporale' Austauschvorgänge, d.h. Ersparnis- bildung, weil erwirtschaftete 'Naturalüberschüsse', die gegenwärtig keinen Bedarf decken, nicht an Tauschpartner, die gegenwärtigen Bedarf haben und z.B. auf- grund einer durch die Bedarfsdeckung erst möglichen Produktion, zukünftigen Bedarf des 'Darlehensgebers' decken könnten, vermittelt werden können. D.h. "es gibt keine zeitliche Arbeitsteilung beim Konsum",82 wodurch einer Erhöhung des Reproduktionsniveaus enge Grenzen gesetzt seien.83
Die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Tauschwirtschaft seien demge- genüber aufgrund möglicher arbeitsteiliger Produktion weiter gefasst. Doch der im 'Eintaktverfahren' vollzogene Direkttausch berge Informationsprobleme der gegenseitigen Bedürfnisharmonisierung - 'double coincidence of wants' - und Synchronisationsprobleme - 'double coincidence of timing of transactions' -, die das Anliegen 'des frierenden Bäckers und des hungernden Schneiders', ihre je- weils vorhandenen, in gewünschte Güterbündel umzuwandeln,84 durch hohe Transaktionskosten, in Form von Mehrfachtausch, Such- und Kommunikations- aufwand, erschweren, so daß, weil die Transaktionskosten den Austauschnutzen oftmals übersteigen, der arbeitsteilig erschlossene Bereich der Wirtschaft begrenzt bleibe.85
Da in der Tauschwirtschaft Sparen, also die zeitliche Verlagerung des Konsums von 'Naturalüberschüssen' aus den Erträgnissen gegenwärtiger Produktion in die Zukunft, abgesehen von aufwendiger, verlustreicher, also 'Durchhaltekosten' verursachender Lagerung, nur durch die bereits beschriebene Vermittlung der Überschüsse zur Deckung gegenwärtigen Bedarfs 'transtempo- raler' Tauschpartner möglich sei, komme es in einer Tauschwirtschaft zu einem 'natürlichen' Gleichgewicht, zwischen vorweggenommener und aufgeschobener Nachfrage:86
Indem Natural-Kreditgeber, die Konsumaufschub nachfragen und dafür Konsumvorwegnahme anbieten, und Natural-Kreditnehmer, die, ohne gegenwär- tige Produktion, gegenwärtigen Bedarf decken müssen, deshalb Konsumvor- wegnahme nachfragen und dafür Konsumaufschub anbieten, zur Überbrückung von Abweichungen zwischen ihren Produktions- und Konsumptionszyklen,87 der geleisteten bzw. noch zu leistenden Arbeit des jeweiligen 'transtemporalen' Tauschpartners bedürfen, bedinge jeder Verkauf eigener Leistung - gegen- wärtiger Überschüsse - den Kauf fremder Leistung - künftiger Überschüsse: An- gebot und Nachfrage bestehe nur in einem komplementären Zusammenhang.88
Insbesondere der Vergleich zwischen Selbstversorgungs- und Tausch- wirtschaft zeige damit, daß Sparen nicht per se Überwindung einer Gegenwarts- präferenz sei, die notwendig eine über die 'Ersparnisbildung' hinausgehende Refundierung erzwinge, sondern auch als Zukunftspräferenz gegenwärtiger Überschußproduzenten verstanden werden könne, deren Realisierung die Bereit- schaft transtemporaler Tauschpartner erfordert, Gegenwartsgüter in Zu- kunftsgüter zu transformieren: "Man darf ... nicht ohne weiteres davon ausgehen, daß Leistungen per Termin weniger begehrt sind als Leistungen heute (Gegenwartspräferenz)."89
Das Austauschverhältnis sei dadurch gekennzeichnet, daß niemand schon aufgrund besonderer Eigenschaften seiner Tauschobjekte systematisch überlegen ist, und es sich deshalb z.B. für den Überschußproduzenten schon als vorteilhaft darstelle, mit der Weitergabe der Überschüsse, auch die 'Durch- haltekosten' weitergeben zu können:90 Entsprechend sei die sich ergebende Austauschrelation dieser Kreditgeschäfte rein durch das Knappheitsverhältnis zwischen den angebotenen und nachgefragten Leistungen bedingt, also durch die Knappheit des Angebots gegenwärtiger Überschüsse relativ zur Nachfrage nach vorweggenommenen Konsum, also das Angebot, Überschüsse durch Arbeit in zukünftige Güter für die derzeitigen Überschußproduzenten zu transformieren:
"Auch in einer (hypothetischen) Tauschwirtschaft fragen einige Wirtschaftssubjekte Leistungen per Termin nach und bieten dafür Leistungen heute, während zugleich andere Leistungen heute nachfragen und per Termin anbieten. Je nachdem, ob die Nachfrage nach Leistung per Termin oder die Nachfrage nach Leistung in der Gegenwart überwiegt, ergibt sich dann eine höhere oder niedrigere Einschätzung der zukünftigen oder gegenwärtigen Leistung."91
Dadurch sei, als Ausdruck der relativen Knappheit von gegenwärtigen Überschüssen, auch ein 'Kreditertrag' denkbar, der unter den Gestehungskosten der Überschüsse liegt und somit - in systemtheoretischer Terminologie - jede Produktion bzw. Überschuß- und Ersparnisbildung über Verluste und Gewinne mit dem Bedarf an dieser Produktion negativ rückgekoppelt, indem z.B. ein relativ großer Umfang gegenwärtiger Überschüsse eine 'niedrigere Einschätzung' gegenwärtiger Leistung bedingt, die ein Signal zur Reduktion weiterer gegenwärtiger Überschußproduktion und Ersparnisbildung setze.92
3.2 Geldwirtschaft
Der Nutzen der Einführung des Geldes in die Austauschbeziehungen bestehe zunächst einmal in der "... Einsparung von Transaktions- und Informa- tionskosten",93 da zum einen die Rechenmittelfunktion, durch eine Verminderung der relativen Preise von n * (n - 1) auf n Preise, eine leichtere Vergleichbarkeit zulasse,94 und zum anderen die durch Geld eintretende Spaltung des Direkttausches von Gütern in einen Verkauf und einen Kauf, Tauschvorgänge von einer doppelten Übereinstimmung der Wünsche unabhängig mache - und durch eine indirekte Synchronisation ersetze.95
Der durch das Geld bedingte Effizienzzuwachs der Austauschprozesse, ermögliche zwar aufgrund geringerer Transaktionskosten zur Verwirklichung be- stimmter Produktions- und Konsumptionsziele, "... neue Gebiete arbeitsteilig ge- schaffenen Wohlstands".96 Doch führe dieser Effizienzzuwachs analog zu einer höheren Abhängigkeit der Austauschprozesse vom Geld, das durch seinen Liqui- ditätsnutzen, als generalisierter Vermittler "... alle sachlichen, sozialen und zeit- lichen Dimensionen des Marktes"97 zu eröffnen und die Notwendigkeit spezifischer Marktkenntnisse zu substituieren,98 den Direkttausch der Ware verdränge: Wer Ware kaufen will, müsse nun dafür Geld bieten, wer Ware ver- kaufen muß, um Ware kaufen zu können, müsse deshalb Geld verlangen:
Denn "der wirtschaftliche Vorteil ... zwang alle Marktteilnehmer zur Be- nützung des Geldes. Nachdem dieses Geld einmal eingeführt war, war einfach jeder auf seine Verwendung angewiesen, wenn er am allgemeinen Warentausch noch weiterhin teilnehmen wollte. Damit war das Geld zum notwendigen Exis- tenzmittel geworden".99
3.2.1. Allientabilität und Akzeptabilität
Eine Nicht-Neutralität des Geldes sei aber allein durch seine Notwendigkeit für den Austauschprozeß noch nicht gegeben. Worauf es ankomme, um das Geld als neutral - im funktionalem Sinne eines reinen Mittlers des Güteraustausches - oder nicht-neutral definieren zu können, sei das Verhältnis zwischen seiner Akzeptabilität und Allientabilität:
"Vermutlich läßt sich die Neutralität des Geldes als der Zustand von Geld definieren, bei dem seine Akzeptabilität und seine Allientabilität gleich sind."100
3.2.1.1. Sozialökonomische Differenzierung des Geldnutzens
Aus der Perspektive solcher Wirtschaftssubjekte, deren Güternachfrage - bzw. Geldangebot - als 'Reproduzenten' aus dem gleichen Zwang hervorgehe, dem auch ihr Angebot an Ware bzw. Arbeitskraft - bzw. ihre Geldnachfrage - unterliegt, diene Geld ausschließlich als Mittel zum Zweck der Vermittlung von 'Gebrauchswerten', die zur Erhaltung ihrer Reproduktionsfähigkeit notwendig sind:
Der Nutzen des Geldes konstituiere sich hier, indem es als Träger von Marktinformationen, als Tauschmedium und Tilgungsmittel, sowie als Beweismit- tel über erbrachte Leistungen im Produktions- und Tauschprozeß, dem Leistungsaustausch zur Realisation verhilft, durch das Austauschbedürfnis der 'Reproduzenten'.101
Demgegenüber konstituiere sich der Nutzen des Geldes für Wirtschafts- subjekte, die - sei es anfänglich aufgrund hoher Knappheitsgewinne aus dem Verkauf von 'Naturalleistungen' - Geldeinkommen über ihren Reproduktions- bedarf hinaus erwirtschaften, durch ihre Fähigkeit, mangels Reproduktionsnot- wendigkeit, die Funktion des Geldes als Wertaufbewahrungsmittel wahrzu- nehmen, indem sie den monetär vermittelten Doppeltausch unterbrechen, ver- kaufen, ohne zu kaufen, und (damit sowohl das Say´sche Theorem falsifizieren, als auch) die Überschüsse in genau dem Medium speichern, dem die Reprodu- zenten als einem 'notwendigen Existenzmittel' bedürfen.102
3.2.1.2. Die Nutzung der Notwendigkeit
Da die Nutzung des Geldes als Wertaufbewahrungsmittel dem Kassen- halter mindestens keine Verluste einbringt, darüber hinaus aber alle 'sachlichen, sozialen und zeitlichen Dimensionen' des Marktes eröffne, und unter Umständen, als theoretische Möglichkeit, aufgrund der durch die Kassenhaltung sinkenden nachfragewirksamen Geldmenge gegenüber den angebotenen Waren, sogar De- flationserträge, also Kaufkraftzuwachs des gehaltenen Geldes bedeute,103 während die Reproduzenten auf das Geld als Existenzmittel angwiesen sind, ist der Geldbesitzer in der Lage, die Notwendigkeit des Geldes für den Austausch- prozeß zu vermarkten bzw. zu nutzen:
Den Geldhalter könne "... nur ein noch größerer Vorteil ... dazu bewegen,den Vorteil des sicheren Besitzes und der freien Verfügbarkeit aufzugeben und sein Geld durch Ausleihen wieder in Umlauf zu setzen ...", der eben "... im Einnehmen zusätzlicher Gelder durch Zinsen"104 bestehe.
Die Option zur Geldhaltung, als die Möglichkeit den monetär vermittelten Doppeltausch zu unterbrechen, bewirke somit Einkommen, die nicht aus dem Knappheitsverhältnis gegeneinander auszutauschender Waren resultieren, sondern aus der, wie die Kritik der Quantitätstheorie zeigte, nicht von der Zentral- bank über die Geldbasis kontrollierbaren, an den realen Transaktionsbedarf an- passbaren, sondern von den Geldhaltern wesentlich steuerbaren,105 relativen Knappheit zwischen der nachfragewirksamen Geldmenge und der angebotenen Warenmenge:106
Durch solche, in der Struktur der Geldordnung begründete Einkommen bzw. über den 'Tauschkraft Nennwert des Geldes hinausgehende Geldnutzen, übersteige die Akzeptabilität des Geldes seine Allientabilität.106a bei Felderer/Homburg 1989, S. 144, wie aus der Option zur Kassenhaltung theoretisch eine
Deflationsoption wird. Ein Beispiel wie diese Theorie zur Praxis werde, sei nach Schmitt 1989, S. 72 ff. die von Morgan zusammen mit Rockefeller über massive Geldhaltung inszenierte Wirtschaftskrise von 1907/ 08
3.2.2. Strukturell asymmetrische Verwendungsprämierung
Die Option zur Geldhaltung bewirke, als Folge der Möglichkeit ihrer 'Ver- marktung', nicht nur eine Verkehrung der Mittel-Zweck Relation zwischen Ware und Geld, die den Leistungsaustausch zum Mittel degradiere, dem Zweck zu dienen, die Forderung des Geldhalters nach Zins, also nach Geld bzw. mehr Geld zu erfüllen,107 sondern auch, damit einhergehend, daß Geld "... zweierlei 'Wert', seinen Kaufkraft-Nennwert" auf den Warenmärkten "... und seinen Zins- Preis" auf dem 'Kreditmarkt' habe: "Also einen nach Märkten 'gespaltenen Wert', der bedingt, daß die transtemporal getauschte Kaufkraft im Zeitablauf 'mehr Wert' sei als die gegenwärtige."107a Das aber bedeute eine strukturell asymmetrische Verwendungsprämierung in Form einer divergierenden Kaufkrafthöhe ver- schiedener Alternativen der Geldnutzung, zugunsten einer Präferierung zukünf- tiger Güter.107 b
Die Strukturveränderung, die mit dem Geld einhergehe, bestehe also letztendlich darin, daß, während in der Tauschwirtschaft die Haltung gegenwärti- ger Güter über den Gegegenwartsbedarf hinaus Durchhaltekosten verursachte, deren Vermeidung durch den Verleih der Güter aus der Sicht des Kreditgebers schon 'situationsverbessernd' wirkte, mit Geld eine Möglichkeit geschaffen wurde, die dem Geldbesitzer mangels Durchhaltekosten die Dispositionsfreiheit darüber gibt, zu entscheiden, um es mal wieder mit Keynes zu sagen, "... in wel- cher Form er das Verfügungsrecht über zukünftigen Verbrauch halten soll, das er aus einem laufenden Einkommen oder aus früheren Ersparnissen zurückgestellt hat. Soll er es in der Form eines sofort flüssigen Verfügungsrechtes (das heißt in Geld ...) halten? Oder soll er auf das sofortige Verfügungsrecht für einen bestimmten oder unbestimmten Zeitabschnitt verzichten ...?".108
Diese Wahlfreiheit privilegiere den kreditgebenden Geldbesitzer, als Nachfrager von Zukunftsgütern, insofern, als daß durch Kassenhaltung schlech- testens ein Kaufkraftzuwachs von Null erzielt - wodurch die Vergabe von Überschüssen nur gegen einen gleichlautenden Rückzahlungsanspruch nicht mehr situationsverbessernd wirke - und zudem über eben diese Kassenhaltung die preisbestimmende relative Knappheit des Geldangebotes beeinflußt werden könne, so daß sich der Zins, unabhängig vom Grad der relativen Knappheit gegenwärtiger Güter bzw. Überschüsse, immer im positiven Bereich bewege: Das unterstreiche durch den Vergleich mit der Tauschwirtschaft, in der der 'Preis' gegen 'Zukunftsgüter' eingetauschter gegenwärtiger Überschüsse, bedingt durch die Knappheitsverhältnisse, auch einen negativen 'return over cost' zulasse, die Nicht-Neutralität des Geldes.109
3.2.3. Der Preis der Nicht-Neutralität
Resultiert der Zins aus der Notwendigkeit des Geldes für den realwirt- schaftlichen Leistungsaustausch einerseits, und aus der Möglichkeit der Geld- besitzer, das Geld dem Leistungsaustausch vorzuenthalten andererseits, dann resultiere die Höhe des Zinssatzes aus den Kosten alternativer, für die Reproduzenten möglicher Tausch- und Kreditformen, z.B. Wechsel und Barter, sowie aus dem Konzentrationsgrad der Möglichkeit Liquidität vorzuenthalten:110
Indem somit dem Geld durch Geldsurrogate "Wettbewerber erwach- sen",111 deren Zunahme bei 'zu hohen' Geldzinsen eine relativ abnehmende Abhängigkeit vom Geld, also dessen abnehmende relative Knappheit bedeute, bzw. bei relativ dazu steigenden Warenpreisen, eine sinkende Kaufkraft des Geldes, könne der Zinssatz nicht beliebig steigen, sondern verbleibe im Zeit- ablauf auf einer in etwa gleichbleibenden Höhe im positiven Bereich.112
4. Liquiditätstheoretische Geld und Zinsanalyse
Die Analyse der Veränderungen, die mit der Einführung von Geld in den realwirtschaftlichen Güteraustausch einhergehen, zeige, daß der Nutzen des Geldes in der Einsparung von Transaktionskosten liegt. Es zeige sich aber auch, daß gerade durch diesen Nutzen des Geldes ein Grad der Arbeitsteilung entsteht, der grundsätzlich jede wirtschaftliche Transaktion, jeden Leistungsaus- tausch von der Benützung des Geldes als Medium der Vermittlung des Leis- tungsaustausches abhängig macht, und daß gerade diese Abhängigkeit der Reproduzenten vom Geld, den Geldbesitzer in die Lage versetzt, durch die Möglichkeit, das Medium der Vermittlung der Vermittlung vorzuenthalten, für die Bereitstellung des Geldes zur Vermittlung des Leistungsaustausches, Zinsen verlangen zu können.113
Das aber bedeute, der Zins werde nicht für den Nutzenzuwachs durch bestimmte Eigenschaften der geldvermittelten Produkte bzw. Produktionsmittel - z.B. damit Erträge erwirtschaften zu können - entrichtet, sondern für die Eigenschaft des Geldes selbst, durch seine Liquiditätsvorteile, die Teilnahme am realwirtschaftlichen Leistungsaustausch erst zu ermöglichen:114
"Zins und Rendite sind die Lockpreise, die Inhaber des Geldjokers dazu bringen muß, das monetäre Medium der Vermittlung wieder für Vermittlungszwecke zur Verfügung zu stellen. Insofern ist der Zins Entgelt für ... die Überlassung von Liquidität" .115
4.1. Zins als Liquidisierungskosten
Daß der Zins als der Preis des Verzichts auf knapphaltbare monetäre Li- quidität zu verstehen sei, den sich der Verleiher vom Entleiher für die Länge des Darlehenszeitraums, während dem er davon absieht, die Option zur Geldhaltung wahrzunehmen bzw. seine Kaufkraft "... in der Form eines sofort flüssigen Verfü- gungsrechtes (das heißt in Geld ...)"116 zu halten, bezahlen läßt, werde beson- ders durch die eigentliche Struktur jedes Kreditgeschäftes deutlich:
Kreditaufnahme bedeute nämlich, analog zur Tauschwirtschaft, zu- nächst nichts weiter als der gegenwärtige Verkauf zukünftiger (Geld-)Leistungen, was letztendlich dem Verkauf eines gegenwärtigen Gutes, des gegenwärtigen 'Anspruchs auf Zukunftsgüter' gleichkomme, das potentielle Kreditgeber, bei ge- genwärtigem Bedarf an solchen Ansprüchen',116a wie alle anderen gegenwärti- gen Güter, kaufen können. Dementsprechend bezahle "der Kreditgeber ... mit der Valuta, die er übergibt, also für die zukünftige Leistung die er erhält"116a und umgekehrt.
Indem somit der Kreditnehmer nicht fremde Kaufkraft leihe, sondern ei- gene Güter in die Form eines 'sofort flüssigen Verfügungsrechtes' transformiere und der Kreditgeber im Grunde auch nicht seine Kaufkraft veräußere, da er durch die Vergabe der Gelder eine Rückforderung in Höhe des entsprechenden 'Kauf- kraft-Nennwertes' erwerbe, also nur die Form der Verfügung über seine Kaufkraft von einem sofortigen in das 'aufgeschobene Verfügungsrecht' verwandele und damit allein den ökonomischen Nutzen der monetären Liquidität abgebe, bezahle der Kreditnehmer "... mit dem Zins folgerichtig nicht für geliehene Kaufkraft, sondern für erworbene Liquidität".117
Folglich ist der Zins aus der Sicht des Kreditgebers "... die Belohnung für die Aufgabe der Liquidität"118 und aus der des Kreditnehmers der "... Preis für die Liquidisierung eines nicht liquiden Wirtschaftsgutes":119 "Zum einen hat man es mit dem Tauschwert zu tun, den das Geld ... darstellt; zum anderen geht es um die spezifische Liquidität eben dieses Tauschwertes."120
4.2. Remanente Liquidisierungskosten
Die Notwendigkeit für den Entleiher, an den Verleiher Zins als Preis für die zeitweilige Überlassung des ökonomischen Nutzens der monetären Liquidität zu zahlen, bedingt regelmäßig ein monetäres 'Kosten-Nutzen Splitting' über die Finanzierungskosten kreditfinanzierter Nachfrage auf dem 'Warenmarkt'.121
Denn die vom Kreditnehmer zu tragenden, "... mit der Liquidisierung ver- bundenen Aufwendungen [für] ... die in Anspruch genommene Liquidität",122 lasse die Zinsen zwar möglicherweise "... als Aufwendungen im Zusammenhang mit demjenigen Wirtschaftsgut ..., das mit Geld erworben wird"123 erscheinen, indem sie zum Bestandteil der Finanzierungskosten werden. Im Gegensatz zu dem, den Kosten erworbener Ware gegenüberstehenden Nutzen erworbener Ware, verbleiben jedoch die Kosten ermöglichter Teilnahme am realwirtschaft- lichen Leistungsaustausch, die Liquiditätskosten, beim Kreditnehmer "... auch dann noch, wenn längst Dritte den Nutzen der Liquidität in Anspruch nehmen".124 Dadurch entstehen dem Kreditnehmer - in Form remanenter Liquidisierungskosten - 'Aufwendungen ohne Nutzen':
Diese Kosten der ermöglichten Teilnahme am 'Warenmarkt' seien somit zu unterscheiden von den Kosten erworbener Ware. Denn zum einen ergebe sich die relative Knappheit und damit der Preis angebotener Güter zunächst un- mittelbar unabhängig von den Bedingungen, unter denen ein Reproduzent die Liquidität erhält, die seinem Bedarf nach Gütern zur Nachfrage verhelfen. Auf der anderen Seite sei gleichfalls ohne Einfluß auf den Geldgeber, unter welchen Bedingungen, d.h. wo, wann und wie der Kreditnehmer die Liquidität gebraucht, da sich die Zinsforderung des Kredit- bzw. Liquiditätsgebers ausschließlich durch die Aufgabe monetärer Liquidität als 'Liquiditätsverzichtsprämie'124a begründe und solange gelte, bis der Kreditnehmer den an den Kreditgeber verkauften 'An- spruch' auf Geldleistungen einlöse, und das 'aufgeschobene Verfügungsrecht' in ein 'sofortiges Verfügungsrecht' für den Kreditgeber retransformiere:124 b
Weil also nicht der Zeitpunkt der Nutzung der Liquidität durch den Kreditnehmer auf dem 'Warenmarkt' relevant sei, sondern der Zeitpunkt ihrer Refundierung auf dem 'Kreditmarkt', bedingt die Teilnahme am realwirtschaftlichen Leistungsaustausch 'Aufwand ohne Nutzen' durch remanente Liquiditätskosten, die den Knappheitspreis für die zeitweilige Aufgabe von Liquidität, den Zins darstellen, der vom Knappheitspreis solcher, über Liquidität erwerbbarer Waren (inklusive Arbeitskraft) zu unterscheiden sei.124 c
4.3. Produktion der Liquidität
Unter dem Aspekt aber, daß der Geldbesitzer in Form des Zinses einen 'Kaufkraftzuwachs pro Zeiteinheit' als Preis dafür erhalte, daß er in Form monetärer Liquidität, kreditnehmenden 'Reproduzenten' einen 'Nutzen pro Zeiteinheit' überläßt,124 d sei folgendes zu bedenken:
"Money is not produced by the money issuing system alone. Issuing money does not yet produce money. Currency notes as such are not yet money in the economic sense of the word. They are only the technical equipment wich is necessary for the production of economic monetary liquidity by agents using it as money. To create 'money' that is, to produce money's economic liquidity, additional economic effort is necessary. The economic 'moneynes' of money, that is it's monetary liquidity does not come into existence unless economic agents make use of the currency notes and of the bank-money facilities as a means of value transfer money is a product of social consent and habit. Agents contribute to the production of money each time they dispose of and accept money as money Handling the money according to its transfer function, agents simultaneously endow it with its liquidity. By disposing of and accepting monetary instruments as money, agents cre- ate the confident expectation that everybody will dispose and accept money as mo- ney."125
'Agents' seien dabei 'Reproduzenten', die fortlaufend Arbeitskraft oder Güter kaufen und verkaufen (müssen). Diese produzieren die für den Austausch nützlichen Liquiditätseigenschaften des Geldes insofern, als daß sie die 'mone- tary instruments' als 'generalisierte Vermittler' in allen "... sachlichen, sozialen und zeitlichen Dimensionen des Marktes"125a "... ganz allgemein anerkennen, ausgeben und annehmen"125b und damit als Liquiditätsmittel in ihren Austausch- prozeß integrieren (müssen), um Produktions- und Konsumptionsziele zu errei- chen, die ohne die Produktion der 'economic moneyness of money' nicht erreichbar wären:
Dadurch erweise sich der Liquiditätsvorteil des Geldes als Resultat interdependenter sozialer und ökonomischer Beziehungen, als Resultat eines "... public consensus or social agreement"126 der am Markt zusammentreffenden Reproduzenten bzw. Austauschpartner, die durch den geldvermittelten Leistungsaustausch die Liquiditätseigenschaften der an sich wertlosen 'monetary instruments' beständig produzieren und reproduzieren.
Wenn aber die Liquiditätseigenschaften der 'monetary instruments' Pro- dukt des volkwirtschaftlichen Transaktionsprozesses der Reproduzenten sind, und der Geldbesitzer weder "... Hersteller des Geldes noch Urheber der mone- tären Liquidität ist",127 dann entstehe dem Geldbesitzer durch den Zins für die zeitweilige Aufgabe von Liquidität, 'Nutzen ohne Aufwand'.128 Analog verzeich- nen die Reproduzenten bedingt durch das Geldsystem bzw. die Option zur Geldhaltung, die es dem Geldbesitzer ermöglicht, den Nutzen der Liquidität für "... die Zirkulation zu sperren, bis man ihm Zins zahlt",129 wie schon in Form remanenter Liquidisierungskosten gezeigt, 'Aufwendungen ohne Nutzen':
Das aber bedeute zum einen, daß der Geldbesitzer auf die Produktion der Liquiditätseigenschaften durch die Reproduzenten angewiesen ist, um ihre mögliche Vorenthaltung 'vermarkten' zu können, während ihm zugleich diese 'Vermarktung' nur durch die optionale Störung - bzw., was noch gezeigt wird, realisierte Störung - eben dieser Produktion der Liquiditätseigenschaften möglich ist. Somit entsteht ein dem Geldsystem immanenter Anreiz bzw. eine Tendenz zur Systemstörung. Denn einerseits prämiert das Geldsystem die Möglichkeit, das Tauschmedium dem Austausch - als der Grundlage der Produktion der Liquiditätseigenschaften des Geldes - vorzuenthalten. Andererseits erzwingt es diese Prämierung durch den Austausch- bzw. Zirkulationsprozeß, durch den mo- netäre Liquidität und damit die Funktionsfähigkeit des Geldsystems, erst produziert bzw. erhalten wird.129 a
4.4. Der Geldzins als Fehlallokationsmechanismus
Ausgehend davon, daß die Fähigkeit 'Nutzen ohne Aufwendungen'130 durch den zeitweiligen Verzicht auf Liquidität zu erzielen, nur dem Geldbesitzer möglich ist, dem es an realwirtschaftlichen Transaktionsbedarf fehlt, so daß li- quide Mittel entbehrlich sind und verliehen werden können,131 zeige sich die Dys- funktionalität dieses nicht-neutralen Geldsystems insbesondere, sofern als Maß- stab ökonomischer Funktionalität des Geldes, dessen Wirkung auf die real- wirtschaftlichen Austauschbeziehungen berücksichtigt werde, und somit als Maßstab allein der Grenznutzen gelte, den ein 'sofortiges Verfügungsrecht' hinsichtlich der Befriedigung von Bedürfnissen in realen Kategorien vermittelt, nicht aber die Bedürfnisbefriedigung durch das Geld als Selbstzweck:131 a
Soll die Einführung von Geld in die Tauschwirtschaft den realwirtschaft- lichen Leistungs- bzw. Güteraustausch erleichtern oder erweitern bzw. in Teil- bereichen erst ermöglichen, so seien Gelder bei Geldbesitzern ohne realwirt- schaftlichen Reproduktionsbedarf, ohne reale Bedürfnisse, also in 'Kassen mit Geld ohne Bedarf' als dysfunktional anzusehen, indem sie dort gehindert werden ihrer Funktion zu entsprechen, im realwirtschaftlichen Austausch bzw. Zirkulationsprozeß, der die Liquiditätseigenschaften des Geldes erst 'produziert', dem Bedarf zur Nachfrage zu verhelfen.131 b
4.4.1. Monetäres Recycling
Kredite seien dementsprechend als 'Recycling' einer solchen dysfunktional zugeordneten 'Nachfragekompetenz' zu verstehen, das durch den Transfer der "... Gelder aus den 'Kassen mit Geld ohne Bedarf' in die 'Kassen ohne Geld mit Bedarf'"131 c, den Liquiditätsnutzen des Geldes an Reproduzenten mit realwirtschaftlichen Transaktionsbedarf leite, somit die fehlgeleiteten Gelder ihrer Funktion, dem Bedarf zur Nachfrage zu verhelfen, wieder zuführe, und dadurch zudem die fortlaufende (Re)Produktion der Liquiditätseigenschaften des Geldes im realwirtschaftlichen Austauschprozeß ermögliche.131 d
Dieses Recycling verhindere zwar zunächst, daß fehlgeleitete "monetäre Anwartschaften aufs Sozialprodukt"132 zu 'Nachfragelücken' führen, indem durch die Trennung von Bedarf und Geld eine wirksame Nachfrage sich nicht entfalten könne, Güter unabgesetzt oder Leistungspotentiale ungenutzt und damit realwirt- schaftlicher Reproduktionsbedarf unbefriedigt blieben. Doch bedinge das Recyc- ling dysfunktional zugeordneter 'Nachfragekompetenz', einhergehend mit der Nicht-Neutralität des Geldes, Recyclingkosten in Form von Zinsen, ohne die bekanntlich kein 'sofortiges' in ein 'aufgeschobenes Verfügungsrecht' umgewan- delt werde. Das aber verursacht das Paradox, monetäre Liquidität in genau die 'Kassen mit Geld ohne Bedarf' zu lenken, durch die das 'Recycling' monetärer Liquidität erst notwendig wurde:
"The stream of interest is a countertransfer ... in the opposite direction, that is from a level of higher real marginal utility to a level of lower real marginal utility."133
Infolge dieser Zins- und Zinseszinsströme, die dem Nutzen des Recyc- lingprozesses durch ihren Rückfluß in 'Kassen mit Geld ohne Bedarf' ent- gegenwirken, beginnt ein irrevesibler Prozeß:133a Wird per "... Kredit Geld aus 'vollen Kassen ohne Bedarf' in 'leere Kassen mit Bedarf' vorübergehend transferiert", so erhöhen die Zinsströme, die aus "... Kassen die schon vorher leer waren, in Kassen, die schon vorher voll waren"133b fließen, beständig die Divergenz zwischen 'vollen Kassen ohne Bedarf' und 'leeren Kassen mit Bedarf'.133 c
Das damit notwendig zunehmende 'Recycling' monetärer Liquidität bedeutet über die entsprechend anwachsenden Zinsströme eine beständig, sich theoretisch nach der Zinseszinsformel, also exponentiell selbst verstärkende Zunahme dieser Divergenz.134
Indem somit durch die Option zur Geldhaltung, 'Kassen mit Geld ohne Bedarf' 'Nutzen ohne Aufwand' ermöglichen, verschärft das Recycling dys- funktional zugeordneter monetärer Liquidität, die Dysfunktionalität der Zuord- nung, also die Fehlallokation monetärer Liquidität, und damit die Problem- ursache, so daß sich infolge dessen einerseits "... der Bedarf an Leistungen der Volkswirtschaft und andererseits die Zuordnung monetärer Kaufkraftkapazität"135 zunehmend auseinander entwickeln: Weil "mit steigender Fehlallokation ... der Recycling-Bedarf steigt, nährt sich der Prozeß selbst. Und weil die Zinsen dorthin fließen, wo schon die ausgezahlten Mittel nicht hingehörten, verstärkt er sich auch selbst".136
4.4.2. Der Preis als Knappheitsindikator von Gütern
Um den Kern der Kritik an der allokativen Funktion des Zinses zu verdeutlichen, ist es notwendig noch einmal die wesentliche Veränderung in den Austauschbeziehungen hervorzuheben, die die Einführung von Geld, aufgrund dessen Wertaufbewahrungsfunktion, mitsichbringt:
In einer marktlich organisierten, aber geldlosen Tauschwirtschaft erfolge, trotz der erwähnten Einschränkungen, die Koordination wirtschaftlicher Aktivitä- ten über einen Preis (als Ausdruck einer Ware in einer anderen), der die Knappheit der verfügbaren Güter selbst wiederspiegelt, da nicht benötigte Güter ihrem Besitzer Durchaltekosten aufbürden, was die Zurückhaltung unvorteilhaft macht, und durch die, für den Überschußbesitzer, jeder Austausch gegenwärtiger Überschüsse gegen Zukunftsgüter, zu einem Preis, der mindestens um eine Ein- heit höher ausfällt als die Selbstkosten abzüglich der Durchhaltekosten, vorteilhaft ist.137
Indem ein solcher Vorteil für den Überschußbesitzer nur erzielt werden könne, wenn sich Austauschpartner finden, bei denen die Verfügung über die er- worbenen Güter zu einem Nutzen führt, der die miterworbenen Durchhaltekosten übersteigt und unter Konkurrenzbedingungen die Überschüsse dorthin gelangen, wo dem Überschußbesitzer als Preis die größte mögliche positive Differenz zu dem genannten Mindestvorteil geboten wird, was tendenziell dort sein werde, wo der Nutzenzuwachs durch den Erwerb der Güter am größten ist, müsse sich die Allokation und Distribution von Gütern am Nutzen der Verfügung über solche Güter zur Bedürfnisbefriedigung in realen Kategorien orientieren:138
Da der Preis hierbei aber Resultat der relativen Knappheit zwischen den nicht zurückhaltbaren verfügbaren Gütern und dem Bedarf an diesen sei, könne die größte mögliche positive Differenz zum Mindestvorteil der Veräußerung auch unterhalb der Selbstkosten angesiedelt sein.139
4.4.3. Der Zins als Knappheitsindikator
'sofortiger Verfügungsrechte über Güter'
Im Gegensatz dazu entspreche die Höhe der aus dem Austausch von Gütern resultierenden Preise in einer Geldwirtschaft, mit zunehmender Not- wendigkeit, durch ein Recycling von Geldern aus den 'Kassen mit Geld ohne Bedarf' in 'Kassen ohne Geld mit Bedarf', die Aktivierung von Leistungspo- tentialen zur Bedürfnisbefriedigung in realen Kategorien erst zu ermöglichen, immer weniger der relativen Knappheit auszutauschender Leistungen (bzw. potentieller Leistungen in Form von Arbeitskraft), sondern immer mehr dem Knappheitsverhältnis zwischen diesen Leistungen und dem zur Leistungsvermitt lung notwendigen Geld bzw. der Bereitschaft der Geldbesitzer zur Aufgabe von Liquidität:
Die Folge sei, daß die Allokation und Distribution von Gütern weniger durch den Preis als Ausdruck für die Knappheit bedürfnisbefriedigender Güter erfolgt, sondern durch den Zins als Ausdruck für die Knappheit der die Güter vermittelnden 'sofortigen Verfügungsrechte' über Güter, die, anders als die Güter selbst, keine Durchhaltekosten verursachen, und somit als Ausdruck der Möglichkeit ihrer Knapphaltung immer eine positive Mindestverzinsung oder 'Liquiditätsverzichtsprämie' realisieren.140
Soll aber der realwirtschaftliche Leistungsaustausch die Überlassung der den Austausch ermöglichenden monetären Liquidität prämieren (können), so müsse der 'Warenmarkt' Knappheitsverhältnisse simulieren, die gestatten, einen Verkaufspreis zu erzielen, der hoch genug ist, um die Zinsforderung zu erfüllen.141 Dazu aber müsse sich die Knappheit des 'Warenmarktes' den Marktverhältnissen des 'Kreditmarktes' anpassen, dessen Knappheitsverhältnisse bzw. Knappheitspreise in Form von Geldzinsen, als Ausdruck der Knapphaltung bzw. induzierten Knappheit des Angebots monetärer Liquidität, eine ebenfalls induzierte Knappheit auf dem 'Warenmarkt' erzwinge.142
Infolge des Umstands, daß 'sofortige Verfügungsrechte' in 'Kassen mit Geld ohne Bedarf', durch die Option zur Geldhaltung, Geldbesitzern ohne Reproduktionsbedarf 'Nutzen ohne Aufwand' ermöglichen, verbleiben somit solche, über das vom Geldzins erzwungene Knappheitsmaß hinausgehende, realwirtschaftliche Leistungspotentiale oder Güter ungenutzt dort, wo sie die höchsten Kosten verursachen und den geringsten Nutzen bewirken:
Infolge dessen wird "Gegenwartspräferenz ... also kostspielig, weil Geld Zinsen kostet, und nicht etwa kostet Geld Zinsen, weil gegenwärtige Güter knapp sind. Sind einige gegenwärtig angebotene Güter knapp, so ist zu erwarten, daß sie auch teuer sind. Ihre Knappheit drückt sich in ihrem Preis aus. Unsinnig da- gegen wird es, wenn man an Güter, die gegenwärtig reichlich vorhanden sind, nur herankommt, wenn man vorher den Zins als Preis für Liquidität zahlen soll, die allerdings knapp ist. Das führt zu einer künstlichen Verteuerung"143 von Gegenwartsgütern oder gar nicht erst zur Produktion derselben, so daß - im Gegensatz z.B. zur neoklassischen Finanzierungstheorie - von einer bedarfsgerechten Allokation und Distribution von Gütern über den Zins, als Ausdruck einer induzierten Knappheit von Geld, nicht die Rede sein kann.144
5. Kapital, Krise und Ökologie
5.1. Monetäre Kapitaltheorie
Die Nicht-Neutralität des Geldes und die daraus resultierende strukturell asymmetrische Zuordnung ökonomischer Macht, die damit einhergehende asymmetrische Prämierung verschiedener Dispositionsentscheidungen bzw. -möglich- keiten bezüglich monetärer Liquidität durch die den Geldbesitzern vorbehaltene Geldhaltung einerseits und die auf den Gebrauch monetärer Liquidität und damit auf den Verzicht auf die Geldhaltung bei den Geldbesitzern angewiesenen 'Reproduzenten' andererseits, sowie einem daraus folgenden Fehlallokationsmechanismus in Form von Zins, ist die Grundlage der in der zirkulativitätsstheoretischen Literatur vertretenen, die liquiditätstheoretische Herleitung des Zinses unterstreichenden, monetären Kapitaltheorie.
5.1.1. Primärer und sekundärer Kapitalcharakter
Dieser monetären Kapitaltheorie folgend ist Kapital als 'zinstragendes Eigentum'145 zu bezeichnen. Davon ausgehend, daß der Kapitalcharakter von Produktionsmitteln ebensowenig aus deren Existenz resultiert, wie aus dem einzelwirtschafltichen Privateigentum an den Produktionsmitteln, sondern sich aus deren Knappheit herleitet, habe 'Sachkapital', einen sekundären, abgelei- teten Kapitalcharakter:
"...die Häuser, Fabriken, Maschinen usw. sind Kapital. Sie erheben den Zins ...für den Besitzer ... Aber diese Macht stützt sich nicht auf Eigenschaften dieser Dinge, sondern darauf, daß das Geld, genau wie bei den Waren, die Marktlage für die Erhebung des Zinses vorbereitet".146
Die Produktionsmittel ermöglichen "... nicht von Natur aus Mehrwert".147 Ausschlaggebend dafür sei vielmehr der Grad ihrer Knappheit in Relation zum Produktionsfaktor Arbeit, der vom Geldkapital bestimmt werde, indem Kapital- erträge aus Sachkapital die Aufgabe von Liquidität voraussetzen, und erst deren Knapphaltung die Knapphaltung der Produktion erzwingt.148 Somit institutionali- siert - "weil der Zins einen gewissen Mindestsatz ... niemals unterschreitet"149 - das Geld bzw. Geldsystem den Standard, über den das Sachkapital nicht vermehrt werden kann, indem es verhindert, daß durch die Zunahme die relative Knappheit von Sachkapital sinkt und der Sachkapitalertrag - als Ausdruck der Sachkapitalknappheit - den vom Geldkapital geforderten Mindestzinssatz unterschreitet:150
"Das Geld allein ist das wirkliche Realkapital, das Urkapital. Alle anderen Kapitalgegenstände (Sachgüter) sind durchaus von der Beschaffenheit des Geldes abhängig, sind dessen Geschöpfe, sind vom Geld in den Adel-, in den Kapitalstand erhoben worden Es ist also klar: das sogenannte Realkapital muß Zins abwerfen, weil es nur durch Ausgeben von Geld zustande kommen kann, und weil dieses Geld Kapital ist. Das sog. Realkapital besitzt nicht, wie das Geld, eigene zinserpressende Machtmittel. Es handelt sich bei diesen sogenannten Realkapitalien ..., um vom Geld eigens zu diesem Zweck geschaffene und erzwungene Marktverhältnisse, um eine selbsttätig wirkende, künstliche Beschränkung in der Erzeugung sogenannter Re-
alkapitalien "151
"Das Verhältnis ... der Arbeiter zu den Fabriken wird vom Geld immer künstlich, gesetz- und zwangsweise so gestaltet, daß die ... Arbeiter (die Nachfrage) einem ungenügenden Angebot (Fabriken) gegenüberstehen."152
Dadurch schafft bzw. erhält das Geldsystem durch eine aus der induzierten Knappheit von Liquidität abgeleiteten Knappheit der Produktionsmittel, einen Zustand ökonomischer Macht, der es erlaubt, mit Hilfe des Produktionsfaktors Arbeit - der als "vermehrbar, substituierbar ..., nicht hortbar und dem Angebotszwang unterworfen ... die schwächste Position im Verteilungskampf hat"153 - über den Sachkapitalzins, den Geldzins zu realisieren.154
Im Gegensatz zum sekundären, abgeleiteten Kapitalcharakter der Produktionsmittel, begründen somit die "... vereinten Vorteile von Notwendigkeit, Zurückhaltbarkeit, Mobilität und induzierter Knappheit"155 den primären Ka- pitalcharakter des Geldkapitals.156 Kapitalismus sei entsprechend eine durch die Dominanz der Geldsphäre über die Gütersphäre gekennzeichnete Wirtschafts- form, in der das Geldkapital "... durch die Knapphaltung bzw. induzierte Knappheit von Geld, den Zinssatz als Knappheitspreis von Geld"157 begründet, und durch die erzwungene Aufrechterhaltung der Knappheit von 'Realkapital' realisiert:158
"Kapitalismus bedeutet in diesem Sinne Zinswirtschaft; Zinswirtschaft heißt immer Mangelwirtschaft, und der Mangel darf um des Zinses willen nicht beseitigt werden."159
Der Ware komme in diesem Zusammenhang die Funktion "... eines einfachen Kassenboten des Geldkapitals"160 zu, über deren erzielbaren Preis der Kapitalertrag bzw. der Geldzins realisiert wird, indem die Knapphaltung des Geldes, mittelbar über die Begrenzung der Produktion und unmittelbar über die Verhinderung des Austausches, einen Grad der Knappheit des Warenangebotes, und damit derart hohe Knappheitspreise für Waren erzwinge, die "...das Umlaufen des Geldes nach der Formel G-W-G' gestalten":
"Weil also das herkömmliche Geld, unser Tauschmittel, an und für sich ein Kapital ist, daß keine Ware durch seine Brandmarke in den Handel aufnimmt, findet die Ware gesetz- und regelmäßig Marktverhältnisse vor, die die Ware als zinseserhebendes Kapital erscheinen lassen..."161
5.1.2. Geldkapitalzins und Sachkapitalertrag
Die liquiditätstheoretische Folgerung aus dem Kern der hier dargestel- lten monetären Kapitaltheorie, die Zurückführung von Kapitalerträgen auf eine der Produktionssphäre vom Geldsystem aufgezwungene Knappheit, besteht also letztlich darin, daß nur der Geldbesitzer fähig ist "...Geldkapital in Sachkapital (Produktionsmittel) umzuwandeln oder es zu diesem Zweck an andere zu verleihen. Wenn er es verleiht, beansprucht er Zinsen. Also muß auch das Sachkapital Zinsen erbringen. Der Profit des Sachkapitals ist nichts anderes, als der verwandelte Geldkapitalzins",162 was entsprechend auch mit Riese, der 70 Jahre nach Gesell eine zum Teil "frappierende Ähnlichkeit"163 mit der monetären Zirkulationstheorie aufweise, zusammengefaßt werden kann:
"Der Kapitalwert ist eine Form der Aufgabe von Liquidität, weil der Liquiditätsbesitzer ... Geld zum Kauf von Produktionsmitteln bereitstellen muß. Ist jedoch Kapital eine Form aufgegebener Liquidität, so ist auch die Profitrate eine Prämie für die Aufgabe von Liquidität. Die Profitrate ist somit ein Geldzins oder wird ... als Geldzins zum Güterzins."164
5.2. Monetäre Krisentheorie
Abgeleitet aus der Nicht-Neutralität des Geldsystems, als die, in ihrer derzeitigen Form, die als Kapitalismus bezeichnete Wirtschaftsform konstituierende Institution, und der, wie schon gezeigt wurde, damit einhergehenden Fehlallokation monetärer Liquidität, ergeben sich systemimmanent ökonomische Krisen im volkswirtschaftlichen 'Reproduktionsprozeß':
Ausschlaggebend ist dabei ein strukturell im Geldsystem angelegter Kri- senmechanismus, der auf dem Widerspruch zwischen der, wie oben dargelegt, notwendigen induzierten Knappheit einerseits beruht, und auf einem Wachs- tumszwang andererseits, der aus der - theoretisch nach der Zinseszinsformel - zunehmenden Fehlallokation "monetärer Anwartschaften aufs Sozialprodukt"165 resultiert.166
5.2.1. Wachstumszwang
Dieser Wachstumszwang im Zusammenhang mit einer dysfunktionalen Allokation monetärer Liquidität in "volle Kassen ohne Bedarf"167 basiert wesent- lich auf zwei zusammenhängenden Aspekten: Die zunehmende zins- und zinses- zinsbedingte Allokation monetärer Liquidität "... from a level of higher real mar- ginal utility to a level of lower real marginal utility",168 und folgend die zuneh- mende Geldkapitalakkumulation in 'vollen Kassen ohne Bedarf',169 erfordere eine entsprechend zunehmende kreditvermittelte Rückführung monetärer Liquidität in den realen gesamtwirtschaftlichen Zirkulationsprozeß von Produktion, Austausch und Konsumption, also ein 'Recycling' monetärer 'Kaufkraftkapazität', in 'Kassen mit Bedarf' hin zu einem "... level of higher real marginal utility".170
Indem somit Verschuldung eine zunehmend bedeutsamere Grundvoraussetzung für die Aufrechterhaltung realwirtschaftlicher Zirkulationsprozesse werde, wachse als deren Bedingung auch die Notwendigkeit einer um den Geldzins erhöhten Refundierung 'geschuldeter' monetärer Liquidität:
Das erzwinge tendenziell deren investive bzw. produktive Verwendung, die allein erlaube den 'Mehrertrag' zu erwirtschaften, den die um den Geldzins erhöhte Refundierung erfordert.171
Der Alternative einer konsumtiven Verwendung seien prohibitive Gren- zen gesetzt, weil zum einen der reine Konsum den Schuldnern nicht erlaubt, Erträge zu erzielen, die den Geldzins abdecken. Zum anderen bedeute eine nicht-investive, und damit nicht wachstumswirksame Verwendung geschuldeter monetärer Liquidität ein unter dem Geldzins liegendes Wirtschaftswachstum, was zu "... distributiven Folgeproblemen in Form von einem steigenden ab- zuführenden Zinsanteil bei Leistungs- und Arbeitseinkommen"172 führe: "Denn die Quote der Arbeitseinkommen sinkt um so schneller, je mehr der Zins das Wachstum übersteigt."173
So wenig aber, wie die notwendig um den Geldzins erhöhte Refun- dierung geschuldeter monetärer Liquidität eine nicht investive Verwendung er- laube, so sehr seien die zur Realisierung des Geldzinses notwendigen zusätz- lichen Realkapitalerträge aus einer investiven Verwendung monetärer Liquidität abhängig von der Fähigkeit der Ware, ihrer Aufgabe "... eines einfachen Kassen- boten des Geldkapitals"174 nachzukommen, also über den Produktionsoutput Erträge zu realisieren: Diese Fähigkeit des 'Kassenboten' erfordere in dem Maße zunehmende Arbeitseinkommen, in dem die mit dem Fehlallokationsmechanismus Zins bzw. Zinseszins notwendige investive Verwendung geschuldeter monetärer Liquidität zusätzliche Kapazitäten hervorrufe, deren Auslastung nur durch eine entspre- chend ansteigende Nachfrage möglich sei, und damit nur durch solche, eine wirksame Nachfrage bzw. Konsumfähigkeit erzeugende Arbeitseinkommen, die wiederum aus zusätzlichen Investitionen resultieren - was in Form des soge- nannten Kapazitätseffekts, den aus der ansteigenden Akkumulation von Geld- kapital hervorgehenden wachstumswirksamen Investitionsdruck unterstreiche.175
Zusammengenommen bewirke somit der Umstand, daß 'Gelder in Kassen ohne Bedarf' durch ein 'monetäres Recycling' in 'Kassen mit Bedarf' zurückgeführt werden müssen, über den Zins- und Zinseszinsmechanismus ein zunehmendes Wachstum der 'Gelder in Kassen ohne Bedarf', und daraus abgeleitet, mit der steigenden Notwendigkeit eines 'monetären Recycling', einen Wachstumszwang der Produktion.176 D.h. Wachstum als Voraussetzung der notwendigen Mitwirkung des Geldkapitals in der Volkswirtschaft erzwinge das Wachstum der 'Realkapitalien':
"Das Gesetz der Kapitalakkumulation ist nicht nur eine Wesenseigenschaft des Kapitals als Folge seiner Existenz, sondern die unerläßliche Bedingung seiner Wirksamkeit in der Wirtschaft Das Geldkapital stellt sich der Investition nur zur Verfügung zu einem Mindestzinssatz Daraus folgt das exponentielle Wachstum des gesamten in der Wirtschaft investierten Kapitals, dessen wachsende Zinsforderungen nur aus erhöhten Wirtschaftserträgen, also durch wirtschaftliche Expansion erfüllt erden können."177
5.2.2. Der Krisenmechanismus
Die aus der Geldkapitalakkumulation resultierende wirtschaftliche Ex- pansion durch realwirtschaftliches Wachstum sei möglich, sofern der Geldkapital- zins die Sachkapitalrendite unterschreite, also der "... Grenznutzen des inves- tierten Kapitals ... über der starren unteren Grenze des Geldzinsfußes liegt".178
Die Sachkapitalrendite müse sich jedoch durch die Knappheit des Sach- kapitals relativ zum Faktor Arbeit begründen, bzw. habe sich über den er- zielbaren Preis, als Ausdruck der Knappheit des 'Kassenboten des Geldkapitals', also über den im Preis erzielbaren Gewinn für den Produktionsoutput zu realisieren:
In der Tendenz sinke jedoch mit jedem, durch den Zuwachs der Produk- tionsmittel und des Produktionsoutputs bewirkten, realwirtschaftlichen Wachstum die Sachkapitalknappheit und damit die Sachkapitalrendite, weil eine durch Zu- wachs der Produktionsmittel bedingte abnehmende Knappheit relativ zum 'Faktor' Arbeit analog desen zunehmende relative Knappheit bedeute, und damit relativ zunehmende 'Faktorpreise' in Form von Löhnen. Diese können nicht durch höhere Preise des Produktionsoutputs kompensiert werden, sofern ein zunehmender Produktionsoutput ebenfalls dessen abnehmende Knappheit bedeutet:179
Das aus dem bestehenden Geldsystem hervorgehende Erfordernis realwirtschaftlichen Wachstums bewirke also einen tendenziell abnehmenden Grenznutzen bzw. eine sinkende Grenzleistungsfähigkeit des Realkapitals.180 Sobald infolge dessen die realwirtschaftliche Rendite unter die vom Geldkapital 'geforderte' Mindestverzinsung - als Ausdruck einer starren181 bzw. während des Konjunkturabschwungs steigenden182 Liquiditätspräferenz - absinke, und deshalb der Geldzins nicht mehr erbracht werden könne "... stellt sich das Geldkapital nicht mehr der Investition zur Verfügung":183
"Fällt also der Zins der Realkapitalien infolge der neuen Anlagen unter das herkömmliche Maß, so wird kein Geld mehr für solche Anlagen hergegeben. Kein Zins, kein Geld Also wenn das Volk fleißig und erfinderisch war, wenn die Ernte von Sonne und Regen begünstigt wurde, wenn viele Erzeugnisse zur Verfügung des Volkes stehen, um Wohnungen und Arbeitsstätten zu erweitern, dann, gerade dann zieht sich das Geld, das den Tausch hier vermitteln soll, zurück und wartet. Und weil das Geld sich zurückzieht, weil die Nachfrage fehlt [ist] der Krach (die Krise) ... wieder da."184
Indem "sich das Geldkapital nicht mehr der Investition zur Verfügung"185 stellt, komme es - grob umrissen - im Investitionsgütersektor zu Nachfrage- ausfällen und kapazitären Unterauslastungen bzw. Überkapazitäten, die über weiter sinkende Renditen die sinkende Investitionsneigung verstärken und zu Kapazitätsabbau führen. Der infolge sinkende Umfang nachfragewirksamer Ar- beitseinkommen überträgt durch abnehmende Konsumfähigkeit die Kapitalver- wertungsprobleme in den Konsumgütersektor, was entsprechend auf die Investitionsgüternachfrage zurückwirkt:
"Die vom Investitionsgütersektor ausgehenden Nachfrageausfälle pflanzen sich über Multiplikatorprozesse fort und bewirken Einkommensverluste in den anderen Wirtschaftssektoren. Beschäftigung und Wachstum gehen zurück, ... Sachkapitalvernichtung setzt ein "186
Infolge der durch Kapazitätsabbau und Sachkapitalvernichtung wieder zunehmenden relativen Knappheit des Sachkapitals entstehe jedoch erneut "... die Voraussetzung für den nächsten Aufschwung. Denn der wegen der Verknap- pung des Sachkapitals wieder gestiegene Realkapitalzins kanalisiert das Geld wieder in Realkapitalinvestitionen";187 jedenfalls solange, bis das wieder zu- nehmende Wachstum des Sachkapitals erneut, über dessen abnehmende relative Knappheit, eine derart niedrige Sachkapitalrendite hervorruft, daß sich das Geldkapital zurückhält:
Zusammengefaßt bestehe der im Geldsystem angelegte Krisenmecha- nismus in dem Widerspruch des Geldkapitals, einerseits über den Zinsmecha- nismus das Wachstum des Sachkapitals zu erzwingen und andererseits durch eben dieses erzwungene Wachstum, der Voraussetzung seiner Zurverfügung- stellung beständig entgegenzuwirken, indem das erzwungene Wachstum des Sachkapitals, über dessen infolge abnehmende relative Knappheit, beständig zu einer Sachkapitalrendite führt, die den Geldzins unterschreitet: Die Folge sei eine sich von einer Überproduktionskrise zur anderen bewegende Volkswirtschaft.188
In einer langfristigen Tendenz bewirke diese faktische Unmöglichkeit des 'Realkapitals' den Wachstumszwang des 'Geldkapitals' durch auf Dauer dem Zinseszinsmechanismus entsprechende Sachkapitalrenditen zu alimentieren, eine Art gesamtwirtschaften negativen 'Financial-Leverage' Effekt, der bedeutet, daß die über die 'Realkapitalrendite' hinausgehenden Zinsforderungen des Geld- kapitals, über einen zunehmenden 'Fremdkapitalanteil', den Verschuldungsgrad erhöhen:
Die Folge sind, abgesehen von der Höhe der Zinsen, überzyklisch ansteigende Zinslasten, die als Ausdruck einer 'strukturellen Überschuldung' bewirken, daß - ein volkswirtschaftlicher - 'braek-even' mit jedem folgenden Zyklusbeginn schwerer zu erreichen ist.189
Verbunden mit der dadurch zunehmenden 'Kontrolle' des Realkapitals durch das Geldkapital,190 stehe demgegenüber die ausschließlich monetär vermittelte Möglichkeit, 'sporadische' realwirtschaftliche Vorteile über dadurch realisierte monetäre (Extra-) Gewinne in eine systematische bzw. strukturelle Überlegenheit zu transformieren:
Denn neben dem damit einhergehenden, im Vergleich zur Konkurrenz schwächeren 'Refundierungsdruck', bedinge insbesondere die daraus resultie- rende Möglichkeit, durch 'eigenfinanzierte' Marktteilnahme mit Zinsen nur 'kalku- latorisch' - d.h. in Form von Opportunitätskosten - belastet zu sein, modellhaft ausgehend von 'Extragewinnen' in einem Konjunkturzyklus, die mit jedem Folge- zyklus zunehmende Fähigkeit, unabhängig von dann noch bestehenden real- wirtschaftlichen Produktivitätsvorteilen, den 'braek even' konkurrierender 'Einzel- kapitale' zu unterschreiten, deren 'Kostenstruktur' - durch die jeweilige Zinshöhe und die aus Verschuldung resultierende zunehmende Zinslast - nicht nur 'kalkulatorisch', sondern real geprägt ist.191
Die somit entstehende Möglichkeit, durch monetäre Überlegenheit, auch bei realwirtschaftlicher Unterlegenheit, Marktanteile absolut und relativ aus- zubauen, statt verdrängt zu werden, oder auf der andern Seite, die durch ihre nachteilige 'Kostenstruktur' abnehmende Fähigkeit der Konkurrenz, Produktivi- tätsnachteile 'anzupassen', bedeute einen fortschreitenden Abbau eines auf real- wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit basierenden Marktmechanismus.192
4.2.3. Ökologie: Wirtschaftlichkeit versus Rentabilität
Der vorab aufgezeigte Widerspruch zwischen dem Wachstumszwang einerseits und der, zur Erwirtschaftung einer den Geldzins überschreitenden Sachkapitalrendite notwendigen, ausreichend hohen relativen Knappheit der Produktionsmittel und des Produktionsoutputs andererseits, münde, als seine vorläufige Synthese, in einen Gegensatz zwischen Ökonomie und Ökologie.
Die oben beschriebene, erforderliche realwirtschaftliche Expansion sei nicht bedingt durch eine eventuell notwendige (quantitative) Erweiterung der Konsumptions- und Produktionsziele der Reproduzenten, sondern erweise sich als ein im Geldsystem angelegter, von realen Bedürfnissen unbhängiger "... Systemzwang zum Umsatz um des Umsatzes willen":193
"Der Wachstumszwang kommt vom Zins. Der Wachstumszwang ... be- ruht ... nicht auf einer Explosion der menschlichen Bedürfnisse, sondern im Ge- genteil darauf, daß immer mehr Gelder durch Kassen zu Menschen strömen, die bei überfließenden Kassen praktisch keine Bedürfnisse mehr haben."194
Dabei offenbare sich die Exponentialfunktion der vom Geldkapital erfor- derten realwirtschaftlichen Zuwächse zur Erbringung seiner entsprechend dem Zinseszinsmechanismus ansteigenden Forderungen "schon rein theoretisch als ... Utopie ...: Eine jährliche Zunahme des Sozialprodukts von 3% bedeute eine Verdoppelung nach rund 24 [23,5] Jahren, daher mehr als eine Vertausendfach- ung nach 240 Jahren".195
Im Gegensatz dazu seien Arbeit, Rohstoffe und Energie zwar notwen- dige Wachstumsbedingungen, die es aber nicht erzwingen, sondern vielmehr, "- wie Energie und Rohstoffe - zur Abbremsung des Wachstums" tendieren, bzw. "... wie die Arbeit - zu einer Sättigung",196 weil deren Einsatz durch den Anbieter der Ware 'Arbeitskraft', zur Realisierung eines bestimmten Konsumnutzens "... durch den steil ansteigenden Grenzaufwand straff begrenzt"197 sei.
Weil somit "als einziger Faktor ... das Kapital das Wachstum zur Bedin- gung seiner Mitwirkung"198 mache und es als "... Geldkapital ... nach den Regeln der Zinseszinsrechnung einen der jeweiligen Größe proportionalen, also ständig zunehmenden Ertrag"199 erzwinge, führe insbesondere die Notwendigkeit einen derartigen Zustand relativer Knappheit aufrechtzuerhalten, der zugleich ein real- wirtschaftliche Wachstum und eine Sachkapitalrendite zuläßt, die es erlaubt den Geldzins zu erbringen, zu einem Widerspruch zwischen der notwendigen Renta- bilität von Sachkapital und der Wirtschaftlichkeit des Ressourcengebrauchs, in- dem zur Erhaltung von Knappheit bei zugleich erforderlichem Wachstum, "... der rasche Verschleiß ... zu einem wesentlichen Faktor der Gewinnmaximierung, ... der Kapitalrendite"200 werde:
"Wirtschaftlichkeit und Rentabilität werden oft als synonyme Begriffe verwendet. Sie bilden jedoch einen Gegensatz ... Die Herstellung von Wegwerfartikeln ist für das Kapital sehr rentabel, weil sie ihm infolge der baldigen Vernichtung dieser Güter fortwährend neue rentable Anlagemöglichkeiten schafft. Dagegen ist die Verschleißproduktion für die Arbeitenden höchst unwirtschaftlich, weil sie letztlich dabei mehr arbeiten müssen als bei der Herstellung langlebiger Güter.
Das Interesse der Arbeitenden an einem wirtschaftlichen Einsatz ihrer Arbeit und das Interesse der Natur an einer sparsamen Verwendung von Rohstoffen und Energie stehen also in einem Dauerkonflikt mit dem Interesse des Geldkapitals. Sein Rentabilitätsprinzip zwingt ... zu ... Verstößen gegen das Wirtschaftlichkeits- prinzip."201
Darüberhinaus bedinge jedoch schon der Geldzins an sich einen vom realwirtschaftlichen Reproduktionsbedarf unabhängigen bzw. ihm entgegensteh- enden Ressourcen Ge- und Verbrauch. Denn zum einen führe der beständig po- sitive Zins, als Ausdruck der Knapphaltung von Liquidität, zu einem Knappheits- preis gegenwärtiger Güter, als Ausdruck monetär induzierten Knapphaltung des Zugangs zum 'Warenmarkt, der als Marktinformation, unabhängig von der Menge schon vorhandener Gegenwartsgüter, die Notwendigkeit bzw. den Nutzen weiterer Produktion signalisiert.202
Zum anderen bedeute, damit einhergehend, die Notwendigkeit, Erträge aus realwirtschaftlichen Aktivitäten an der Höhe des positiven Geldzinses zu messen, die beständige Unterbewertung zukünftiger Erträge bzw. zukünftigen Nutzens relativ zu gegenwärtigen Kosten und die beständige Überbewertung gegenwärtiger Erträge relativ zu zukünftigen (Folge-)Kosten:
Infolge erzwinge der zur Deckung von realwirtschaftlichen Reproduk- tionsbedarf notwendige Gebrauch monetärer Liquidität über den Reproduktions- bedarf hinaus, eine höhere Bewertung des kurzfristigen Nutzens des Verbrauchs von Ressourcen zur realwirtschaftlichen Realisierung des Geldzinses, und zu- gleich eine mit der Zinshöhe abdiskontierte Bewertung der langfristigen Folge- kosten, in Form einer möglichen Zerstörung der Reproduktionsgrundlagen.203
Sozusagen als Übergang, kann allgemein die Grundproblematik von Ökologie und Kapital als eine Grundproblematik des Kapitals selbst, auch mit Marx, der im folgenden Teil 'besprochen' wird, zum Ausdruck gebracht werden:
"Die kapitalistische Produktion entwickelt ... nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter."204
"Das Kapital ... ist destruktiv ... und beständig revolutionierend, alle Schranken niederreißend, die die Entwicklung der Produktivkräfte, die Erweiterung der Bedürfnisse, die Mannigfaltigkeit der Produktion und die Exploitation und den Austausch der Natur- und Geisteskräfte hemmen.
Daraus aber, daß das Kapital jede solche Grenze als Schranke setzt und daher ideell darüber weg ist, folgt keineswegs, daß es sie real überwunden hat, Die Universalität, nach der es unaufhaltsam hintreibt, findet Schranken an seiner eigenen Natur, die auf einer gewissen Stufe seiner Entwicklungen selbst als die größte Schranke dieser Tendenz werden erkennen lassen, und daher zu seiner Aufhebung durch es selbst hintreiben."205
III. Inkonistenzkritik der Geldrelevanz in der marxschen Kapitaltheorie
Einer Kritik marx'scher Aspekte der Kapitaltheorie kommt in der mone- tären Zirkulativitätstheorie deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil sie sich insbesondere als Alternative in der Kritik 'herrschender' Theorie und Praxis sieht, zu einer Marx unterstellten, vornehmlich auf die Produktionsspäre fixierten Ursachenforschung, die Vorgänge und Fehlentwicklungen der Zirkulationsspäre als 'abgeleitet' betrachte:
Konträr dazu steht die Ansicht, die Vorgänge in der Produktiosspähre, insbesondere die 'Mehrwertproblematik', seien symptomatischer Ausdruck von Fehlentwicklungen der Zirkulationsspäre, die ursächlich auf das, die Zirkulations- sphäre dominierende Geld bzw. Geldsystem zurückgehen. Damit sei nicht das Privateigentum an den Produktionsmitteln ausschlaggebend für die Aneignung von Mehrwert und nicht die Konkurrenz der Einzelkapitale ursächlich für ökonomische Krisen. Relevant sei vielmehr der Einfluß des Geldes auf die Konkurrenz und auf den Zugang zu den Produktionsmitteln.206
Die folgende Kritik bezieht sich dabei weniger auf eine Auseinanderset- zung mit der marx'schen Werttheorie, wie sie bei Gesell dominierte, und auch nur 'nebenbei' auf die marxsche 'Goldgeldtheorie', sondern vor allem auf eine Inkonsistenz und Inkonsequenz der Thematisierung der Relevanz des Geldes in der Ökonomie. Marx habe zwar einerseits den dominanten Einfluß auf die ökonomische Praxis dargelegt, sehe jedoch das Geld bzw. das Geldsystem im Gegensatz zur Zirkulativitätstheorie, nur als symptomatischen Ausdruck der 'Dys- funktionalitäten' des Kapitalismus:207
"Das Geld bringt diese Widersprüche nicht hervor; sondern die Entwicklung dieser Widersprüche und Gegensätze bringt die scheinbar tranzendentale Macht des Geldes hervor."208
1. Die Verwirklichungsbedingungen der Arbeit
Nach Marx seien mit folgender "... Polarisation des Warenmarktes ... die Grundbedingungen der kapitalistischen Produktion gegeben":209
"Das Kapitalverhältnis setzt die Scheidung zwischen den Arbeitern und dem Eigentum der Verwirklichungsbedingungen der Arbeit voraus Zweierlei sehr ver- schiedene Sorten von Warenbesitzern müssen sich gegenüber und in Kontakt treten, einerseits von Geld, Produktions- und Lebensmitteln, denen es gilt, die von Ihnen ge- eignete Wertsumme zu verwenden durch Ankauf fremder Arbeitskraft; andererseits freie Arbeiter, Verkäufer der eigenen Arbeitskraft und daher Verkäufer von Arbeit."210
Aus marx´scher Sicht werde demzufolge zur Überwindung der im Kapitalismus existierenden Widersprüche, die Überwindung der Polarisation zwischen den Eigentümern der Produktionsmittel auf der einen und der Verkäufer der Ware Arbeitskraft auf der anderen Seite, durch die "...Aufhebung des Privateigentums"211 an den Produktionsmitteln notwendig.212
1.1. Der Kapitalvorschuß und 'Händewechsel'
Neben dem Eigentum an Produktionsmitteln bestehe die Abhängigkeit der Produzenten jedoch auch nach Marx darin, daß sie auf einen Vorschuß angewiesen sind:213
"Der Kapitalist schießt das Gesamtkapital vor...; er kann die Arbeit nur ex- ploitieren, indem er gleichzeitig die Bedingungen für die Verwirklichung dieser Arbeit, Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand, Maschinerie und Rohstoff vorschießt."214
Folglich sei eine konstituierende Determinante der Exploitation der Arbeit und der Aneignung der "Bedingungen für die Verwirklichung dieser Arbeit, Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand, Maschinerie und Rohstoff"215 durch den 'fungierenden Kapitalisten', der Austausch, das Zusammentreffen von Eigentümern, Produzenten und Konsumenten, die jeweils Waren haben, die andere brauchen,216 denn jedes "Kapital betritt in erster Instanz ... den Markt, Warenmarkt, Arbeitsmarkt oder Geldmarkt":217
"Da jeder für sich arbeitet und sein Produkt nichts für sich ist, muß er na- türlich austauschen, nicht nur, um an dem allgemeinen Produktionsvermögen teilzunehmen, sondern um sein eigenes Produkt in ein Lebensmittel für sich selbst zu verwandeln."218
"Alle Waren sind Nicht-Gebrauchswerte für ihre Besitzer, Gebrauchswerte für ihre Nicht-Besitzer. Sie müssen also allseitig die Hände wechseln."219
Dieser Händewechsel, der wechselseitige Austausch der Waren, inklu- sive der Ware Arbeitskraft und der Produktionsmittel, vollziehe sich praktisch ausschließlich vermittels der "... Funktion des Geldes als Zirkulationsmittel, welches die an und für sich bewegungslosen Waren zirkuliert, sie aus der Hand, worin sie Nicht-Gebrauchswerte, in die Hand überträgt, worin sie Gebrauchs- werte [sind]".220
Indem somit nach Marx, weil "die Teilung der Arbeit ... das Arbeitsprodukt in Ware" verwandele, "... seine Verwandlung in Geld notwendig"221 werde, beschreibe Marx "... ein eindeutiges Abhängigkeitsverhältnis des Warenbesitzers vom Geldbesitzer":222
"W-G. Erste Metamorphose der Ware oder Verkauf der Salto mortale der Ware. Mißlingt er, so ist zwar nicht die Ware geprellt, wohl aber der Warenbesitzer. Die gesellschaftliche Teilung der Arbeit macht seine Arbeit ebenso einseitig als seine Bedürfnisse vielseitig. Ebendeswegen dient ihm sein Produkt nur als Tauschwert. Allgemein gültige gesellschaftliche Äquivalentform erhält es aber nur im Geld, und das Geld befindet sich in fremder Tasche."223
Darüber hinaus deute sich bei Marx ebenfalls als ursächliche Möglich- keit an, durch die 'Monopolisierung' von Gelde und Kredit den 'Vorschuss' vorzu- enthalten und dadurch symptomatisch "... die Scheidung zwischen den Arbeitern und dem Eigentum der Verwirklichungsbedingungen der Arbeit"224 zu erzwingen und zu vermarkten, indem der Geldkapitalist als potentieller Vorschußgeber die "... monetäre Vermittlung zwischen Bedarf und Leistungsangebot",225 die "... Funktion des Geldes als Zirkulationsmittel, welches die an und für sich bewe- gungslosen Waren zirkuliert"226 unterbinde, sofern durch den 'Händewechsel' seinen Ertragserwartungen nicht entsprochen wird, so daß Produzenten "... ihre Bedürfnisse nicht als aktuelle Nachfrage geltend machen, ihre Produktion nicht vorfinanzieren, ihre Produkte nicht austauschen und bezahlen"227 können:
Wer über das Geld die Zirkulation kontrolliert, so ließe sich mit Engels ergänzen, werde dadurch als "Händler mit dem Zirkulationsmittel ... Beherrscher der Produktion und damit ... Beherrscher der Produzenten":228
1.2 Geldzins und industrieller Profit
Die Analyse der Rolle und Wirkung von Geld und Zins bezüglich des Kapitals und dessen Entstehung stelle sich bei Marx jedoch widersprüchlich dar.229 Zunächst sei für ihn die "Warenzirkulation ... Ausgangspunkt des Kapitals" und "das Geld ... [d]ies letzte Produkt der Warenzirkulation ist die erste Erschei- nungsform des Kapitals",230 dann aber gelte: "Seine historischen Existenzbedin- gungen sind durchaus nicht da mit der Waren- und Geldzirkulation."231
Auch sei einerseits bei Marx Geldkapital "für den Verleiher in der Tat vom Prozeß des Kapitals unabhängiges Kapital", und der Zins ein "von der kapitalistischen Produktion - der Erzeugung des Mehrwerts - als solcher unabhängiger fact",232 sowie das "zinstragende Kapital ... eine fertige, über- lieferte Form", die schon existiert "... lange bevor die kapitalistische Produktions- weise und die ihr entsprechenden Vorstellungen von Kapital und Profit existier- en". Andererseits erscheine ihm der Zins nur als "... Unterform des vom Kapital erzeugten Mehrwerts",233 als bloß abgeleitet aus dem Profit des Realkapitals:234
"Das zinstragende Kapital bewährt sich nur als solches, soweit das verliehene Geld wirklich in Kapital verwandelt und ein Überschuß produziert wird, wovon der Zins ein Teil [ist]."235
Der Zins sei nach Marx also als Teil des Mehrwerts Resultat der kapi- talistischen Produktion, obwohl das zinstragende Kapital schon vorher existierte und der Zins nach Marx selbst, ein "... von der kapitalistischen Produktion - der Erzeugung des Mehrwerts - ... unabhängiger fact"236 sei.237 Das entspräche bei Marx einer Erklärung des Kapitals durch die Identität von Voraussetzung und Wirkung, indem er das, was 'historisch eingewachsen' und 'vorhergegangen' sei und ökonomisch in den Produktionsprozeß als seine Voraussetzung eingehe, zugleich als Resultat des Produktionsprozesses definiere:238
"Dies eine Moment nun, getrennt vom kapitalistischen Produktionsprozeß selbst, dessen stetes Resultat es ist und als dessen stetes Resultat es seine stete Voraussetzung ist, drückt sich nun darin aus, das Geld [und] Ware an sich latent Kapital sind."239
Als widersprüchlich erscheine zudem die marxsche Auffassung, "Zins und industrieller Profit sind bloß verschiedne Namen für verschiedne Teile des Mehrwerts der Ware oder der in ihr vergegenständlichten unbezahlten Arbeit ...",240 während zugleich eine Zweiteilung des Mehrwerts erfolge, die zwischen dem Geldkapitalzins und dem 'industriellen Profit' differenziere, und in Folge den 'industriellen Profit' zwar einerseits - widersprüchlich - als Teil des Mehrwertes definiere, doch andererseits auch als dessen Gegenteil:241
"Der Zins erscheint daher als der dem Kapital als Kapital, dem bloßen Eigentum des Kapitals geschuldete Mehrwert, den es aus dem Produktionsprozeß herausbringt, weil es als Kapital in ihn eingeht ...; der industrielle Profit dagegen ... als Teil des Mehrwerts, der dem funktionierendem Eigentümer, funktionierendem Kapital zukommt."242
"Wird ein Teil des Mehrwertes so in dem Zins ganz getrennt vom Exploitationsprozeß, so wird der andere Teil im industriellen Profit dargestellt als sein direktes Gegenteil, nicht Aneignung von fremder Arbeit, sondern Wertschöpfung eigener Arbeit. Dieser Teil des Mehrwertes ist also gar nicht mehr Mehrwert, sondern das Gegenteil, Äquivalent für vollbrachte Arbeit."243
"Dieser Teil, wie schon A. Smith richtig herausfand, stellt sich rein dar, selbstständig und gänzlich getrennt vom Profit."244
So erscheine auch bei Marx der Zins, indem einzig dieser eine 'Aneig- nung fremder Arbeit' bedeute, als der 'eigentliche' Mehrwert, damit das zinstra- gende Geldkapital als die grundlegende Institution des Kapitalismus und "... der industrielle Kapitalist selbst als ein vom Geldkapitalisten gekaufter Arbeiter",245 der wie andere Produzenten auf den Geldkapital-'Vorschuß' angewiesen sei:
"Im Gegensatz zum Zins stellt sich ihm also sein Unternehmergewinn dar als unabhängig vom Kapitaleigentum, als - Arbeiter."246
1.3. 'Funktionierender Kapitalist' und 'funktionsloser Investor'
Als Ausdruck seiner widersprüchlichen Bestimmung des Zinses, als Unterform des Mehrwerts und zugleich als einziger 'mehrwerterzwingender', durch die 'Aneignung fremder Arbeit' gekennzeichneter Bestandteil des Mehrwerts, erscheine entsprechend die marx'sche Polarisation zwischen 'Kapital', in Form von Produktionsmitteln bzw. des 'fungierenden Kapitalisten', auf der einen, und 'Arbeit' auf der anderen Seite:
Undifferenziert werde von Marx der 'fungierende Kapitalist', der auch nach Marx nicht Nutznießer "der kapitalistischen Produktion - der Erzeugung des Mehrwerts"247 durch "... Aneignung von fremder Arbeit" sei, sondern Nutznießer der "... Wertschöpfung eigener Arbeit",248 als 'Kapitalist' definiert, obgleich nur der 'funktionslose Investor', als "Beherrscher des Zirkulationsmittels ... Beherrscher der Produktion und ... der Produktionsmittel",249 erzwinge "eine Warenproduktion i.S. der marx’schen Formel G-W-G' zu betreiben":250
Denn einzig für den Geldkapitalisten gelte eben nicht, er könne "der Zirkulation nur in Geld entziehn, was er ihr in Ware gibt",251 da dem Geldbesitzer durch das Druckmittel, durch den vorenthaltenen 'Vorschuss' die Zirkulation zu unterbinden, die Möglichkeit zukomme, über die in der Zirkulationssphäre realisierten Erträge des durch die "Aneignung von fremder Arbeit"252 im Produk- tionsprozeß geschaffenen 'Wertes', in Form der Zinsen mehr "der Zirkulation ... in Geld entziehn" zu können, als "... er ihr ... gibt",253 so daß sich der Vorgang, aus der Perspektive des Geldbesitzers, reduziert "... auf die unvermittelten Extreme G-G' ".254
"Was vom Schatzeigner verlangt wird ist ... Geld als Geld; aber durch den Zins verwandelt er diesen Geldschatz in Kapital - in ein Mittel, wodurch er sich der Mehrarbeit ... bemächtigt und ebenso eines Teils der Produktionsbedingungen selbst, wenn sie auch nominal als fremdes Eigentum ihm gegenüberstehen bleiben."255
Das Marx diesen Zusammenhang dennoch 'unterbeleuchte', erkläre sich zwar indem bei Marx "... Handelskapital und Wucherkapital, zunächst gänzlich unberücksichtigt bleiben",256 doch stelle er gerade deshalb nicht die entscheidenden Fragen nach den Eigenschaften des Geldes, die die ökonomische Macht vermitteln, durch Überlassung von Geldkapital, die 'Aneignung fremder Arbeit' zu erzwingen und Geldvermögen zu vermehren, obwohl mögliche Antworten auch aus Marx Ausführungen hervorgehen könnten:257
2. Der Doppelcharackter des Geldes
Marx habe die Problematik der Trennung von Kauf und Verkauf als Folge des Einzugs von Geld in die Tauschwirtschaft durchaus thematisiert:258
"Die Trennung von Verkauf und Kauf macht mit dem eigentlichen Handel eine Masse Scheintransaktionen vor dem definitiven Austausch zwischen Warenproduzenten und Warenkonsumenten möglich ... [und] befähigt so eine Masse Parasiten, sich in den Produktionsprozeß einzudrängen und die Scheidung auszubeuten."259
Zwar verkenne Marx, daß sich die 'Parasiten' nicht in den Produktionsprozeß, sondern in den Zirkulationsprozeß drängen, doch deute sich hier, angesichts der Notwendigkeit, beinahe jeden Austausch, der sowohl Grundlage als auch Anreiz zur Produktion ist, ausschließlich vermittels des Geldes realisieren zu müssen, auch bei Marx eine Problemerkenntnis an:260
"Dies heißt ..., daß mit dem Geld als der allgemeinen Form der bürgerlichen Arbeit die Möglichkeit der Entwicklung ihrer Widersprüche gegeben ist."261
Julius Krause - Grundrisse einer monetären Zirkulativitätstheorie - Seite 58
Ob angesichts der marxschen Einsicht, "[d]a jeder für sich arbeitet und sein Produkt nichts für sich ist, muß er natürlich austauschen ...",262 die Reduktion der Problematik auf die reine Möglichkeit der Entwicklung der Widersprüche des Geldes ausreiche, sei zunächst dahingestellt.263 Jedenfalls finden sich bei Marx sowohl jene Aspekte, die das Geld als Äquivalentform der Ware darstellen, als auch solche, die das Geld als Nicht-Äquivalent erscheinen lassen, und daraus die ökonomische Macht des Geldes ableiten.
2.1. Geld als Äquivalentform der Ware
2.1.1. Wertmaß und Zahlungsmittel
Die Feststellung, das "alle andren Waren nur besondre Äquivalente des Geldes" seien und demgegenüber "... das Geld ihr allgemeines Äquivalent ...",264 beziehe Marx vor allem auf die von ihm beschriebenen Äquiva- lenzfunktionen des Geldes in der Zirkulationsspähre. Dabei sei nach Marx zunächst die Rechenmittelfunktion, als Währung oder Wertmaß, wesentlich, wozu "... die Geldware rein quantitativer Unterschiede fähig"265 sein müsse:
"Die erste Funktion des Goldes besteht darin, ... die Warenwerte als gleichnamige Größen ... darzustellen. So funktioniert es als allgemeines Maß der Werte und nur durch diese Funktion wird Gold ... zunächst Geld."266
Daraus abgeleitet entstehe nach Marx auch die Möglichkeit, bezogen auf dieses Wertmaß, Geld in abstrakter Form, als 'Rechengeld', bei Kredit- und Verrechnungsgeschäften zu verwenden:
"Mit der Entwicklung der Warenzirkulation entwickeln sich jedoch Verhältnisse, wodurch die Veräußerung der Ware von der Realisierung ihres Preises getrennt wird Der eine Warenbesitzer verkauft vorhandene Ware, der andere kauft als bloßer ... Repräsentant von künftigem Gelde."267
"Das Geld funktioniert jetzt erstens als Wertmaß in der Preisbestimmung der verkauften Ware. Ihr kontraktlich festgesetzter Preis mißt die Obligation des Käufers, d.h. die Geldsumme, die er an einem bestimmten Zeittermin schul- det."268
In Folge erweise sich das Geld in einer weiteren Funktion. "Es wird Zah- lungsmittel"269 und dient so dem Ausgleich auf Geld bezogener 'offener Rech- nungen':270
"Erst am fälligen Zahlungstermin tritt das Zirkulationsmittel wirklich in Zirkulation ... geht aus der Hand des Käufers in die des Verkäufers."271
2.1.2. 'Schatzbildung'
Mit der Möglichkeit zur 'Schatzbildung benenne Marx gewissermaßen auch die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes, die es ermöglicht einen Warenwert in Gestalt seiner allgemeinen Äquivalentform festzuhalten und den geldvermittelten Doppeltausch zu unterbrechen:272
"Es ist sehr richtig, daß das Geld, soweit es nur als Agent der Zirkulation bestimmt ist, beständig in ihrem Kreislauf eingeschlossen bleibt. Aber es zeigt sich hier, daß es ... eine selbstständige Existenz außer der Zirkulation besitzt und in dieser neuen Bestimmung ihr ebensowohl entzogen werden kann ..."273
"Der kontinuierliche Kreislauf der zwei entgegengesetzten Warenmetamorphosen oder der flüssige Umschlag von Verkauf und Kauf erscheint im rastlosen Umlauf des Geldes oder seiner Funktion als perpetuum mobile der Zirkulation. Es wird immobilisiert ... sobald die Metamorphosenreihe unterbrochen, der Verkauf nicht durch nachfolgenden Kauf ergänzt wird."274
Darüber hinaus thematisiere Marx auch, wie sich der 'Einzug' von Geld in den Austauschprozeß, durch die Möglichkeit der 'Schatzbildung' bzw. 'Wertaufbewahrung', auf den Warenaustausch auswirkt, und das Geld vom Mittel zum Selbstzweck wird:
"Mit der ersten Entwicklung der Warenzirkulation selbst entwickelt sich die Notwendigkeit und die Leidenschaft, ... die verwandelte Gestalt der Ware oder ihre Goldpuppe festzuhalten. Ware wird verkauft, nicht um Ware zu kaufen, sondern um Warenform durch Geldform zu ersetzen. Aus bloßer Vermittlung des Stoffwechsels wird dieser Formenwechsel zum Selbstzweck. Die entäußerte gestalt der Ware wird verhindert, ... als Geldform zu funktionieren. Das Geld versteinert damit zum Schatz ...".275
2.2. Geld als Nicht-Äquivalent der Ware
Obgleich Marx der 'Schatzbildung' auch einen durchaus positiven, 'stabilitätsfördernden' Aspekt zuschreibt -
"Damit die wirklich umlaufende Geldmasse dem Sättigungsgrad der Zirkulationssphä- re stets entspreche, muß das in einem Lande befindliche Gold- oder Silberquantum stets größer sein als das in Münzfunktion begriffene. Diese Bedingung wird erfüllt durch die Schatzform des Geldes. Die Schatzreservoirs dienen zugleich als Abfuhr- und Zufuhrkanäle des zirkulierenden Geldes, welches seine Umlaufskanäle daher nie überfüllt."276
- und dabei vor allem explizit das Problem der 'Überfüllung' der 'Umlaufskanäle' anspricht, nicht aber eine mögliche 'Unterfüllung' bzw. Knapphaltung, erfolge dennoch bei Marx eine Betonung der "... Macht des Geldes, der stets schlag- fertigen, ... Form des Reichtums"277 aus der die ökonomische Überlegenheit des Geldes gegenüber den Waren, die ökonomische Dominanz des Geldbesitzers gegenüber den Produzenten resultiere und wodurch das Geld zunehmend als Nicht-Äquivalent erscheine.278
2.2.1. Geld als gesellschaftliche Macht in privater Hand
Der 'Vorteil' des Geldes, demgegenüber "die Ware ... ein Tauschmittel von nur beschränkter Kraft ist,"279 bestehe zunächst darin, das es "[a]ls Zirkulationsmittel ... vor andren Waren voraus" habe, "... großen Tauschwert in kleinem Raum einzuschließen":
"Dadurch Leichtigkeit des Tansports, der Übertragung usw. In einem Wort, Leichtigkeit der realen Zirkulation, was natürlich erste Bedingung für ihre ökonomische Funktion als Zirkulationsmittel."280
Auch die größere Beständigkeit des Geldes im Vergleich zu den Waren werde von Marx dargelegt - "Waren sind das vergängliche Geld; das Geld ist die unvergängliche Ware"281 - wozu er, zur Unterscheidung zwischen der Akkumu- lation von Geld und Ware, eine Art 'Durchhaltekostenansatz' heranzieht:
"Das Aufhäufen andrer Waren nach einer doppelten Seite, abgesehn von ihrer Vergänglichkeit, wesentlich unterschieden vom Aufhäufen von Gold und Silber, die hier identisch mit Geld sind. Einmal das Aufhäufen andrer Waren hat nicht den Charakter des Aufhäufens von Reichtum überhaupt, sondern von besonderem Reichtum, und ist daher selbst ein besondrer Produktionsakt, wo es mit dem einfachen Aufhäufen nicht getan ist. Getreide aufzuspeichern erfordert besondre Vor- richtungen etc."282
Ebenso beschreibe Marx, daß Geld, durch seine "spezifische gesell- schaftliche Funktion ... innerhalb der Warenwelt die Rolle des allgemeinen Äquivalents zu spielen", "... gesellschaftliches Monopol" werde und damit einen "... bevorzugten Platz hat [,] unter den Waren".283 Marx erwähnt den " Vorteil ... die günstigsten Momente des Kaufs auszuwählen"284 und betont "das Privilegium dieser besondren Ware",285 daß "... das Produkt oder die Tätigkeit der Individuen" erst "... in dieser sachlichen Form ... gesellschaftliche Macht erhalten und beweisen"286 könne - "jeder Warenproduzent [muß] sich den nervus rerum, das 'gesellschaftliche Faustpfand' sichern"287 -, wodurch Marx auf eine mit dieser 'Suprematie des Geldes' verbundene Entwicklung der ökonomischen und gesell- schaftlichen Macht des Geldes schließe:288
"Das Bedürfnis des Austauschs und die Verwandlung des Produkts in reinen Tauschwert schreitet voran im selben Maß wie die Teilung der Arbeit, d.h. mit dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion. Aber in demselben Maße wie dieser wächst, wächst die Macht des Geldes, d.h. setzt sich das Tauschverhältnis als eine den Produzenten gegenüber äußere und von ihnen unabhängige Macht fest. Was ursprünglich als Mittel zur Förderung der Produktion erschien, wird zu einem den Produzenten fremden Verhältnis. In demselben Verhältnis, wie die Produzenten vom Austausch abhängig werden, scheint der Austausch von ihnen unabhängig zu werden und die Kluft zwischen dem Produkt als Produkt und dem Produkt als Tauschwert zu wachsen."289
Damit verkehre nach Marx das Geld durch seine Verselbstständigung die Verhältnisse, indem es, ursprünglich als Mittel zur 'Förderung der Produktion' zum Zweck der Produktion bzw. zum Selbstzweck werde:
"Das Geld ist ursprünglich Repräsentant aller Werte; in der Praxis dreht sich die Sache um, und alle realen Produkte und Arbeiten werden die Repräsentanten des Geldes."290
"Wir sehen also, wie es dem Geld immanent ist, seine Zwecke zu erfüllen, indem es sie zugleich negiert; sich zu verselbstständigen gegen die Waren; aus einem Mittel zum Zweck zu werden; den Tauschwert der Waren zu realisieren, indem es sie von ihm lostrennt; den Austausch zu erleichtern, indem es ihn spaltet; die Schwierigkeiten des unmittelbaren Warenaustausches zu überwinden, indem es sie verallgemeinert; in demselben Grad, wie die Produzenten vom Austausch abhängig werden, den Austausch gegen die Produzenten zu verselbstständigen."291
Widersprüchlich erscheine jedoch hierbei, daß nach Marx zwar die "Verwicklungen und Widersprüche, ... aus der Existenz des Geldes neben den besondren Waren hervorgehen",292 "... dem Geld immanent"293 sind, trotzdem aber, wie schon gezeigt wurde, gelte:
"Das Geld bringt diese Gegensätze und Widersprüche nicht hervor; sondern die Entwicklung dieser Widersprüche und Gegensätze bringt die ... Macht des Geldes hervor."294
Fraglich sei dabei zudem, wodurch, wenn die "Macht des Geldes" nach Marx "... erst ein Produkt der Entwicklung zum Kapitalismus"295 sei, das 'Wucher- kapital', das schon existierte, "... lange bevor die kapitalistische Produktionswei- se"296 existierte, in die Lage versetzt wurde, ohne die "Macht des Geldes" Zins bzw. die dazu notwendige Mehrarbeit der Produzenten zu erzwingen.297
Trotz allem benennt Marx die Folgen, die sich daraus ergeben, daß Geld als Äquivalent der Ware einerseits und als "gesellschaftliche Macht ... zur Privatmacht",298 zum Nicht-Äquivalent andererseits werde, durch das "... man sogar Seelen in das Paradies gelangen lassen"299 könne:
"Dieser Widerspruch eklatiert in dem Moment der Produktions- und Handelskrisen, der Geldkrise heißt Mit allgemeinen Störungen ... schlägt das Geld plötzlich und unvermittelt um aus der nur ideellen Gestalt des Rechengeldes in hartes Geld. Es wird unersetzlich durch profane Waren Eben noch erklärte der Bürger in prosperitätstrunkenem Aufklärungsdünkel das Geld für leeren Wahn. Nur das Geld ist Ware! gellt's jetzt über den Weltmarkt In der Krise wird der Gegensatz zwischen der Ware und ihrer Wertgestalt, dem Geld, bis zum absoluten Widerspruch gestei- gert."300
2.2.2. Die Asymmetrie von Verkauf und Kauf: James Mill
"... der Gegensatz zwischen der Ware und ihrer Wertgestalt, dem Geld"301 trete zwar in der Krise besonders deutlich hervor, doch offenbare sich die 'Macht des Geldes' schon bei jeder durch Geld vermittelten Transaktion, in der Asymmetrie von Verkauf und Kauf.302
So zitiert Marx denn auch James Mill, der ein "... notwendiges Gleichgewicht der Verkäufe und Käufe"303 annehme:
"Es kann nie einen Mangel an Käufern für alle Waren geben. Wer immer eine Ware zum Verkauf darbietet, verlangt eine Ware im Austausch dafür zu erhalten, und er ist daher Käufer durch das bloße Faktum, daß er Verkäufer ist. Käufer und Verkäufer aller Waren zusammengenommen müßen sich daher durch eine metaphysische Notwendigkeit das Gleichgewicht halten."304
Marx kritisiert diese Annahme mit der Entgegnung, es könne zwar "keiner ... verkaufen, ohne daß ein anderer kauft. Aber keiner braucht unmittelbar zu kaufen, wenn er selbst verkauft hat":305
"Das metaphysiche Gleichgewicht der Käufer und Verkäufer beschränkt sich darauf, daß jeder Kauf ein Verkauf und jeder Verkauf ein Kauf ist, was kein son- derlicher Trost für die Warenhüter, die es nicht zum Verkauf, also auch nicht zum Kauf bringen."306
Begründen lasse sich diese Asymmetrie auch bei Marx damit, "... daß die Ware nutzlos wird, wenn sie, in die alchimistische Retorte der Zirkulation geworfen, nicht als Geld herauskommt, nicht vom Warenbesitzer verkauft, also vom Geldbesitzer gekauft wird", während "das Geld ... die zirkulationsfähige Form bewahrt, ob (...es) früher oder später wieder auf dem Markt erscheine".307
2.2.3. Egalisierung durch Abstraktion
Doch trotz der Einsicht, in die 'Macht des Geldes' und der Nichtexistenz des 'metaphysischen Gleichgewichts' der Käufer und Verkäufer versuche Marx den Unterschied zwischen Ware und Geld, zwischen Verkauf und Kauf 'rethorisch' als irrelevant darzustellen, "als ob Marx sich selbst davon überzeugen müsse, daß es diesen eklatanten Unterschied gar nicht gibt":308
"Jedenfalls steht auf dem Warenmarkt nur Warenbesitzer dem Warenbe- sitzer gegenüber, und die Macht die diese Personen über einan-der ausüben, ist nur die Macht ihrer Waren. Die stoffliche Verschiedenheit der Waren ist das stoffliche Motiv des Austausches und macht die Warenbesitzer wechselseitig voneinander abhängig, indem keiner von ihnen den Gegenstand seines eigenen Bedürfnisses und jeder von ihnen den Gegenstand des Bedürfnisses des andren in seiner Hand hält. Außer die-ser stofflichen Verschiedenheit ihrer Gebrauchswerte besteht nur noch ein Unterschied unter den Waren, der Unterschied zwischen ihrer Naturalform und Ihrer verwandelten Form, zwischen Ware und Geld. Und so unterscheiden sich die Waren- besitzer nur als Verkäufer, Besitzer von Ware, und als Käufer, Besitzer von Geld."309
Den verbleibenden Unterschied zwischen dem "Besitzer von Ware" und dem "Besitzer von Geld", der 'nur' noch besteht, versuche Marx dann durch zwei hypothetische, abstrakte Modellannahmen zu egalisieren:310
"Gesetzt nun, es sei durch irgendein unerklärliches Privilegium dem Verkäufer gegeben, die Ware über ihrem Werte zu verkaufen, zu 110, wenn sie hundert wert ist, also mit einem nominellen Preisaufschlage von 10%. Der Verkäufer kassiert also einen Mehrwert von 10 ein. Aber nachdem er Verkäufer war, wird er Käufer. Ein dritter Warenbesitzer begegnet ihm jetzt als Verkäufer und genießt seinerseits das Privilegium, die Ware 10% zu teuer zu verkaufen. Unser Mann hat als Verkäufer 10 gewonnen, um als Käufer 10 zu verlieren
Unterstellen wir umgekehrt, es sei ein Privilegium des Käufers, die Waren unter ihrem Wert zu kaufen. Hier ist es nicht einmal nötig, zu erinnern, daß der Käufer wieder Verkäufer wird. Er war Verkäufer bevor er Käufer ward. Er hat bereits 10% als Verkäufer verloren, bevor er 10% als Käufer gewinnt. Alles bleibt wieder beim alten.
Die Bildung von Mehrwert und daher die Verwandlung von Geld in Kapital, kann also weder dadurch erklärt werden, daß die Verkäufer die Waren über ihrem Werte verkaufen, noch dadurch, daß die Käufer sie unter ihrem Werte kaufen."311
Durch diese "hypothetische und hochabstrakte" Konstruktion unterstelle die marx'sche Kompensation der Vor- und Nachteile bei Verkäufer und Käufer, "scheinbar überzeugend", implizit formale Symmetrie in der Verteilung ökono- mischer Macht, dernach "alle Beteiligten ... gleichermaßen reich, gleichermaßen ... auf den Erwerb von Lebensmitteln angewiesen und ... gleichermaßen ... spar- fähig" seien.
Mit einer solchen "ökonomisch irrealen Annahme"312 scheine zwar diese Kompensationsrechnung schlüssig, doch sei "genau diese Annahme aber ... nicht erfüllt, wenn man mit Marx die historische Trennung von Kapital und Arbeit voraussetzt. Dann muß man von Arbeitern ausgehen, die verkaufen und kaufen müssen, um zu leben, und von Vermögenden, die ... Arbeit kaufen können, aber nicht müssen":313
"Marx ... vernachlässigt diejenige fundamentale Polarisation zwischen Kapital und Arbeit, die sonst den historischen Ausgangspunkt und die materialistische Grundlage seiner Kritik der politischen Ökonomie konstituiert: Die ... Gedankenspiele ... setzen einfach die Symmetrie wirtschaftlich voraus, die Marx andernorts bestreitet und die dann scheinbar bewiesen wird."314
Diese Symmetrie vorausgesetzt, müsse der Arbeiter, als Verkäufer der Ware 'Arbeitskraft', dem 'Kapitalisten', als Käufer, einerseits zehn Prozent über dem zu seiner Reproduktion notwendigen Arbeitseinsatz anbieten, andererseits könne der Arbeiter nach dem Rollentausch als Käufer und Verkäufer, nun nach Marx, "...dem Kapitalisten den etwaigen Aufschlag wieder abnehmen"315 indem er - etwa über um zehn Prozent niedrigere Verkaufspreise der Arbeitserzeug- nisse bei gleichbleibenden Nominallöhnen - dem 'Kapitalisten' eine Erhöhung seines Reproduktionsniveaus um ebenfalls zehn Prozent aufzwingt:
Der Arbeiter "... hat bereits 10% als Verkäufer verloren, bevor er 10% als Käufer gewinnt. Alles bleibt wieder beim Alten":316 So müsse sich also der Nachteil, den der Verkäufer der Ware Arbeitskraft hat, durch den Vorteil den er dann "... in der Rolle des Käufers seiner Lebensmittel genießt",317 ausgleichen.
Solange jedoch diese Symmetrie nicht gegeben ist, müsse der Produ- zent verkaufen - und zwar seine Arbeitskraft - um zu kaufen, denn der "... Druck beim Kaufen, gleicht dem, unter dem er schon beim Verkauf seiner Arbeit stand".318 Während der 'vermögende' Geldbesitzer kaufen kann, aber nicht muß, und den Produzenten "... am Gängelband des von Marx selbst betonten 'Vor- schusses' hat",319 gelte sozialökonomisch differenziert, aufgrund dieser Polarisation, für den Produzenten eben nicht, "... keiner braucht unmittelbar zu kaufen, weil er selbst verkauft hat",320 denn:
"Der Verbraucher, von persönlichen Bedürfnissen getrieben, kann nicht warten, ...aber der als Kaufmann auftretende Geldbesitzer, der Eigentümer des allgemeinen unentbehrlichen Tauschmittels, der kann warten, der kann Warenerzeuger und -verbraucher regelmäßig dadurch in Verlegenheit bringen, daß er mit dem Tauschmittel (Geld) zurückhält."321
2.2.4. Die Voraussetzung der Mehrwertaneignung
Übereinstimmend mit der einleitend dargelegten Sichtweise zu der Lehre von den drei Produktionsfaktoren betont Marx die Notwendigkeit der Arbeit des Produzenten zur Realisierung der Formel G - G':322
"Die Wertveränderung des Geldes, das sich in Kapital verwandeln soll, kann nicht an diesem Geld selbst vorgehen, denn als Kaufmittel und als Zahlungsmittel re- alisiert es nur den Preis der Ware Die Veränderung muß sich also zutragen mit der Ware Um aus dem Verbrauch einer Ware Wert herauszuziehen, müßte unser
Geldbesitzer so glücklich sein, innerhalb der Zirkulationssphäre, auf dem Markt, eine Ware zu entdecken, deren Gebrauchswert selbst die eigentümliche Beschaffenheit besäße, Quelle von Wert zu sein, deren wirklicher Verbrauch also selbst Vergegenständlichung von Arbeit wäre, daher Wertschöpfung. Und der Geldbesitzer findet auf dem Markt eine solche spezifische Ware vor - das Arbeitsvermögen ... den Inbegriff der physischen und geistigen Fähigkeiten, die in der Leiblichkeit, der lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existieren und die er in Bewegung setzt, sooft er Gebrauchswerte irgendeiner Art produziert."323
Deutlich werde dadurch jedoch nur die Unmöglichkeit des Geldes, selbst Wertschöpfung zu betreiben. Dazu bedarf es, wie eingangs gesehen, auch der Zirkulativitätstheorie zufolge, der Arbeitskraft der Produzenten. Das aber besage zwar womit Wert und damit auch Mehrwert erzeugt wird, nicht aber wodurch der Zwang zur Mehrwertproduktion bzw. zur 'Mehrarbeit' entsteht.324 Doch nenne Marx selbst die Bedingungen unter denen der Produzent dazu gebracht wird Mehrarbeit zu erbringen:
"Zur Verwandlung von Geld in Kapital muß der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden, frei in dem Doppelsinn, daß er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, daß er andererseits andre Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen."325
Das aber bedeute wiederum nur, der Produzent dürfe nicht die Möglich- keit haben, sich durch das Eigentum an Produktionsmitteln der Erzeugung des Mehrwerts zu entziehen: Gewährleistet sei dies solange der Produzent zur Erlan- gung der "... zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen"326 auf einen (Geld)kapitalvorschuß angewiesen ist, den der Geldkapitalist, als 'Beherrscher der Zirkulation' vorenthält, sofern dessen spezifischer Gebrauchswert bzw. Nutzen für den Produzenten darin bestände, sich der Erzeugung des Mehrwerts für den Geldgeber entziehen zu können, so daß "... Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand, Maschinerie und Rohstoff",327 also die "... bewegungslosen Waren", nicht "... aus der Hand, worin sie Nicht-Gebrauchswerte, in die Hand ..., worin sie Gebrauchswerte ..."328 sind, übergehen, und somit der Produzent, der "... andre Waren nicht zu verkaufen hat",329 in marx’scher Terminologie, genötigt sei durch unbezahlte Arbeit, über die zu seiner Reproduktion notwendige Arbeitszeit hinaus, Mehrarbeit zu verrichten.330
Dabei zeige sich, daß nicht das Eigentum an den Produktionsmitteln die Erzeugung des Mehrwerts durch den Produzenten erzwingt, sondern der durch die Knapphaltung des Geldes bzw. Geld-'Vorschusses' knappgehaltene Zugang zu den Produktionsmitteln bzw. zu den "... zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen ...",331 der ein Knappheitsverhältnis der Produktionsmittel relativ zur Ware 'Arbeitskraft' gewährleistet, das es dem Geldkapitalisten erlaubt diese Ware zu einem ihm 'genehmen' - niedrigen - Preis einzukaufen:
"Es handelt sich bei diesen sogenannten Realkapitalien, genau wie bei den Waren, um vom Geld eigens zu diesem Zweck ... erzwungene Marktverhältnisse, um eine ... künstliche Beschränkung in der Erzeugung sogenannter Realkapitalien, so daß deren Angebot niemals die Nachfrage decken kann."332
Entsprechend unterstreiche auch die zur Relativierung der Bedeutung der Zirkulationssphäre und damit zugleich der 'Macht des Geldes' gedachte marx’sche Aussage, "[d]ieser ganze Verlauf, die Verwandlung seines Geldes in Kapital, geht in der Zirkulationssphäre vor und geht nicht in ihr vor" - "Durch die Vermittlung der Zirkulation, weil bedingt durch den Kauf der Arbeitskraft auf dem Warenmarkt. Nicht in der Zirkulation, denn sie leitet nur den Verwertungsprozeß ein, der sich in der Produktionssphäre zuträgt",333 den nur symptomatischen Charakter, den die Verhältnisse in der "... verborgenen Stätte der Produktion" für die "... Erzeugung des Mehrwerts"334 haben:
Zum einen seien so auch nach Marx die Kosten der auf dem Waren- markt gekauften Arbeitskraft, und vor allem der zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendigen Produkte des Warenmarktes, durch die vom 'Geldkapital' dominierte Zirkulationsphäre bestimmt. Zum anderen sei zwar offensichtlich, daß der Ge- genwert des vom Geldkapital beanspruchten Zins, durch Mehrarbeit der Produ- zenten in der Produktionssphäre erbracht werden muß. Doch wird auch nach Marx der "...Verwertungsprozeß..., der sich in der Produktionssphäre zuträgt",335 über die Zirkulation nicht nur eingeleitet, sondern auch beendet:
Denn das Geld "... bildet ... Ausgangspunkt und Schlußpunkt des Verwertungsprozeßes",336 so daß der Geldgeber, als 'Beherrscher der Zirkulation', über das Sein oder Nicht-Sein der Produktion von 'Wert' und die Erzeugung von Mehrwert verfüge.337
Kurz gesagt, "... die Existenz des Arbeiters und der Besitz der Produk- tionsmittel sind zwar notwendige Bedingungen, um Wert zu erzeugen".338 Die Ursache dafür, "... daß der Verkäufer der Ware Arbeitskraft weniger als ein Äquivalent"339 der Wertschöpfung seiner Arbeit bekomme, aber sei "... außerhalb der Fabrik",340 in den durch das Geldsystem erzeugten Machtverhältnissen der Zirkulationssphäre zu suchen.
2.2.5. Der Wert des Geldes
Was Marx daran hindere, den symptomatisch in der Produktionssphäre stattfindenden Exploitationsprozeß ursächlich in der Zirkulationssphäre und in der 'Macht des Geldes als Zirkulationsmittler zu suchen, sei zunächst die Annahme, "[e]in Gebrauchswert oder Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakte menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisiert ist":341
'Abstrakte menschliche Arbeit' vermag Marx scheinbar im Geld nicht zu entdecken: Keine Arbeit "... kein Wert, und ohne Wert kein Mehrwert",342 sei die gedankliche Formel. Tauschwert bzw. abstrakte menschliche Arbeit scheine nur in dem stofflichen Träger des Geldes vergegenständlicht, so "daß ... der Wert des Geldes durch seine Produktionskosten, d.h durch die in ihm enthaltene Arbeitszeit bestimmt ist"343 und "... der Tauschwert der Ware ... in einer anderen, besondren Ware, dem Material des Geldes, ausgedrückt"344 werde.
Nun hat nach Marx aber auch nur etwas Wert, sofern es zugleich Ge- brauchswert hat. Denn "endlich kann kein Ding Wert sein, ohne Gebrauchsge- genstand zu sein":345 "Die Nützlichkeit eines Dinges macht es zum Gebrauchs- wert."346
Marx gesteht zwar der "Geldware neben ihrem besondren Gebrauchs- wert als Ware, wie Gold z.B. zum Ausstopfen hohler Zähne ... dient, ... einen for- malen Gebrauchswert"347 zu, bezieht diesen aber auf die damit verbundene Möglichkeit, im Umfang des durch die 'allgemeine Äquivalentform' repräsen- tierten Tauschwertes, in den 'Genuß' der damit erwerbbaren Gebrauchswerte zu kommen:
"Was ist nun der Gebrauchswert, den der Geldkapitalist für die Zeit des Aus- leihens veräußert und an den produktiven Kapitalisten, den Borger, abtritt? Es ist der Gebrauchswert, den das Geld dadurch erhält, daß es in Kapital verwandelt werden,
340 Otani 1981, S. 68, vgl. auch Hüwe o.J. S.9 als Kapital fungieren kann, und daß es daher einen bestimmten Mehrwert, den Durchschnittsprofit ... in seiner Bewegung erzeugt..."348
"Diesen Gebrauchswert des Geldes als Kapital - die Fähigkeit, den Durch- schnittsprofit zu erzeugen - veräußert der Geldkapitalist an den industriellen Kapitalisten für die Zeit, während derer er diesem die Verfügung über das verliehne Kapital abtritt."349
Damit betrachte Marx den Gebrauchswert des Geldes "als eine Art Vor- wirkung dessen, was man mit Geld an Sachgütern und Arbeit erwerben kann":350 Indem somit der 'Gebrauchswert' des Geldes vor allem eine 'real- kapitaltheoretische' Deutung erhalte, verstehe Marx Geld zum einen rein als Ver- mittler der Exploitationsgrundlagen, nicht als Exploitationsursache selbst, die erst durch die Knapphaltung von 'Realkapital' abgeleitete Exploitationsgrundlagen schafft, so daß weiter ungeklärt bleibt, wodurch das Geld die ökonomische Macht erhält für 'Vermittlungsdienste' 'Vergütung' durchsetzen zu können.351
Zum anderen 'vernachlässige' Marx dadurch die von ihm selbst vorgenommene Deutung, daß "... der Gebrauchswert des Geldes als Zirkulationsmittel sein Zirkulieren selbst ist",352 also Geld durch seine Funktion 'an sich' seinen 'Gebrauchswert' konstituiere:
"Vorher noch zu bemerken, daß ... sein Dienst als Produktionsinstrument nachgewiesen werden kann Ohne Geld eine Masse trocs nötig, eh man im Austausch den gewünschten Gegenstand erhält."353
"Sofern das Geld in seiner selbstständigen Existenz aus der Zirkulation herkommt, erscheint es in ihr selbst als Resultat der Zirkulation; es schließt sich mit sich selbst durch die Zirkulation zusammen."354
Bezogen auf den vorab angesprochenen 'Tauschwert' des Geldes ver- kenne Marx zudem das es "eines guten Stückes gesellschaftlicher Arbeit"355 bedarf um das Zirkulationsmittel in seinem Gebrauchswert als solches zu 'schaffen' und zu erhalten, obgleich Marx auch hierzu entsprechend darlegte, daß, "... das Geld als universeller materieller Repräsentant des Reichtums aus der Zirkulation herkommt, und als solcher selbst Produkt der Zirkulation ist",356 "... [a]ber nur die gesellschaftliche Tat ... eine bestimmte Ware zum allgemeinen Äquivalent machen"357 könne: "Es entsteht aus dem Austausch und im Austausch ..., ist ein Produkt desselben."358
Insofern bestehe die ständige Produktion und Reproduktion des 'Wertes' von Geld bzw. monetärer Liquidität in der 'Arbeit des Austauschens' durch die am Austauschprozeß teilhabenden 'Reproduzenten':359
Damit fehle also nicht das "... Quantum gesellschaftlicher Arbeit, dessen nützliches Ergebnis"360 der "... Gebrauchswert des Geldes als Zirkulations- mittel"361 ist, der sich für die Reproduzenten durch ihr (notwendiges) 'Austausch- bedürfnis' konstituiere, das wiederum ausschlaggebend für die beständige (Re-) Produktion des Geldes ist. Folglich komme - auch nach Marx - dem Geld ge- trennt von seiner materiellen Substanz, durch seine Geldfunktionen selbst, Wert zu: Die Möglichkeit zur Vorenthaltung dieser für den Reproduktionsprozeß der Produzenten notwendigen Funktionen, befähigt den Geldbesitzer sozusagen den Wert des Geldes, durch die 'Aneignung fremder Arbeit', zu 'verwerten'.362
2.2.6. Letztendlich: Die juristische Transaktion
Letztendlich komme es bei Marx darauf an, "daß der Überschuß des Wertes der Ware über ihren Kostpreis im unmittelbaren Produktionsprozeß entsteht", auch "... wenn er realisiert erst im Zirkulationsprozeß" werde, und es nach Marx zudem auch "... in der Wirklichkeit, innerhalb der Konkurrenz, auf dem wirklichen Markt, von den Marktverhältnissen abhängt, ob oder nicht, und zu welchem Grad dieser Überschuß realisiert wird."363
Indem das nach Marx aber nur bedeute, daß "die ursprüngliche Form, worin sich Kapital und Lohnarbeit gegenüberstehen, ... verkleidet" werde, und somit "... der Mehrwert selbst ... nicht als Produkt der Aneignung von Arbeitszeit, sondern als Überschuß des Verkaufspreises der Waren über ihren Kostpreis" erscheine, so werde dadurch "... die im Produktionsprozeß klarer oder dunkler aufgedämmerte Ahnung von der Quelle des in ihm gemachten Gewinns"364 verschleiert.
Wie auch immer das zu interpretieren sei, wird eventuell dadurch deutlich, daß es für Marx dabei bleibe:
"Die erste Verausgabung, die das Kapital aus der Hand des Verleihers in die des Anleihers überträgt, ist eine juristische Transaktion, die mit dem wirklichen Reproduktionsprozeß des Kapitals nichts zu tun hat, ihn nur einleitet. Die Rückzahlung, die das zurückgeflossene Kapital wieder aus der Hand des Anleihers überträgt, ist eine zweite juristische Transaktion, die Ergänzung der ersten; ... Weggabe und Rückgabe ... als wilkürliche, durch juristische Transaktionen vermittelte Bewegungen, ..."365
Aus den Differnezen "der Diagnose des Mehrwertsyndroms ergeben sich auch die Unterschiede in den Plänen der Therapie",366 so daß eine Thematisierung des Geldes und des Geldkapitalzinses nach Marx nur die Symptomebene in der 'Kapitalproblematik' aufgreife. Zudem sei es nach Marx ohnehin "unmöglich ..., Verwicklungen und Widersprüche, die aus der Existenz des Geldes neben den besondren Waren hervorgehen, dadurch aufzuheben,daß man die Form des Geldes verändert ...“: „Es ist nötig, das klar einzusehen ...".367
IV. Postkapitalistische Geldpolitik
Im Gegensatz zu der vorab Marx unterstellten Sicht, der Zins sei nur Un- terform des Mehrwerts und die 'Macht des Geldes' nur Ausdruck einer kapita- listischen 'ökonomischen Praxis' sowie ihrer Macht- und Marktverhältnisse, versteht, was gezeigt wurde, die monetäre Zirkulativitätstheorie das bestehende Geldsystem, vor allem die damit Verbundene Option zur Geldhaltung, als die konstituierende Institution des Kapitalismus, welche die Marktverhältnisse erst schafft, von denen es "...abhängt, ob oder nicht, und zu welchem Grad ... Überschuß realisiert wird."368
Denn erst der aus der Befähigung zur Knapphaltung bzw. zur 'Indu- zierung' von Knappheit resultierende Kapitalcharakter des Geldes, und damit die Existenz von Geldkapital, sei maßgeblich für die aus ihrer (relativen) Knappheit resultierende Kapitaleigenschaft der Produktionsmittel, für deren Knappheit "... an sich keine Gründe"369 beständen, genauso wenig wie für die, in Folge ihrer Durchhaltekosten nicht knapphaltbaren, zur realwirtschaftlichen 'Kapitalbildung' notwendigen Güter und Waren:370
Somit ermögliche erst die Notwendigkeit einer durch Geld- bzw. Geldkapital vermittelten Schaffung der 'Verwirklichungsbedingungen der Arbeit' (in Form von 'Realkapitalbildung'), die Knapphaltung des Zugangs zu den 'Verwirklichungsbedingungen der Arbeit' und damit diejenige relative Knappheit der Produktionsmittel im Verhältnis zur Arbeit, die es gestattet, als Voraussetzung für die 'Verwirklichung der Arbeit', zugleich die 'Mehrarbeit' durchzusetzen, aus deren Erträgen der geforderte Geld(kapital)zins beglichen wird.
Und erst dieser Geldzins, als Ausdruck der Kapitaleigenschaft des Geldes, bewirke den (monetären) Krisenmechanismus, der ebenso beständig der Fähigkeit zur realwirtschaftlichen Realisierung des Geldzinses entgegenwirke, wie er, damit einhergehend, eine zunehmende Fehlallokation 'monetärer Kaufkraftkapaziät' zum Ausdruck bringe, und "... zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter."371
1. 'Carrying costs' für Geld: Freigeld
Die ökonomische 'Macht' zur Durchsetzung des Geldzinses resultiere allein aus der erforderlichen monetären Vermittlung des realwirtschaftlichen 'Reproduktionsprozesses', aus dem die Nachfrage nach Liquidität hervorgeht, einerseits, und der mangels Durchhaltekosten möglichen Knapphaltung dieser Vermittlung, des Angebots an Liquidität, andererseits. Damit begründe die Knapphaltung von Liquidität den Zins als Knappheitspreis von Liquidität.372
Sein Liquiditätsnutzen für den Austauschprozeß, verbunden mit den nicht vorhandenen Durchhaltekosten bzw. 'carrying costs', konstituiere dabei zugleich die systematische Überlegenheit des Geldes gegenüber den Waren - inklusive der Ware 'Arbeitskraft' - und Güter im realwirtschaftlichen 'Reproduktionsprozeß', die zum einen 'carrying costs' verursachen und i.d.R. zum anderen als Geldsurrogate ungeeignet sind:
Die Folge sei eine die Allientabilität übersteigende Akzeptabilität des Geldes, als Ausdruck seiner Nicht-Neutralität.373
Daraus abgeleitet resultiere notwendig eine monetäre Reform, die, in Analogie zu Keynes, darauf abzielt den Liquiditätsnutzen des Geldes zwar zu erhalten, zugleich aber mit Durchhaltekosten zu belasten, welche einen Negativ- Anreiz für die Zurückhaltung von Liquidität bewirken sollen. In Gesells Termino- logie komme es darauf an dem 'Angebotszwang' der Ware und der daraus abge- leiteten, vom 'Willen des Warenbesitzers' unabhängigen, 'Zwangsnachfrage nach Geld', einen 'Umlaufzwang' des Geldes und damit eine vom 'Willen des Geld- besitzers' unabhängige 'Zwangsnachfrage nach Waren' gegenüberzustellen, um Geld zu 'neutralisieren'.374 Populistisch:
"Um diesen Gedanken besser zu verstehen, ist es hilfreich, das Geld mit einem Eisenbahnwaggon zu vergleichen, der ebenso ...den Austausch von Gütern erleichtert. Auch hier bekommt der Benutzer für die Freigabe des Waggons am Zielort keine Prämie. Vielmehr wird er mit einer Standgebühr zur Kasse gebeten, wenn er den Waggon entlädt. Und dieses 'Standgeld' ist hoch genug, daß die meis- ten Benutzer den Waggon innerhalb kurzer Zeit abfertigen und damit anderen zur Nutzung überlassen. Das wäre im Grundsatz alles, was wir mit dem Geld tun müßten, um die negativen Folgen des Zinses zu vermeiden. Der jeweilige Benutzer bezahlt ... 'Standgeld' oder eine Nutzungsgebühr, wenn er das Geld länger behält, als für den Zweck des Austauschs erforderlich ist."375
Dies zu erreichen, ohne dabei der Rechenmittelfunktion des Geldes ent- gegenzuwirken, also die Instabilität der Währung hervorzurufen, erfordere eine Abkopplung der 'Wertentwicklung' des Zahlungsmittels von der Relation der Währungseinheit zu den Waren. Dadurch werde ermöglicht, die Nutzung von Liquidität (oder die Umnutzung von Geld als Anlagesurrogat) zu belasten, ohne zugleich die zu erreichende Bereitschaft zur Aufgabe von Liquidität, die Bereitstellung von Geld für realwirtschaftliche 'Transaktionszwecke' über den Erwerb von Geldforderungen, durch 'Wertverlust' unattraktiv zumachen, d.h.
"Kassenhaltung wird mit 'Durchhaltekosten' oder 'Bestandhaltekosten' belegt. Sonst nichts. Die Geldeinheit im Sinne eines Kaufkraftmaßstabes für Geldforderungen bleibt unangetastet."376
1.1. Das Konzept
Die Konzeption Gesells zur Schaffung von 'Freigeld' besteht darin, Banknoten als Zahlungsmittel mit einer 'Umlaufgebühr' in Höhe von 1 Promille pro Woche, also 5,2 Prozent im Jahr zu belasten, und dadurch das Geld entsprechend der Ware unter 'Angebotszwang zu setzen, so daß, während "bisher ... die Wirtschaft vom Geld abhängig" war, "jetzt sich das Geld ... der Wirtschaft anpassen, d.h. sich selbst anbieten"377 müsse:
"1. Das Freigeld wird in Zetteln von 1-5-10-100-1000 Mark ausgegeben. - Außer diesen festen Zetteln werden Kleingeldzettel ausgegeben, ... (Gleichzeitig dienen diese Kleingeldabrisse dazu, die Zahlkraft der festen Geldzettel durch überkleben der fälligen Wochenfelder auf dem Laufenden zu halten).
2. Das Freigeld verliert wöchentlich ein Tausendstel an Zahlkraft, und zwar auf Kosten der Inhaber. Durch Aufkleben von Abrissen hat der Inhaber die Zahlkraft der Zettel immer zu vervollständigen.
3. Am Ende des Jahres werden alle Geldscheine neu umgetauscht
5. Eine Einlösung dieses Papiergeldes von Seiten des Währungsamtes findet nicht statt."378
Insbesondere die relativ kurzfristigen 'Zahlungstermine' ermöglichen dabei eine 'Feinjustierung' des Anreizeffektes Liquidität bei fehlendem Bedarf unmittelbar weiterzugeben:
"... der Inhaber des Reformgeldes [erleidet] durch das Aufbewahren des Geldes einen Verlust, der im genauen Verhältnis zur Aufbewahrungsdauer wächst ... Wenn es also jemand z.B. einfallen würde, einen 100 Mk.-Zettel am 1. Januar einzuschließen, so würde er am Ende des Jahres nur mehr 94,80 Mk. vorfinden Ein anderer, der z.B. am 1. Juni einen Zettel ... annimmt und ihn En- de des Monats ... wieder ausgibt, verliert 40 Pfg. Gibt der Betreffende das Geld ... innerhalb derselben Woche ... aus, so verliert er garnichts".379
Infolge eines gleichmäßigen Anreizes zur 'Weitergabe' von Liquidität, kä- me es nicht zu 'plötzlichen' 'Geldschwemmen' vor einem Zahlungstermin und da- rauf hin wieder einsetzender Zurückhaltung, sondern zu einem stetigen Geldum- lauf bzw. einer beständigen Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Im Gegensatz zur bisher unzureichenden Möglichkeit einer Steuerung der nachfragewirksamen Gelmenge - als das für einen Zeitraum 'bestehende' Produkt von Geldbasis und Umlaufgeschwindigkeit380 befähige die so zu erreichende Konstanz der Umlaufgeschwindigkeit, eine 'Zentralbank' - nach Gesell 'Währungsamt' - zu einer unmittelbaren Kontrolle der Geldmenge, und deren Anpassung an den real- wirtschaftlichen 'Transaktionsbedarf':
Die 'Entwertung' des Zahlungsmittels ermöglicht erst die Stabilisierung des 'Rechenmittels', d.h. der Währung. Mit anderen Worten "'Freigeld' erhielt den fast diffamierenden Namen 'Schwundgeld', obwohl es im Grunde auf Stabili- sierung der Geldeinheit durch relative Abkopplung des Umlaufmittels hinausläuft."381
Insofern brauche die Zentralbank, zunächst ceteris paribus, nichts zu tun, außer im Umfang der Entwertung der Zahlungsmittel, neue Zahlungsmittel in Umlauf zu setzen. Sollte sich der realwirtschaftliche 'Transaktionsbedarf' verän- dern, so wäre dies - nach Gesell über die Orientierung an einem Großhandelsin- dex - unmittelbar durch Preisveränderungen ersichtlich. Zahlungsmittelüber- schüße würden durch die beständige Zahlungsmittel-'Entwertung', durch 'Abwar- ten', abgebaut, denn der "etwaige Überschuß verbraucht sich selbsttätig." Sofern das nicht ausreicht, könne "... durch Steuerzuschlag nachgeholfen werden. - Der Zweck läßt sich auch erreichen, indem daß Währungsamt Staatsschuldscheine kauft und verkauft."382 Zahlungsmitteldefizite werden durch Neuausgabe ausgeglichen.
Der 'Angebotszwang' von Geld bedeute dabei, neben der daraus folgen- den Konstanz der Umlaufgeschwindigkeit, zugleich eine 'feinjustierbare', kurz- fristige 'Marktreaktion' auf Entscheidungen der Zentralbank, indem er bewirke, daß durch die unvorteilhafte Zurückhaltbarkeit von Geld, Geldmengenentschei- dungen unmittelbar nachfrage- und damit preisniveau-wirksam werden:
"Wenn die Zügel eines Pferdes sich erst nach drei Monaten fühlbar machen, so ist ein solches Pferd unlenkbar ... Ist die Währung unlenkbar, zügellahm, dann fort mit ihr Das Freigeld ist ein empfindlicher Gaul."383
"Das Reichswährungsamt gibt Geld aus, wenn solches im Lande fehlt, und es zieht Geld ein, wenn im Lande sich ein Überschuß zeigt. Das ist alles"384
Somit könne erreicht werden, daß die Erhaltung der 'Kaufkraft' in Höhe des Nominalwertes des Zahlungsmittels, dem Inhaber zwar Kosten verursacht, jedoch, obgleich (bzw. weil) sich das Zahlungsmittel relativ zum Nominalwert ent- wertet, die Relation des Nominalwertes bzw. der Währungseinheit zu den Waren stabil bleibt:
"Nur wer Geld in der Tasche behält, verliert wöchentlich 1 Promille der Kaufkraft wer also sein 'Freigeld' in einen Geldanspruch auf Rückzahlung der gleichen Geldsumme verwandelt, vermeidet diesen Kaufkraftschwund ...: Während die Geldscheine ... künstlich inflationiert werden, bleibt die Währung (der Kaufkraft und Schuldmaßstab durchaus stabil. Die Währung bleibt um soviel stabiler, wie die Geldscheine relativ zu ihr an Kaufkraft einbüßen, sofern sie nicht bestempelt oder beklebt werden. Die Folge ... Es wird kostspielig, 'liquide' zu sein."385
1.2. Die Wirkung
Die so zu bewirkende Neutralität des Geldes bedinge, daß die Aufgabe von Liquidität für den Geldbesitzer den gleichen Grenznutzen bewirkt, den die Aufgabe von Liquidität gegenüber der Alternative zur Kassenhaltung bisher ermöglicht, nur sozusagen unter umgekehrten Vorzeichen: Bei 'Carrying Costs' für Kassenhaltung in Höhe des bisher erzielbaren Geldzinses, bleibt der relative Kaufkraftzuwachs durch Aufgabe von Liquidität in 'gleicher' Höhe bestehen, wirkt also gleichermaßen 'situationsverbessernd'. Die Veränderung besteht darin, daß in absoluten Kategorien der Nutzenzuwachs nicht mehr Kaufkraftzuwachs bedeutet, sondern 'Nicht-Kaufkraftverlust', also Kaufkrafterhalt bzw. Durchhaltekostenvermeidung.
Indem jedoch dadurch das 'gewinnmaximale' Verhalten des Geldbe- sitzers Zurückhaltung von Liquidität ausschließe, verschwinde letztendlich der durch Knapphaltung von Liquidität ermöglichte Geldzins. Solange noch 'Knappheit' besteht könne der Geldbesitzer jedoch noch einen Zins mit der An- lagealternative in diese noch bestehenden 'Knappheiten', z.B. an Produktions- miteln begründen:
"Wir sagten, daß das Geld ... darum Kapital ist, weil es den Warenaus- tausch unterbinden kann, und folgerichtig müssen wir nun auch sagen können, daß, wenn wir dem Geld durch die vorgeschlagene Umgestaltung die Fähigkeit nehmen, den Warenaustausch zu unterbrechen, das Geld ... kein Kapital mehr sein kann ..."386
"Im übrigen aber wird am Tage, an dem das ... Freigeld es übernimmt, den Austausch der Waren zu vermitteln, sich überhaupt nichts Nennenswertes in bezug auf den Zins ereignen. Der Zins der bestehenden Sachgüter (Realkapitalien) bleibt vorläufig unverändert. Und auch die neu hinzukommenden Sachgüter, die das Volk in nun ungehinderter Arbeit schaffen wird, werden Zins abwerfen. Sie werden allerdings auf den Zins drücken, und zwar in dem Maße wie ihre Menge wachsen wird Wenn aber die Realkapitalien noch Zins abwerfen, und man mit Geld Waren kaufen kann, die sich zu neuen Realkapitalien vereinigen lassen, die Zins abwerfen, so ist es klar, daß, wenn jemand ein Darlehen braucht, er dafür den gleiche Zins zahlen muß, den das Realkapital einbringt, ... nach dem Gesetze des Wettbewerbs.
Man wird also bei Gelddarlehen nicht darum Zins zahlen, weil das Geld den Waren eine Abgabe aufbürden kann, sondern weil die Nachfrage nach Darlehen vorläufig noch das Angebot übersteigt"387
Letztendlich bewirke aber die mit den 'carrying costs' entstehende Unmöglichkeit, Liquidität vorzuenthalten, daß " die Vermehrung von Realkapital so rasch sein würde, daß ein Nullgeldzinsfuß ... innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Zeit gerechtfertigt sein würde."388 Denn durch die man- gels monetär induzierter Knappheit mögliche "Vermehrung der Menge des Kapi- tals ..., bis es aufhört knapp zu sein",389 verlieren "... die Produktionsmittel ihre Kapitaleigenschaft",390 und damit der Geldbesitzer eine noch Zins begründende Anlagealternative:
"Der Zins der Sachgüter wird durch Nachfrage und Angebot bestimmt Er kann durch eine einfache Verschiebung im Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage beseitigt werden Der Zins der Sachgüter wurde bisher vor einert solchen Verschiebung geschützt, weil die Erzeugung von Sachkapital davon abhängig ist, das solche Güter Zins in Höhe des Urzinses erheben können." ... "Und eigentlich müßte man ganz davon abgehen, diese beiden so verschiedenen Dinge mit dem gleichen Worte Zins zu bezeichnen." ... "Mit dem Freigeld wird ... dieses Schröpfwerkzeug genommen. Es kann den Zins nicht mehr unter allen Umständen erpressen. Es erleidet das Schicksal der Arbeitsmittel, die auch nur solange Zins erheben können, wie das Angebot hinter der Nachfrage zurückbleibt. Fallt der Zins des Realkapitals auf Null, so ist auch das zinsfreie Gelddarlehen Tatsache."391
Für den kreditnehmenden 'Reproduzenten' folgt daraus, im Gegensatz zum Geldbesitzer, ein Grenznutzenzuwachs. Denn nach wie vor entstehen durch die Aufnahme von Liquidität zwar Liquiditätskosten in Form der mit der Aufgabe von Liquidität 'weitergereichten' Durchhaltekosten, jedoch entstehen diese Kosten nicht mehr in remanenter Form nach dem Gebrauch der Liquidität, weil die Hergabe von Zahlungsmitteln gegen Waren zugleich die Weitergabe der an den Besitz der Zahlungsmittel geknüpften Durchhaltekosten bedinge.392
Die durch 'carrying costs' für Geld zu erreichende Wirkung bestehe somit letztendlich darin, die Akzeptabilität und Allientabilität des Geldes 'anzugleichen' und dadurch die Neutralität von Geld zu bewirken, indem Geld nicht mehr 'an sich' Ertragsmöglichkeiten zuläßt, und sich somit allein durch seinen Nutzen in der 'Transaktionskasse' konstituiere, und nicht mehr, bedingt durch die Option zur Geldhaltung, in der 'Anlegerkasse'.
Damit komme es durch 'Freigeld' zur Realisierung des vorab - bezogen auf das bestehende Geldsystem - kritisierten 'Sayschen Theorems', weil der 'Angebotszwang des Geldes' letztendlich eine 'Zwangsnachfrage nach Waren' hervorrufe, und somit in "gleichem Rhytmus, wie die Einkommen bei der Herstellung des Marktangebotes entstehen, ... diese auch kaufend wieder auf dem Markt erscheinen."393
Zusammengefasst entstehe dadurch ein Zustand, der die Erträge von Austauschvorgängen, vor allem den 'transtemporalen', allein aus der relativen Knappheit ausgetauschter realwirtschaftlicher Leistungen herleitet, so daß "... die monetäre Verzerrung, die das Geld für das Marktgleichgewicht zwischen vorweg- genommener und aufgeschobener Nachfrage zugunsten der aufgeschobenen und zulasten der vorweggenommenen, mit sich bringt, beseitigt" werde:
"Beträgt der Zinssatz Null Prozent, dann leitet das Geld nur die Nachfrage nach Naturalleistungen weiter, ohne selbst einen Standard für die Rentabilität von Realkapitalien zu setzen: Dann konkurrieren trotz Einführung der Geldwirtschaft wieder die Naturalleistungen, als ob es kein Geld gebe. Das ist die Wirkung von Durchhaltekosten auf Liquidität:"394
2. Freigeldpraxis
Als möglicher Beleg der positiven Wirkung einer mit 'Carrying costs' für Geld zu erreichenden 'Neutralisierung' der Zurückhaltbarkeit seiner Liquiditäts- vorteile in der 'ökonomischen Praxis', werden in der Literatur wiederholt die soge- nannten 'Brakteaten' des Mittelalters, sozusagen als zufälliges 'Freigeld', sowie zwei bewußt aus dem Freigeldkonzept Gesells abgeleitete 'Freigeldexperimente' angesprochen, die zum Ende der zwanziger bzw. Beginn der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts in Form der 'Wära'-Tauschgesellschaft in Deutschland und des sogenannten 'Nothilfeprogramms von Wörgl' in Österreich durchgeführt wurden.395
2.1. Renovatio Monetarum: Freigeld by 'accident'
"Nach dem Untergang Roms war in Europa etwa achthundert Jahre lang ein wirtschaftlicher Stillstand eingetreten und eine neue Kulturblüte entfaltete sich erst wieder vom frühen Mittelalter an. Diesmal waren es nicht große Gold- und Silber- funde, sondern eine sozusagen zufällig eingeführte Umlaufsicherung, die dem Geldwesen eine völlig neue Wirkung verlieh. In der damaligen Zeit war es üblich, Münzen mit dem Bildnis des regierenden Herrschers zu prägen":396
Infolge wurden zunächst bei jedem Macht- bzw. Herrschaftswechsel die Münzen mit den Bildnissen der alten Herrscher zu einer Um- bzw. Neuprägung 'aufgerufen', die 'gebührenpflichtig' war und somit in Form des 'Schlagschatzes' dem neuen Herrscher zu 'Sondereinnahmen' verhalf:397
Um diese 'Sondereinnahmen zu erhöhen ließ der Erzbischof von Magdeburg, zugleich Schatzkanzler des Kaisers Friedrich I. Barbarossa, kurz nach seiner Ernennung 1152, unabhängig vom Machtwechsel, zweimal jährlich durch 'Münzverrufungen' und 'Münzerneuerungen' eine 'Renovatio Monetarum' durchführen.398
Für die Neuprägung der damals umlaufenden 'Dünnpfennige' bzw. 'Brakteaten', das sind "... großflächige Münzen aus dünnem Blech, welche mit einem Stempelschlag nur einseitig, in eine Unterlage aus Blei getrieben, auch nur einseitig ein Bild bekamen",399 wurde vom jeweiligen Inhaber eine Prägesteuer bzw. ein 'Schlagschatz' in Höhe von 25 Prozent, also jährlich 50 Prozent erhoben.400 Davon ausgehend jedoch, "... daß jede Münze im Durchschnitt mindestens zehn bis zwanzig mal im Jahr von Hand zu Hand ging" bedeutete das eine jährliche 'Geldumsatzsteuer' von maximal 5 Prozent:401 "Und da es sonst keinerlei Steuern gab, war die Belastung sehr gering."402
Das Verbreitungsgebiet der 'Brakteaten' "umfasste Norddeutschland bis an die Weser im Westen, im Norden bis an die Nord- und Ostsee. Das Kernland reichte bis Magdeburg, nach Thüringen und in den Harz, bis zur Mark Brandenburg und Meissen. Daran schlossen sich die Oberlausitz, Schlesien aber auch Polen und Böhmen an. Nach Süden ... nach Schwaben, Württemberg, ... zu den schweizerischen Städten Basel, Bern, St.Gallen und ... bis nach Wien".403 In ähnlicher Form gab es sie auch in England und Frankreich. Die Möglichkeit 'Sondersteuern' durch eine 'Renovatio Monetarum' zu erheben fand vielfach Nachahmer:
"Handelshäuser und Geldwechsler, Kaiser, Könige und Fürsten, Staaten, Städte, vor allem aber die geistlichen Herrscher hatten schnell erkannt, wie ungemein lukrativ das Geschäft der Münzprägung sein konnte. Der raffende Münzherr ... wurde zum Symbol des feudalistischen Zeitalters. Mit Münzverruf und Neuprägung ließen sich die Untertanen schröpfen."404
Als ein positiver Aspekt wird jedoch dieser 'Prägesteuer' zugeschrieben, zugleich die Unmöglichkeit bewirkt zu haben, das damalige Geld als Anlage- surrogat der Zirkulation zu entziehen. Dadurch "war ... ein rascher Geldumlauf gesichert".405 Denn der damalige Geldbesitzer mußte, um "... die Prägesteuer nicht als seinen Schaden zu tragen, hurtig seine Brakteaten weitergeben", wo- durch Sparen "... in Form von Leihdarlehensgabe" angeregt wurde. Ent- sprechend der abnehmenden relativen Knappheit von 'Leihkapital', "sank hierbei der Leihzins..., beziehungsweise entfiel einfach", so daß nur "... die Leihgabe fristgerecht in ... gleicher Kaufkraft zurückforderbar war."406
Einhergehend damit entstanden ansatzweise Verfahren zur Trennung des Zahlungsmittels von der Recheneinheit bzw. Währung, die auf den Umstand zurückführbar waren, daß ein absehbarer Umtauschtermin in einer Minderbewertung des Zahlungsmittels vorweggenommen wurde, deren Zunahme den zeitlichen Abstand bis zur 'Renovatio' zum Ausdruck brachte, während zugleich die Berechnungsgrundlage stabil blieb:
"Kaufpreise wurden daher in den Verträgen in 'Neuen Pfennigen' vereinbart, um auf diese Weise die Vertraglichen Forderungen und Rechte vom Schicksal des Geldes, das sich entwertete, abzukoppeln." 407
Allgemein sei diese 'Geldordnung' und die beständig hohe Umlaufge- schwindigkeit, die mit der fehlenden Möglichkeit Zahlungsmittel als Anlage- surrogate zu verwenden einherging, die Grundlage "... einer bis dahin unbekann- ten und seitdem nicht wiederholten Wirtschaftsblüte"408 gewesen. Durch die Un- möglichkeit, notwendigen Zuwachs an 'Sachinvestitionen' auch bei abnehmen- dem 'Rückfluß' durch die Zurückhaltung der 'Brakteaten' zu verhindern bzw. Realkapitalbildung durch die notwendige Ersparnisbildung über 'Leihdarlehens- gabe' maximal auch bis zu einem negativen 'Rückfluß' zu 'fördern', der den Nachteil der 'Prägesteuer' nicht überschreitet, sei dies vor allem die Grundlage eines erweiterten allgemeinen Reproduktionsniveaus und Lebensstandards ge- wesen, was zum Beispiel in Form relativ hoher durchsetzbarer Löhne, bei relativ kurzen Arbeitszeiten, der zunehmenden relativen Knappheit des 'Faktors' Arbeit entsprach:409
"Dieses Brakteatengeld war ein echtes Zwischenglied zwischen dem Angebot und dem Erwerb von Waren und hatte einen raschen und sicheren Warenabsatz zur Folge und damit einen entsprechenden Aufschwung aller produktiven Kräfte. Die Städte blühten auf und das Handwerk ging zu immer größerer Arbeitsteilung über Handwerker konnten es sich samt Gesellen und Lehrlingen leisten nur vier Tage in der Woche zu arbeiten Was zum leben notwendig war wurde leicht verdient, und es blieb genug Überfluß für Spitäler..."410
Das Ende dieser Zeit deutete sich an, "... als man von 1350 an hier und da wieder den ...'ewigen Pfennig' - auch Dickpfennig genannt - erzwang...".411 'Gesetzliches' Zahlungsmittel wurde der 'ewige Pfennig', als Kaiser Maximilian I. 1495, von der Kirche gefordert, das 'römische Recht' wieder einführte. Durch die Verdrängung der 'Renovatio Monetarum' und der Brakteaten durch den 'ewigen Pfennig' "... kam auch der 'Zinskauf' ... zurück und damit die Ausbeutung der arbeitenden Stände","... so dass zum Beispiel die Herzöge von Sachsen sich erlauben konnten, die Arbeitszeit ihrer murrenden Knappen ungestraft von 6 auf 8 Stunden heraufzusetzen":412 "Sofort mußten wieder Zinsen bezahlt werden, um das Geld hervorzulocken, und zwar bis zu 40%, und während Handwerk und Land- wirtschaft verkümmerten, breitete sich im Handel die Neigung zur Monopolbildung ... aus".413
2.2. Die Wära-Tauschgesellschaft
Einige hundert Jahre später kam es im Gegensatz zum zufälligen 'Frei- geldmechanismus' der 'Brakteaten' des frühen Mittelalters, zum Ende der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts zu einem geplanten 'geldtechnischen' Experiment: Zu Beginn der 'großen Weltwirtschaftskrise' wurde im Oktober 1929, initiiert durch Hans Timm und Helmut Rödiger, in Erfurt die Wära-Tauschgesell- schaft gegründet. Gründungszweck war laut Satzung die "...Bekämpfung von Absatzstockungen und Arbeitslosigkeit. Ihr Ziel ist die Erleichterung des Waren und Leistungsaustausches unter ihren Mitgliedern durch die Ausgabe von Tauschbons."414
Die Tauschbons wurden gegen Reichsmark, sonstige Devisen oder ge- gen bestimmte Sicherheiten an Firmen und Einzelpersonen in dazu eingerich- teten lokalen Wechselstuben ausgegeben, die sich "... unter anderen in Berlin, Bielefeld, Bonn, Chemnitz, Dortmund, Düsseldorf, Eisenach, Erfurt, Freiburg, Halle/S., Hamburg, Köln, Leipzig und Nürnberg"415 befanden. Nur in Ausnahme- fällen war ein 'Rücktausch' - mit 1 Prozent Disagio - in Reichsmark möglich. Prinzipiell war die Einlösung ausgeschlossen: Die Tauschbons wurden als 'Wära' bezeichnet. Ihre Stückelung erfolgte zu Nennwerten von ½, 1, 2, 5 und 10 'Wära'. Auf der Rückseite dieser 'Wära'-Scheine wurden 12 Monatsfelder bzw. 24 'Halb- monatsfelder aufgedruckt, auf die der jeweilige Inhaber eines Wära-Tauschbons im jeweiligen Monat eine Wertmarke, die in den lokalen Wechselstuben gekauft werden konnte, in Höhe von 1 Prozent des Nennwertes aufkleben mußte, sofern der Inhaber vermeiden wollte, das die Kaufkraft seines Zahlungsmittels den vollen Nennbetrag um entsprechend 1 Prozent unterschreitet. Vollbeklebte 'Wära' wurden am Jahresende umgetauscht:416
Damit wurde in Anlehnung an Gesells Freigeldkonzeption die vorsah, "...die Äquivalenz zwischen Geld und Ware durch die Herabsetzung des Geldes auf die Warenebene"417 zu erreichen, ein 'Angebotszwang' oder 'Umlaufantrieb' geschaffen - wenn auch mit jährlich 12 Prozent höher als von Gesell vorge- schlagen -, der die 'Wära'-Besitzer vor die Wahl stellte, zur Kostenminimierung entweder relativ schnell Waren nachzufragen, d.h. zu konsumieren oder weiter- zugeben, d.h. bei der 'Wära'-Bank zu hinterlegen (sparen) und damit Kredite zu ermöglichen oder auch im 'Wära-Finanzierungs-Konsortium' direkt anzulegen:418 "Aus dem Bestreben, die Entrichtung der Strafgebühr möglichst zu vermeiden, resultierte im Endeffekt der für alle Beteiligten vorteilhafte stetige Umlauf der Wära."419
Mit diesem Konzept entstand ein überregionaler Kreislauf, in dem die Reichsmark zunehmend durch 'Wära'-Scheine substituiert wurde. Zwei Jahre nach ihrer Gründung zählte die Tauschgesellschaft mehr als 1000 Firmen zu ihren Mitgliedern, die ihre Mitarbeiter anteilig in 'Wära' bezahlten und, ähnlich heutigen Hinweisen auf die Akzeptanz bestimmter Kreditkarten, durch ein Hinweisschild 'Hier wird Wära angenommen' gekennzeichnet waren:
Darunter "waren Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien, Molkereien, Res- taurants, Reformhäuser, Schlachtereien, Blumenläden, Friseursalons, Handar- beitsläden, Möbelgeschäfte, Elektrohändler, Fahrradgeschäfte, verschiedene Handwerksbetriebe, Druckereien, Buchhandlungen und Kohlehandlungen".420
" ... ganze Bergarbeiterorganisationen, die mit Wära Betriebe in Gang bringen wollten, Stadtverwaltungen wie Aurich u.a., Spargenossenschaften in Schleswig-Holsstein usw., ... in immer mehr Auslagen tauchte das Schild auf: 'Hier wird Wära angenommen'."421
Die relativ schnelle Verbreitung der 'Wära' sei dabei zum einen auf "... das allgemein schwindende Vertrauen in die wirtschaftspolitischen Fähigkeiten der Regierungen unter Müller und Brüning" zurückzuführen gewesen, sowie zum anderen auf "... den aus der Deflationspolitik ab 1930 resultierenden Kapital- mangel":422 "Reichsgeld war damals nicht einmal, wenn man ein Konto bei der Sparkasse oder bei der Bank hatte, von diesen Institutionen zu bekommen."423
Weitreichende Beachtung fand dieses Freigeldexperiment ab Herbst 1930, "als die Weltwirtschaft sich bereits mitten in einer großen Deflationskrise befand",424 durch eine 'Verdichtung' des Wärakreislaufes in der damals 500 Einwohner zählenden, niederbayerischen Gemeinde Schwanenkirchen und seinen Nachbargemeinden Hengersberg und Schöllnach, deren größter 'Arbeitgeber' bis 1927 ein Braunkohlebergwerk war:
Dieses Bergwerk kaufte 1930 ein Bergwerksingenieur namens Hebecker. Die Finanzierung erfolgte, mangels Alternativen, durch einen vom 'WäraFinanzierungs-Konsortium' bewilligten Kredit in Höhe von 50.000 'Wära'. Die zunächst wiederbeschäftigten sechzig Bergleute erhielten 10 Prozent ihres Lohnes in Reichsmark und 90 Prozent in 'Wära'.425
Problematisch war zwar zunächst die fehlende Akzeptanz der 'Wära' als Zahlungsmittel bei den Geschäftsleuten der Region. Die Werkskantine wurde je- doch durch 'Wära'-Mitgliedsfirmen mit Waren beliefert. Dadurch waren die 'Wära'- Löhne insofern 'gedeckt', als daß sie Kaufkraft besaßen und z.B. gegen Lebens- mittel eingelöst werden konnten: Für die umliegenden Geschäfte bestand letzt- endlich die Wahl, wenig bzw. keinen Umsatz zu machen oder am 'Wära'- Kreislauf zu partizipieren, also durch die Verpflichtung auch 'Wära' anzunehmen, das Recht zu erlangen mit eingenommener 'Wära' bei 'Wära'-Mitgliedsfirmen Waren einzukaufen, so daß "die Händler ... begannen, das ungewöhnliche Geld zu akzeptieren".426 Der, infolge daraus resultierender Multiplikatoreffekte, "... mitten in der Krise erstaunliche wirtschaftliche Aufschwung in Schwanenkirchen ... verhalf der Tauschgesellschaft zum Durchbruch" 427 als überregionales Selsthilfenetzwerk:
"Während die Massen von Arbeitslosen andernorts große Not zu leiden hatten, kam die lokale Wirtschaft in Schwankirchen, Hengersberg und Schöllnach wieder in Gang. Alsbald war die Rede von der 'Wära-Insel im Bayrischen Wald', wo die Arbeitslosigkeit gebannt war und wo die umlaufgesicherten Wära-Scheine einen stetigen Absatz der Waren vermittelten."428
Sein Ende fand dieses Freigeldexperiment im Jahre 1931 durch die von der Regierung Brüning erlassene 'Verordnung zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen', auf die berufend der Reichsfinanzminister Dietrich ein Verbot der 'Herstellung, Ausgabe, Weitergabe und Annahme von Notgeld' erließ:429
"Der Erfolg der Wära weckte ... den Argwohn der Deutschen Reichsbank. Sie mußte befürchten, daß durch eine weitere Verbreitung der Wära zugleich die Reichsmark ... verdrängt wurde. Dem Interesse der Deutschen Reichsbank an der Wahrung ihres Ansehens kam es deshalb sehr gelegen daß ... §1, Abs.3 dieser Verordnung bestimmte, daß auch die Wära-Scheine als Notgeld anzusehen seien; damit waren auch sie von diesem Verbot betroffen."430
2.3. Das Nothilfeprogramm von Wörgl
Im Gegensatz zum Charakter einer 'privat' organisierten, 'netzwerkähnli- chen', überregionalen Selbsthilfeorganisation, war die 1932 begonnene Nothilfe- aktion der 'Marktgemeinde' Wörgl in Österreich, ausgelöst durch den sozialdemo- kratischen Bürgermeister Unterguggenberger, eine kommunale Selbsthilfe- aktion.431
Die Gemeinde zählte damals 4.200 Einwohner, davon waren - "... im Zuge der internationalen Deflationskrise bis zum Frühjahr 1932"432 - 400 arbeitslos. In der näheren Umgebung gab es weitere 1.500 Arbeitslose. So entließ zu Beispiel eine Zellulosefabrik 400 Arbeiter; weitere 300 Arbeiter eines Heizhauses der Bundesbahnen wurden entlassen. Darüber hinaus kam es auch in einer Sandziegelfabrik und in zwei Sägewerken zu Entlassungen.433
Die Verschuldung der Gemeinde betrug 1.350.000 Schilling und führte nach einer Diskontsatzerhöhung der Österreichischen Nationalbank von 7 auf 10 Prozent zu einer jährlichen Zinslast von 175.000 Schillling. Demgegenüber gingen - während schon ein Rückstand der Gemeindesteuereinnahmen in Höhe von 118.000 Schilling bestand -434 "... die Steuereinnahmen der Gemeinde rapi- de zurück - im ersten Halbjahr 1932 konnte sie ganze 3.000 Schilling an Steuern einnehmen ! - ... ihre finanzielle Situation nahm katastrophale Ausmaße an."435
Insbesondere um der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken legte Untergug- genberger dem Wohlfartsausschuß und dem Gemeinderat ein 'Nothilfe- Programm' vor, das am 5. bzw. 8.7.1932 einstimmig mit folgendem Inhalt beschlossen wurde:
"Langsamer Geldumlauf ist die Hauptursache der bestehenden Wirtschafts- lähmung. Das Geld als Tauschmittel entgleitet immer mehr den Händen der schaffenden Menschen ... Jede Geldstauung bewirkt Warenstauung und Arbeitslosigkeit ... Das träge und langsam umlaufende Geld der Nationalbank muß im Bereich der Gemeinde Wörgl durch ein Umlaufmittel ersetzt werden, welches seiner Bestimmung als Tauschmittel besser nachkommen wird als das übliche Geld. Es sollen 'Arbeitswertbestätigungen' in drei Nennwerten zu 1, 5 und 10 Schilling aus- gegeben werden ... Um das wirtschaftliche Leben in der Gemeinde wieder aufwärts zu bringen, sollen auch nach einem noch zu bestimmenden Plane öffentliche Arbeiten damit durchgeführt werden."436
Anfang Juli 1932 ließ der Wohlfartsausschuß im Nennwert von 32.000 Schilling Arbeitswertscheine drucken. Die 'Umlaufgebühr' wurde in gleicher Höhe und Weise gestaltet, wie die der Wära-Tauschgesellschaft. 'Gedeckt' wurden ausgegebene Arbeitswertscheine durch Schillingeinzahlungen in entsprechender Höhe auf ein Konto der Raiffeisenkasse. Der Umtausch in Nationalbankgeld war zu einem Disagio von 2 Prozent jederzeit möglich.437
Der Umlauf der Arbeitswertscheine begann Ende Juli 1932 durch die Auszahlung von Löhnen und Gehältern der Gemeindebediensteten zu 50, später 75 Prozent in 'Notgeld'.438 Der 'Angebotszwang' der Arbeitswertscheine bewirkte "... eine derart hohe Umlaufgeschwindigkeit, daß es nicht erforderlich war, mehr als etwa S 12.600,- in Umlauf zu setzen".439 In diesen 'Notgeld'-Kreislauf waren neben der Gemeindekasse und den öffentlich Bediensteten auch die örtliche 'Raiffeisen Spar- und Darlehenskasse' und die örtlichen Kaufleute integriert, so daß "... in Wörgl neben der österreichischen Landeswährung allmählich ein eigenständiger Kreislauf des kommunalen Ersatzgeldes"440 entstand, was den finanz- und sozialpolitischen Handlungsspielraum der Gemeinde erweiterte:
"Wider Erwarten ist das Freigeld auch von den ortsansässigen Kaufleuten anstandslos angenommen worden. Es ergab sich eine spürbare Umsatzbelebung verbunden mit einer Erhöhung der Zahlungsfähigkeit bei den Gewerbetreibenden. Im zweiten Halbjahr 1932 konnten dank des umlaufgesicherten Geldes die Steuerrückstände an Gemeindeabgaben um 67,3 Prozent vermindert werden. Vereinzelt wurden sogar Steuervorauszahlungen geleistet. Die Finanzlage der Ge- meinde Wörgl verbesserte sich so innerhalb kurzer Zeit erheblich. Dieser Umstand erlaubte die planmäßige, zeitgerechte Erledigung und Entlohnung der Auftragsarbeiten ..."441
Diese aus Steuereinnahmen - ergänzt um einen Kredit des Bundes von
12.000 Schilling - finanzierten 'Auftragsarbeiten' in einem Umfang von mehr als 100.000 Schilling, umfaßten den Bau von Straßen und Beleuchtungen, Kanalisie- rungen, den Bau einer 'großen Skisprungschanze' und weiteres mehr.442 Die Löhne wurden weiterhin ausschließlich in Arbeitswertscheinen gezahlt. Die In- vestitionsausgaben der Gemeinde erhöhten sich 1932 gegenüber dem Vorjahr um 219 Prozent. Weitere 'freigeldfinanzierte' 'Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen' in einem Gegenwert von etwa 80.000 Schilling begannen im März 1933.443 Während in Österreich von August 1932 bis August 1933 die Anzahl der Arbeits- losen von 468.000 auf 557.000 (bei damals rund 6 Millionen Einwohnern), also um 19 Prozent anstieg, sank sie im gleichen Zeitraum in der Gemeinde Wörgl um 25 Prozent.444
Zum Ende des Jahres 1932 schloß sich die 3.000 Einwohner zählende "ebenfalls stark industrielle Gemeinde"445 Kirchbichl dem Freigeldprojekt der Gemeinde Wörgl an. Die jeweils ausgegebenen 'Arbeitswertscheine' waren zwischen den Gemeinden 'konvertibel'. Die Ausgabe von 'Freigeld' beschlossen auch die zusammen 16.000 Einwohner umfassenden Tiroler Gemeinden Hopfengarten, Brixen und Westendorf:
"Vorbereitungen für die Ausgabe dieses Ersatzgeldes liefen außerdem in Liezen (Steiermark), Linz (Oberösterreich), St.Pölten (Niederösterreich) und Lilienfeld ... Im Juni hielt Michael Unterguggenberger ... einen Vortrag vor 170 österreichischen Bürgermeistern. Sie hatten alle die Absicht, ... auch in ihren Städten und Gemeinden dieses Freigeld einzuführen."446
Mit dem Verweis auf daß Notenmonopol der Nationalbank wurde jedoch dem Freigeldexperiment von Wörgl und seiner Ausweitung auf andere Ge- meinden, durch ein vom Bundeskanzleramt gefordertes und von der Tiroler Landesregierung erlassenes Verbot vom 5.1.1933 ein Ende bereitet. Am 15.9.1933 mußten die Arbeitswertscheine aus dem Verkehr gezogen werden:447
"Die Verbotserfassung der Bezirkshauptmannschaft Kufstein, die von den Wörgler Gemeindevertretern auf dem Instanzenweg noch mehrfach angefochten worden ist, wurde zuletzt am 18. November 1933 vom Verwaltungsgerichtshof in Wien bestätigt."448
V. Kritisches Resümee
Eine grundsätzliche, systematische Kritik insbesondere der in dieser Ar- beit erörterten monetären 'Kapitaldeutung', durch den hier 'profilierten' zirkulativi- tätstheoretischen Ansatz und dessen geldpolitische Ausrichtung, ginge ebenso über den Umfang dieser Arbeit hinaus, wie eine substanzielle Klärung der Marx unterstellten Inkonsistenz. Deshalb sollen abschließend nur einige der Aspekte aufgegriffen werden, die in der dargestellten Kritik und Poltik als offene Fragen und als widersprüchlich erscheinen.
Insbesondere die in der zirkulativitätstheoretischen Literatur diskutierten, und hier vorab dargestellten Praxisbeispiele, die den geldpolitischen Ansatz stützen sollen, stehen z.T. im Widerspruch zu zirkulativitätstheoretischen 'Erkenntnissen':
Wenn die Freigeldexperimente der Wära-Tauschgesellschaft und der Gemeinde Wörgl eine Belastung von Liquidität mit 12 Prozent jährlich als funk- tional erachteten, dann stellt das zunächst die Gesell'sche Konzeption und Analy- se insofern in Frage, als daß die von Gesell postulierten 5,2 Prozent Durch- haltekosten nicht willkürlich gesetzt wurden, sondern als der durch Freigeld zu neutralisierende, historisch stets gleichbleibende oder nur leicht schwankende 'Urzins' dargelegt wurde, der die Überlegenheit zur Ware 'quantifiziere' und der, was gezeigt wurde, als 'Preis der 'Nicht-Neutralität' aus den 'Grenznachteilen' alternativer Tauschformen herrühre.
Infolge hätten entweder die dargestellten Experimente auf Dauer Scheitern müßen, weil bei einem analysierten 'Urzins' von 5 Prozent und Durchhaltekosten von 12 Prozent, die Allientabilität des 'Freigeldes' weit über seiner Akzeptabilität läge, und das 'Freigeld' somit sowohl nicht-neutral wäre, als auch, in Folge mangelnder Akzeptabilität 'instabil' und unbrauchbar für den Austauschprozeß, oder die Gesell'sche Analyse des Urzinses und seiner Höhe fußte auf einer Grundlage, die allein zur Erklärung nicht ausreicht.
Gestützt wird dieser Kritikpunkt noch durch die in der Literatur erwähnte - fast als 'goldenes Zeitaler' 'gepriesene' - Zeit der Brakteaten und ihrem 'Schlag- schatz' von 50 Prozent jährlich. Besonders aber die ebenfalls zur Darlegung der Notwendigkeit von Durchhaltekosten erwähnten, regelmäßig weit über einen 'Ur- zins' hinausgehenden Zinsen, nach der Einführung des sogenannten 'Dickpfen- nigs' lassen Zweifel an der 'Erklärungsreichweite' des Gessel'schen 'Grenznach- teils'-Ansatzes zur Bestimmung der Zinshöhe und der Herleitung des „Überlegen- heitsgrades“ zur Ware aufkommen. Denn seine alleinige Gültigkeit hätte zu 'sehr niedrigen' Zinsen im Mittelalter, auch nach der Einführung des 'Dickpfennigs' führen müssen, weil sich die zu derzeit noch relativ weit verbreitete 'Natural- tauschwirtschaft' in einen relativ geringen 'Grenznachteil' der Nicht-Benutzung von Geld, und damit in niedrigen Zinsen hätte ausdrücken müßen.
Ergänzt um die, von Gesell und der monetären Zirkulativitätstheorie zu- gleich betonte 'sozialökonomische Differenzierung' des Geldnutzens, die Kon- zentration monetärer Liquidität in 'Kassen ohne Bedarf', die erst es erlaubt Darlehen zu geben, könnte eventuel aus einem gewissen Monopolisierungsgrad der Möglichkeit, die Abhängigkeit der Reproduzenten vom Geld zu vermarkten, auf eine bestimmte Zinshöhe geschlossen werden. Dann aber müßte mit zu- nehmender - auch von der Zirkulativitätstheorie betonten - Monopolisierung des Geldkapitals, und bei zugleich heutzutage zunehmender Abhängigkeit der Repro- duzenten, von einem monetär vermittelten Leistungsaustausch, der 'Urzins' be- ständig steigen, und nicht, wie Gesell glaubt, gleichbleiben.
Darüber hinaus bedingt dieser Ansatz wiederum Zweifel an der Ausrich- tung des 'Freigeldkonzepts. Ist der Vorteil des Geldes gegenüber den Waren, be- sonders der Ware 'Arbeitskraft', sowohl bestimmt durch die unbedeutenden Durchhaltekosten, als auch durch den Liquiditätsvorteil für den realwirtschaft- lichen 'Transaktionsprozeß', und gestattet es gerade nur der nicht vorhandene Transaktionsbedarf des Geldbesitzers den Transaktionsbedarf der Reprodu- zenten zu vermarkten, dann verbleibt unabhängig von den Durchhaltekosten für Geld, systematisch die soziale bzw. sozialökonomische Überlegenheit des Geld- besitzers bestehen, keine realen Bedürfnisse mehr zu haben und deshalb Kre- ditgeber sein zu können:
Das bedeutet aber, sinngemäß nach Gesell, auch mit Freigeld: Der Reproduzent kann nicht warten. Für den Kreditgeber aber besteht mangels Reproduktionsbedarf, nach wie vor "... Freiheit von der Zeit bei der Nachfrage":
Somit vernachlässigt das Freigeldkonzept, indem es die Möglichkeit Liquidität vorzuenthalten, das "... Vorrecht, vom Markte fernbleiben zu können", und die Möglichkeit sich "... diese Freiheit bezahlen zu lassen"449 entgegen der eigenen 'sozialökonomischen Differenzierung', ausschließlich aus der "... Beschaffenheit des herkömmlichen Geldes"450 ableitet, genau diejenige fundamentale Polarisation, deren 'Egalisierung' wesentlicher Bestandteil der Inkonsistenzkritik an der Marx'schen Kapitaltheorie ist:
Solange der Grenznachteil durch 'carrying costs' für den Kreditgeber, mangels Reproduktionsbedarf - und nur deshalb kann er Kreditgeber sein - gerin- ger ist, als der Grenznachteil des Reproduzenten, aufgrund nicht befriedigten 'Reproduktionsbedarf, kann der Kreditgeber diese Differenz 'vermarkten'. In Analogie zur Neutralitätsanalyse heißt das: Um diese Differenz kann ein Über- schußbesitzer auch ohne Geld, Überschüsse 'länger' Knapphalten, als der Reproduzent warten kann.
Unter diesem Aspekt sind auch die vorgeblich erfolgreichen Praxisversuche mit Freigeld neu zu bewerten, deren Teilnehmer vornehmlich Reproduzenten waren, deren Geldnutzen sich vor allem durch ihren 'Transaktionsbedarf' konstituiert, und somit der Einfluß einer sozialökonomischebn Differenzierung oder Abhängigkeit nicht gezeigt werden konnte.
Zudem scheinen die Freigeldexperimente eher die 'andere Zirkulativitätstheorie', die 'Theory of Free Banking' zu bestätigen. Vor allem deshalb, weil das ausgegebene 'Freigeld' sich nicht durch ein Notenmonopol auszeichnete, sondern als Zahlungsmittelkonkurrenz partiell die relativ 'ungeeigneten' staatlichen Zahlungsmittel verdrängte.
Mit der 'Free Banking' - Schule läßt sich zudem als weiterer Kritikpunkt, die nach wie vor mögliche Inflationierung und Deflationierung von 'Freigeld' an- führen, die zwar durch ein vorgeblich verbessertes Instrumentarium leichter ver- hindert werden könne, deren Vermeidung jedoch nicht systemimmanent möglich ist, sondern nur durch (exogene) Entscheidungen, die falsch sein können.
Darüber hinaus verwirft die monetäre Zirkulativitätstheorie mit ihrer geld- und zinstheoretischen Kritik zwar wesentliche klassisch-neoklassische 'Eckpfei- ler'. Insbesondere die eindimensional-monetäre Orientierung ihrer 'Politikvor- schläge', und insbesondere das von Gesell angestrebte, ausschließlich monetär 'erweiterte' 'Manchestersystem', läßt aber den Schluß zu, daß hier eine Wirkung des Marktmechanismus vermutet wird, die implizit klassisch-neoklassische Prämissen vorraussetzt:
Die für diese 'klassisch-neoklassische' vollkommene Konkurrenz not- wendig vorausgesetzte vollkommene Information steht jedoch im Widerspruch zu den thematisierten Vorzügen der 'Einführung von Geld, Transaktions- uns vor allem Informationskosten zu reduzieren, und der daraus abgeleiteten Motivation das Geldsystem zur Erleichterung des realwirtschaftlichen Transaktionsbedarfs zu verbessern.
Geht damit jedoch die Zirkulativitätstheorie von unvollkommenen Infor- mationen aus, so ist auch die allein (!) monetäre Deutung ökonomischer Krisen nicht haltbar. Insbesondere wird damit vernachlässigt, daß dann positive Mengenveränderungen der Nachfrage, ausgedrückt in durch Knappheits- erscheinungen bewirkte steigende Preise, nicht nur eine entsprechende Mengen- anpassung des Angebots hervorrufen, sondern auch eine - auf eine Marktre- aktion der Nachfrage folgende - 'Überreaktion' des Angebots bedeuten können: Damit betritt sozusagen ein realwirtschaftlicher Akzelleratoreffekt den Markt.
Zudem vernachlässigt die rein monetäre Analyse, daß, unabhängig von der 'monetären Begleitung', auch bei Einführung von 'Freigeld', ein Marktmecha- nismus einzelwirtschaftliche Dispositionen verlangt, die letztendlich Zeitpräferenz erzwingen:
Insbesondere die Notwendigkeit unter Konkurrenten kokurrenz-fähig zu sein, erzwingt produktiver zu sein. Das aber ist vor allem eine Funktion bezogen auf die Zeit. Nämlich über produktivere Produktion, bei zunächst gleichen Output- größen, früher mehr zu desinvestieren, und dadurch schneller, auf höherem tech- nischem Niveau zu investieren als die Konkurrenz. Das aber erzwingt auch bei Umsetzung eines 'Freigeldkonzepts, eine Präferenz nach gegenwärtigen Er- trägen und eine Unterbewertung zukünftiger Erträge, die bei Ausscheiden aus dem Markt, infolge mangelnder Konkurrenzfähigkeit wegen unzureichender, für Produktivitätssteigerungen nutzbarer, gegenwärtiger Erträge, nicht erzielbar wären.
Indem somit notwendig, unter Konkurrenzbedingungen, ein tendenzieller 'Nachfrageüberhang' nach gegenwärtigen Erträgen besteht, die erst zukünftige Erträge ermöglichen, verbleibt auch ein Preis für die Zeit - und eine systema- tische Überlegenheit gegenwärtiger 'Überschußbesitzer', die sich als potentielle Kreditgeber die Gegenwartspräferenz der Kreditnehmer bezahlen lassen: Damit aber entsteht auch ein nicht monetär-induzierter Zwang zur Investiven Verwendung von Überschüssen, und eine damit einhergehende Notwendigkeit zur realwirtschaftlichen Expansion.
Zugleich ist der unter Konkurrenzbedingungen beständige Zwang zur Produktivkraftsteigerung, die marktwirtschaftliche Antwort auf den, eine quantitative Erwieterung von Konsumptionszielen begrenzenden, 'steil ansteigenden' Grenzaufwand des Arbeitseinsatzes, der, der Zirkulativitätstheorie folgend, den Ressourcenverbrauch zur Bedürfnisbefriedigung in einer vom Kapitalismus 'befreiten' Marktwirtschaft, durch eine systemimmanente negative Rückkopplung der Produktion mit der Nachfrage, 'natürlich begrenze.
Aus einem realwirtschaftlichen Akzellerator, sowie aus dem Zwang zur Produktivitätssteigerung ließe sich letztendlich ein eigenständiger, nicht monetär induzierter, realwirtschaftlicher Konjunktur- und Krisenmechanismus ableiten, insbesondere auch ein ökologischer Krisenmechanismus, ebenso wie aus der reinen Existenz eines gegenwärtigen realwirtschaftlichen 'Überschußes' die Überlegenheit des 'Überschußbesitzers' gegenüber kreditnehmenden Repro- duzenten gezeigt werden könnte. Das deutet zwar die nicht hinreichende Politik- konzeption von 'Freigeld' an, widerspricht damit aber nicht der Notwendigkeit einer monetären Reform.
Literaturverzeichnis
Bartsch, Günter (1989): Silvio Gesell, die Physiokratie und die Anarchisten, in: Schmitt, Klaus (Hg.): Silvio Gesell - "Marx" der Anarchisten? Berlin 1989, S. 11-32.
Beckerath, Ulrich v. (1989): Zur Lage, in: Monetary Freedom Network Rundbrief Nr. 2 /1989, S. 3-7.
Binn, Felix G. (1976): Grenzen der Marktwirtschaft, Hamburg
Binn, Felix G. (1976a), Konsequenter Monetarismus, Hamburg
Binn, Felix G. (1978): Keynes passé? - Vivat Friedmann?, Hamburg
Binn, Felix G. (1983): Die Rolle des Kapitals bei der Wirtschaftswachstums und Umweltproblematik, in: Onken, Werner (Hg.): Perspektiven einer ökologischen Ökonomie, Hannover 1983, S. 29-42
Binn, Felix G. (1983a): Arbeit - Geldordnung - Staatsfinanzen, Hannover
Columbus, Christoph (1503): Brief aus Jamaica, Auszug in: MEW 23, Berlin 1962, S. 145
Creutz, Helmut (1984): Die fatale Rolle des Zinses im gegenwärtigen Wirtschafts- system, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 61/1984, S.3-30
Creutz, Helmut (1986): Wachstum bis zur Selbstzerstörung, in: Creutz, Helmut/ Suhr, Dieter, Onken, Werner: Wachstum bis zur Krise, Berlin 1986, S. 7-40
Creutz, Helmut (1987): Die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 74/1987, S. 3-15
Creutz, Helmut (1990):Die Dritte Welt wird immer ärmer, in: Zeitschrift für Sozial- ökonomie 86/1990, S.3-20
Creutz, Helmut (1991):in: Führt eine Zinssenkung durch umlaufgesichertes Geld zu mehr Wachstum?, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 89/1991, S. 14-24
Creutz, Helmut (1992): Gerechtes Geld - Gerechte Welt, in: Onken, Werner (Hg.), Gerechtes Geld - Gerechte Welt, Lütjenburg 1992, S.12-33
Damaschke, Adolf (1922)13: Geschichte der Nationalökonomie. Bd, 1, Jena.
Dillard, Dudley D.(1935): Proudhon, Gesell and Keynes, Diss. Univ. of California
Doerner, Hans/Onken, Werner (1985): An der Wende von einer mechanistischen zu einer ganzheitlichen Ökonomie, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 67/1985, S. 18-30
Engels, Friedrich (1894): Herrn Eugen Dührings Unwälzung der Wissenschaft, in: MEW 20, Berlin 1968
Engels, Friedrich (1966): Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, Frankfurt
Felderer, B./Homburg, St. (1989)4: Makroökonomik und neue Makroökonomik, Berlin/Heidelberg/ NewYork/London/ Paris/Tokyo.
Fisher, Irving (1933): Stamp Scrip, New York
Führer, Silvia (1988): Das Kolloquium "Geld", in: Zeitschrift für Sozialökonomie 78/1988, S. 17-23 .
Führer, Hans-Joachim/Onken, Werner (1986): Abschied vom homo oeconomicus in: Zeitschrift für Sozialökonomie 69/1986, S. 15-22
Gesell, Silvio (1984)10: Die natürliche Wirtschaftsordnung. Durch Freiland und Freigeld, Lauf bei Nürnberg.
Gesell, Silvio (1891), , in: Gesell, Silvio: Gesammelte Werke Bd.1, Hannover 1988, S. 69-152
Gesell, Silvio (1892), Nervus rerum, in: Gesell, Silvio: Gesammelte Werke Bd.1, Hannover 1988, S.153-258
Gesell, Silvio (1906), Die Verwirklichung des Rechts auf den vollen Arbeitsertrag, in: Gesell, Silvio: Gesammelte Werke Bd.4, Lütjenburg 1989, S. 13- 297
Godschalk, Hugo (1986): Die geldlose Wirtschaft. Vom Tempeltausch bis zum Barter-Club, Berlin.
Greco, Thomas H.(1989): Geld und Schulden, in: Monetary Freedom Network Rundbrief Nr. 5 /1989, S. 3-20
Grimmiger, Michael (1989): Keynesianismus und Freiwirtschaft, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 80/1989, S. 3-10
Grimmiger, Michael (1990): Konzentrationsgrad und Wettbewerbsintensität in der Bundesrepublik (II), in: Zeitschrift für Sozialökonomie 87/1990, S. 13- 21
Helms, Hans G.(1966): Die Ideologie der anonymen Gesellschaft, Köln
Herr, Hansjörg (1987): Einige kritische Thesen zu Silvio Gesells Freiwirtschafts- lehre aus Keynesscher Sicht, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 73/1987, S. 10-14
Hüwe, Josef (o.J.): Der "unbekannte" Marx, Kapitalismus als Folge des Geld- systems, (wahrscheinlich Berlin, wahrscheinlich nach 1987)
Jenetzky, Johannis (1991): Die Knappheit des Kapitals oder warum die Zinssätze nicht fallen, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 91/1991, S. 3-13
Kennedy, Magrit (1991): Geld ohne Zinsen und Inflation, München
Keynes, John Maynard (1936): Allgemeine Theorie der Beshäftigung, des Zinses und des Geldes, Berlin
Klönne, Arno (1992): Marktwirtschaft ohne Kapitalismus?, in: Onken, Werner (Hg.): Gerechtes Geld-Gerechte Welt, Lütjenburg 1992, S. 126-133
Krause, Julius (1990): Zur Ökologie in der Marxistischen Theorie, Seminararbeit, Freie Universität Berlin
Lancaster, Kevin (1983)2: Moderne Mikroökonomie, Frankfurt/New York. Landauer, Gustav (1978): Aufruf zum Sozialismus, Hilversum
Löhr, Dirk (1988):Zins und Wirtschaftswachstum, in: Zeitschrift für Sozial- ökonomie 79/1988, 3-14
Löhr, Dirk (1992): Geld, Wachstumszwang und Umweltschutz, in: Onken, Werner (Hg.) Gerechtes Geld - Gerechte Welt, Lütjenburg S. 67-78.
Marx, Karl (1857/58): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953 Marx, Karl (1859): Zur Kritik der Politischen Oekonomie, in: MEW 13, Berlin 1969 Marx, Karl (1862/63): Theorien über den Mehrwert, MEW 26.3, Berlin 1968 Marx, Karl (1890): Das Kapital Bd. 1 in: MEW 23, Berlin 1963 Marx, Karl (1894): Das Kapital Bd. 3 in: MEW 25, Berlin 1964 Mill, J.St. (1924): Grundsätze der politischen Ökonomie, Bd. 2, Jena
Millhaud (1989): Moyen de paiement de caractère compensatoire (Auszug), in Monetary Freedom Network Rundbrief Nr. 2 /1989, S. 30-31
Mühsam, Erich (1989): Ein Wegbahner, in: Schmitt, Klaus: Silvio Gesell-"Marx" der Anarchisten?, Berlin 1989, S. 297-299.
Müller, (1985): Wo das Geld regiert, Berlin
Muralt, Alex v. (1989): Der Wörgler Versuch mit Schwundgeld, in: Schmitt, Klaus: Silvio Gesell-"Marx" der Anarchisten?, Berlin 1989, S. 275-288
Onken, Werner (1983): Ein vergessenes Kapitel der Wirtschaftsgeschichte - Schwanenkirchen, Wörgl und andere Freigeldexperimente in: Zeitschrift für Sozialökonomie
Onken, Werner (1986): Ein vergessenes Kapitel der Wirtschaftsgeschichte, in: Creutz, Helmut/Suhr, Dieter./Onken, Werner.,Wachstum bis zur Krise?, Berlin 1986
Onken, Werner (o.J.) Karl Marx und Silvio Gesell, Osnabrück (ca. 1975) Oppenheimer, Franz (1913): Die soziale Frage und der Sozialismus, Jena Otani, Yoshito (1981):2 Untergang eines Mythos, Neu-Ulm Parsons, Talcot (1967): Sociological Theory and Modern Society, New York
Julius Krause - Grundrisse einer monetären Zirkulativitätstheorie - Seite 100
Pischke, (1978): in: Pischke, J.D. v./Adams, Dale W./Donald, Gordon: Rural financial Markets, Baltimore
Proudhon, Pierre J. (1973): Ausgewählte Schriften Bd.3, Aalen Riese, Hajo (1986): Theorie der Inflation, Tübingen
Riese, Hajo (1987): Aspekte eines monetären Keynesianismus-Kritik und Gegen- entwurf, Marburg
Rose, (1984): Grundlagen der Wachstumstheorie, Göttingen
Rosenbohm, Elimar (1989): Grenzenloses Geld für wenige oder Leben für alle in den Grenzen des Wachstums (I) , in: Zeitschrift für Sozialökonomie 83/1989, S.3-11
Rosenbohm, Elimar (1991): vom Kapitalismus zur Freiwirtschaft, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 90/1991, S. 3-12
Schad, Dieter (1986): Folgt unsere Wirtschaft Naturgesetzen?, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 69/1986, S. 3-22
Schirmer, (1990): Anmerkungen zum Problem des Zinsnehmens in: Zeitschrift für Sozialökonomie 86/1990, S.21-28
Schmitt, Klaus (1989): Geldanarchie und Anarchofeminismus, in Schmitt, Klaus: Silvio Gesell-"Marx" der Anarchisten, Berlin 1989, S.33-223
Schuler (1990): Bankfreiheit, in: Monetary Freedom Network Rundbrief Nr.
7/1990, S. 3-22
Schwenke, Sigfried (1989): Orientierung bei Währung und Verrechnung, in:
Monetary Freedom Network Rundbrief 2/1989, S. 29-32
Selgin, George A. (1988): The Theory of Free Banking. Money Supply under Competitive Note Issue, Totowa.
Senft, Gerhard (1989): Systematische Grundlegung der theoretischen und histo- rischen Aspekte der libertär-sozialistischen Variante des Freiwirt- schaftsmodells, Diss., Wien
Spahn, Heinz-Peter (1986): Stagnation in der Geldwirtschaft, Frankfurt/M New York
Stirner, Max (1972): Der Einzige und sein Eigentum, Stuttgart.
Suhr, Dieter (1983): Geld ohne Mehrwert. Entlastung der Marktwirtschaft von monetären Transaktionskosten, Frankfurt/Main.
Suhr, Dieter (1986): Befreiung der Marktwirtschaft vom Kapitalismus, Berlin
Suhr, Dieter (1986a): Auf Arbeitslosigkeit programmierte Wirtschaft, in: Creutz, Helmut/Suhr, Dieter /Onken, Werner, Wachstum bis zur Krise?, Berlin 1986
Julius Krause - Grundrisse einer monetären Zirkulativitätstheorie - Seite 101
Suhr, Dieter (1988): Der Kapitalismus als monetäres Syndrom Frankfurt/M, New York
Suhr, Dieter (1988a): Alterndes Geld, Schaffhausen
Suhr, Dieter (1989): The Capitalistic Cost-Benefit Structure of Money, Heidelberg, New York
Suhr, Dieter (1991): Zur Wettbewerbsfähigkeit alternativer Energien in
Abhängigkeit vom Geldsystem, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 89/1991, S. 3-24
Suhr, Dieter/Godschalk, Hugo (1986): Optimale Liquidität. Eine liquidtitätstheo- retische Analyse und ein kreditwirtschaftliches Wettbewerbskonzept, Frankfurt/Main
Timm, Hans (1949): Das erste Freigeld, Lauf bei Nürnberg
Unterguggenberger, Silvio(1983): 50 Jahre Wörgler Freigeld, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 59/1983, S. 37-41
Valentin, Otto (1952): Überwindung des Totalitarismus, Dornbirn Walker, Karl (1936): Aktive Konjunkturpolitik, Berlin.
Walker, Karl (1951): Das Buchgeld. Ein Beitrag zur theoretischen Klärung,
Heidelberg
Weitkamp, Hans (1983): Das Hochmittelalter - ein Geschenk des Geldwesens, Hilterfingen.
Wilken, Johann Christian(1983): Die Geldhortung als Störfaktor der Stabili- tätspolitik, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 59 /1983, S. 24-28.
Winkler, (1983): Verursacht die Marktwirtschaft die Wachstums-, Konsum- und Umweltprobleme, in: Onken, Werner(Hg.): Perspektiven einer ökolo- gischen Ökonomie, Hannover 1983, S. 11-27
Winkler, (1984): Vor einer Mutation unseres Wirtschaftssystems, in: Zeitschrift für Sozialökonomie 62/1984, S. 3-18
Woll, Artur (1976)5: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, München
Periodika
Monetary Freedom Network Rundbrief, Berlin, München Zeitschrift für Sozialökonomie, Hamburg
[...]
1 vgl. Godschalk 1986, S.31 ff., zu weiteren zirkulativitätstheoretische Wurzeln siehe Suhr 1983, S. 12 ff. sowie Suhr 1986, S. 8 ff.
2 Godschalk 1986, S. 32: hier ist von Mittler, als Medium, nicht von Mittel die Rede, obgleich z.T in der zirkulativitätstheoretischen Literatur betont wird, was noch zu zeigen ist, daß Geld zu Ware wird, mit der aus monetärem Selbstzweck gehandelt wird, und so auch zum Tauschmittel, sind die Bezeichnungen besonders bei Gesell oftmals ungenau und undifferenziert: Sollvorstellung ist jedoch immer Geld als Mittel zum Zweck der 'Vermittlung' realwirtschaftlichen Leistungsaustausches, worauf weiter unten noch eingegangen wird.
3 Proudhon 1973, S.100, vgl. auch Schmitt 1989, S. 37 f.
4 Selgin 1988
5 vgl. z.B. MONETARY FREEDOM NETWORK, Rundbrief Nr.4 /1988, S.30f.
6 ebd. S. 4, vgl. Schuler, 1990, S. 11f.
7 vgl. Beckerath, 1989, S. 3 ff.
8 Schuler 1990, S. 15
9 vgl. ebd. S. 16 f. - Das bedeutet die Trennung von Währung und Zahlungsmittel
10 vgl. Greco, 1989, S. 7
11 vgl. ebd., vgl. auch Schuler 7 /90, S. 15 f., vgl. auch Beckerath, 2 /89, S.15
12 vgl. Greco 5 /89, S. 15
13 vgl. ebd. S. 8 ff., vgl. auch Schuler 7 /90, S. 16, siehe auch Schwenke 2 /89, S. 29 f.
14 vgl. Millhaud 2 /89, S. 29 f.
15 vgl. Senft, 1989
16 vgl. Dillard 1935, S. 116 ff.
17 Keynes 1936, S. 298 ff., vgl. auch ebd. S. 196: An dieser Stelle ist erwähnenswert, daß Keynes im gleichen Kapitel Gesell vorhält, nur eine 'halbe' Theorie aufgestellt zu haben. vgl. auch Herr 1987, S. 10 ff. Innerhalb dieser Arbeit wird die daraus resultierende Auseinandersetzung jedoch nicht explizit thematisiert. Werden im Folgenden Keynes und einige monetäre Keynesianer zitiert, so v.a. als 'stilistisches Sprachrohr', das zugleich implizit die z.T analytischen Parallelen zwischen einer monetären Zirkulativitätstheorie und dem sog. Monetär-Keynesianismus aufzeigt.
18 vgl. ebd. S. 299
19 vgl. Senft 1989, S.28 u. vgl. auch Bartsch, 1988, S. 21 ff.
20 Keynes 1936, S. 300
21 ebd. S. 317
22 Gesell 1984, S. 33
23 ebd. S. 36
24 ebd. S. 34
25 ebd. S. 35
26 ebd. S. 34
27 ebd. Hier muß betont werden, daß Gesell Proudons Ansatz zwar grundsätzlich teilte, jedoch das von Prudhon verfolgte Konzept der Tauschbanken für ungeeignet hielt.
28 vgl. Suhr, 1983
29 vgl. ders., Berlin 1986
30 Keynes 1936, S. 317
31 NWO, S. 34
32 ebd. S. 39 f.
33 Valentin, 1952, S. 11
34 ebd. S. 12 f.
35 ebd. S. 14 f.
36 vgl. ebd. S. 13
37 ebd. S. 14 f.
38 vgl. Landauer 1978, z.B. S. 102 ff. u. S. 121 ff.
39 vgl. Mühsam, 1988, S. 297 ff.
40 vgl. Sirner 1972, siehe Senft 1989, S. 33 - 64 sowie sehr kritisch hierzu Helms 1966, S. 427 ff.
41 vgl. Klönne 1992, S. 126 ff.
42 vgl. Valentin 1952, S. 16, vgl. Creutz, 1992, S.12 ff.
43 vgl. u.a. Suhr / Godschalk,1986, S.22 ff., vgl. z.B. Felderer / Homburg 1989, S. 79 f
44 vgl. Godschalk 1986, S. 32; vgl. Grimmiger 1989, S. 6
45 vgl. Suhr 1983, S. 74
46 vgl. Walker 1951, S. 79 ff., S. 23 ff. u. S. 54 ff. sowie S. 70 f. vgl. Zill 1991, 92 ff. , siehe Grimminger 1989, S. 7, vgl. Gesell 1983, S. u. auch Riese1986, S.40
47 Godschalk 1986, S. 9, vgl. auch Otani 1988, S. 247 ff. u. S. 183 ff.
sowie Suhr 1983, S. 67 f. vgl. als 'Lehrbuchwissen' auch Felderer/Homburg 1989, S. 78f.
48 vgl. Suhr 1983. S, 103 u. S. 99; siehe ebenfalls als 'Lehrbuchwissen auch Woll 1976, S. 400 u. Lancaster 1983, S. 365
49 vgl.Felderer/Homburg 1989, S. 79
50 vgl. Grimmiger 1989, S. 6
51 vgl. Suhr 1983, S. 34 u. 86; vgl. H. Creutz 1987, S. 12
52 Gesell 1984, S. 131
53 Gesell 1984, S. 187; vgl. Otani 1981, S. 184
54 Gesell 1984, S. 131
55 Gesell 1984, S. 174; vgl. auch Suhr 1983, S. 33
56 Gesell 1984, S. 132
57 ebd. 1984, S. 175
58 ebd. 1984, S. 188; vgl. auch Otani 1981, S. 184
59 Gesell 1984, S. 189
60 ebd. 1984, S. 186
61 ebd. 1984, S.189, vgl. auch Otani 1981, S.185
62 Gesell 1984, S. 190, betr. alle Zitate des Absatzes nach Fußnote 61
63 vgl. Senft 1989, S.109
64 Gesell 1984, S. 174
65 vgl. Binn 1978, S. 10 ff; vgl. ders. 1976a, S. 30f.
66 Gesell 1984, S. 174, 175
67 Gesell 1984, S. 184
68 Gesell 1984, S. 212, vgl. auch Spahn 1986, S. 198
69 vgl. Rosenbohm 1989, S. 7; siehe auch Woll 1976, S. 364
70 Gesell 1984,S. 212; ; vgl. auch Otani 1981, S. 184 sowie Wilken 1983, S. 26
71 Gesell 1984,S. 212
72 Binn 1976, S. 25
73 Gesell 1984,S. 212
74 Senft 1989, S. 133; vgl. zum Sayschen Theorem z.B. Felderer/ Homburg 1989, S. 84
75 Senft 1989, S. 133.
76 Gesell 1984, S. 181; vgl. auch Y. Otani 1981, S. 184
77 J.St. Mill 1924, S. 7, zitiert nach Felderer/Homburg 1989, S.79
78 vgl. Senft 1989, S. 144f.; vgl. auch Woll 1976, S. 401f.
79 Felderer/Homburg 1989, S. 79, vgl. Suhr 1983, S. 110
80 vgl. Godschalk 1986, S. 11
81 vgl. Suhr 1991, S. 6
82 Suhr 1991, S. 7, abgeleitet aus der nicht vorhandenen arbeitsteiligen Produktion
83 Binn 1976, S. 25
84 Godschalk 1986, S. 11 f.
85 vgl. Suhr 1991, S. 7; vgl. Binn 1976, S. 25
86 vgl. Creutz 1984, S. 3 f. und vgl. Suhr 1983, S. 45
87 vgl. eine entsprechende Erklärung für Ersparnisse bei Pischke 1978, S. 43f.
88 vgl. Suhr 1988a, S. 67; vgl. Doerner/W. Onken 1985, S. 27
89 Suhr / Godschalk 1986, S.24, vgl. Suhr 1988a, S. 74
90 vgl. Führer 1988, S. 19; vgl. Schad 1986, S. 8f., vgl auch Suhr/Godschalk 1986, S. 28
91 Suhr / Godschalk 1986, S.24
92 vgl. Otani 1981, S. 213 , vgl. Löhr 1992, S. 74 f. sowie Schad 1986, S. 8f.
S. 27, Austauschrelation und Ertrag als 'Preis' in der geldlosen Tauschwirtschaft
93 Suhr 1988a, S. 47; vgl. Godschalk 1986, S. 12
94 vgl. Godschalk 1986, S. 11
95 vgl. Suhr 1986, S. 31 sowie Otani 1981, S. 243, vgl. auch Felderer/Homburg 1989, S. 78
96 Suhr 1989, S. 8
97 Suhr 1983, S. 64, siehe auch S. 60; vgl. ders. 1986, S. 32
98 Godschalk 1986, S. 12
99 Otani 1981, S. 184f.; vgl. auch Binn 1976, S. 25. Diejenigen Wirtschaftssubjekte die Ware verkaufen müssen, z.B. Arbeitskraft, um Ware kaufen zu können, nenne ich Reproduzenten
100 Suhr 1983, S. 112 gl. Schad 1986, S. 8, siehe Suhr 1988, S. 49 u. S. 42.,
101 vgl. Suhr/Godschalk 1986, S.48 ff., d.h. der 'Wunsch' nach Geldzuflüssen in die 'Transaktonskasse' der Reproduzenten resultiert aus notwendigen Abflüssen aus der 'Transaktionskasse'.
102 die 'Anleger kasse',vgl. Suhr/Godschalk 1988, S. 32 f., siehe Schad 1986, S. 9; vgl. auch Otani 1981, S. 184 und siehe Suhr 1986, S. 36
103 vgl. Schad 1986, S. 10 und Suhr 1983, S. 105 ff., siehe z.B.
104 Otani 1981, S. 184, vgl. Suhr 1983, S. 45
105 vgl. hierzu auch Riese 1987, S. 200
106 vgl. Suhr 1983, S. 55; dazu können auch 'Anlagealternativen' gerechnet werden 106a vgl. Suhr 1986, S. 33; vgl. ders. 1983, S. 112
107 Suhr 1986, S. 33; vgl. Schirmer 1990, S. 26
107a Suhr 1983, S. 110 u. S. 100 f., vgl. auch Rosenbohm 1989, S. 8
107b vgl. Suhr/Godschalk 1986, S. 69f. u. S. 128 f., vgl. auch Suhr 1983, S. 65
108 Keynes 1936, S. 139f.
109 vgl. Schad 1986, S. 9f.; vgl. Otani 1981, S. 210 sowie Suhr 1983, S. 45
110 Schmitt 1989, S. 42 u. S. 72 ff., vgl. Gesell 1984, S. 317 ff. 111 Gesell 1984, S. 317
112 Gesell bezeichnet diesen Zins als Urzins, Keynes Äquivalent Ist die Liquiditätsprämie, die Höhe wird unterschiedlich bei mind. 2% bis mind 5% angesiedelt. Theoretisch relevant ist allein, daß der Geldzins größer als Null ist.
113 vgl. Otani 1981, S. 210 und vgl. Suhr 1991, S. 11; sowie ders. 1986, S. 37
114 vgl. Suhr/Godschalk 1986, S. 22 ff., siehe Suhr 1986, S. 34 und ders. 1983, S. 47
115 Suhr 1986, S. 37; vgl. Otani 1981, S. 209
116 Keynes 1936, S. 139f.; vgl. auch Grimmiger 1989, S. 5 116a Suhr 1986, S. 53
117 ebd. S. 52, vgl. ders. 1986, S. 32
118 Keynes 1936, S. 141
119 Suhr 1983, S. 64, vgl. Suhr / Godschalk 1986, S. 38 f.
120 Suhr/Godschalk 1986, S. 48
121 vgl. Suhr/Godschalk 1986, S. 37 u. S. 51 ff. 122 Suhr 1986, S. 55
123 ebd. 1986, S. 53, vgl Suhr / Godschalk 1986, S. 36 f.
124 Suhr 1986, S. 55
124a vgl. Grimmiger 1989, S. 5
124b vgl . Suhr/Godschalk 1986, S. 19 f.
124c vgl. Suhr 1986, S. 55; vgl. Grimmiger 1989, S. 4
124d vgl. Suhr 1983, S. 100f.
125 Suhr 1989, S. 49f.; vgl. Parsons 1967, S. 275 ff. 122a Suhr 1983, S. 64 u. S. 60; vgl. ders. 1986, S. 32 122b Suhr 1988a, S. 56
126 Suhr 1989 S. 49, siehe Schad 1986, S. 8
127 Suhr 1986 a, S. 49
128 vgl. ebd.
129 Suhr 1983, S. 86; vgl. Rosenbohm 1989, S.6, und auch Creutz 1986, S. 11 129a vgl. Suhr/Godschalk 1986, S. 45f., 52f. , 61 u. S. 98 f.
130 Suhr 1986, S. 55
131 vgl. Suhr/Godschalk 1986, S. 66 f.; vgl. M. Kennedy 1991, S. 30
131a vgl. Suhr/Godschalk 1986, S. 77 f. sowie Suhr 1991, S. 11
131b vgl. Suhr 1986, S. 35,
131c Suhr 1983, S. 113
131d vgl. ebd.; vgl. ders. 1986a, S. 47, siehe auch Creutz 1990, S. 19 f.
132 Suhr 1983, S. 113
133 Suhr 1989, S. 3; vgl. Suhr/Godschalk 1986, S. 72, vgl. z.B. auch Creutz 1990, S. 20 133a vgl. Suhr 1983, S. 97; siehe auch Creutz 1987, S. 9
133b Suhr 1986, S. 35
133c vgl. Suhr 1986a, S. 48; vgl. auch Creutz 1990, S. 14
134 vgl. Suhr/Godschalk 1986, S 72, u. Suhr 1986, S. 35 sowie Doerner/Onken 1990, S. 27
135 Suhr 1983, S. 113
136 ebd. S. 114, vgl. hierzu auch Winkler 1984, S. 9
137 vgl. Scmitt 1988, S. 43
138 vgl. S.21 dieser Arbeit, das kann auch die Nutzung für 'Realinvestitionen' bedeuten
139 vgl . S. 25 dieser Arbeit.
140 vgl. Otani 1981, S. 240, siehe Suhr/Godschalk 1986, S. 73 f., und Gesell 1984, S. 315
141 vgl. Gesell 1984, S. , S. 324
142 vgl. Grimmiger 1989, S. 5; vgl. Gesell 1984, S. , S. 325
143 Suhr 1986, S. 54; vgl. Doerner/Onken 1985, S. 27
144 vgl. Schad 1986, S. 9; vgl. Rohsenbohm 1989, S. 8, und siehe Grimmiger 1989, S.6 und vgl. auch Suhr/Godschalk 1986, S. 73 f.
145 vgl. Löhr 1988, S.4
146 1984, S. 326
147 Führer 1988, S.20
148 vgl. Grimminger 1989, s. 6f.
149 Löhr 1988, S.4
150 vgl. ebd.
151 Gesell 1984, S. , S. 327
152 ebd. S. 326
153 Binn 1976, S. 16f.
154 vgl. Führer 1988, S. 21; siehe auch Binn 1976, S. 29f. sowie Grimminger 1989, S. 6f.
155 Binn 1976, S. 16f.
156 vgl. Winkler 1984, S. 12
157 Grimminger 1989, S.5
158 vgl. Winkler 1984, S. 12
159 Löhr 1988, S.4
160 Gesell 1984, S. , S. 325; vgl. auch Senft 119 f.
161 ebd.
162 Otani 1981, S. 203
163 Grimminger 1989, S.4
164 Riese 1986, S. 65 f.
165 Suhr 1983, S. 113
166 vgl. Winkler 1984, S. 8 f.
167 Suhr 1986, S. 35
168 Suhr 1989, S. 3
169 vgl. Suhr 1986, S. 35
170 Suhr 1989, S. 3, vgl. auch Suhr 1983, S. 113 f.
171 vgl. Löhr 1988, S. 8; vgl. Winkler 83, S. 24
172 Löhr 1988, S. 9, vgl. Jenetzky 1991, S. 7
173 Binn 1983a, S. 28; vgl. Suhr 1986, S. 51
174 Gesell 1984, S. , S. 325
175 vgl. Winkler 1983, S. 15 ff.; vgl. Löhr, S. 7 f., Kapazitätseffekt vgl. Rose 1984, S. 22 ff., das beinhaltet auch Investitionsnachfrage, was den Effekt akzelatorisch betont, vgl. auch Jenetky 1991,S.7
176 vgl. Suhr 1986, S. 50 f., siehe auch Creutz 1986, S. 26 f. sowie Rosenbohm 1991, S. 4
177 Winkler 1983, S. 24
178 Winkler 1983, S. 23
179 vgl. Binn 1976, S. 25 f. sowie Creutz 1987, S. 3 f. und Gesell 1984, S. 158
180 vgl. Binn 1983, S. 35, vgl. auch Wilken 1983, S. 27 und Gesell 1984, S. 198
181 vgl. Winkler 1984, S. 12
182 vgl. Grimminger 1989, S. 6
183 Winkler 1984, S. 12, vgl auch Löhr 1988, S. 5 u. S. 9 f.
184 Gesell 1984, S. S. 199
185 Winkler 1984, S. 12
186 Löhr. S. 6, vgl. auch Creutz 1987, S. 9
187 Löhr 1988, S. 8, vgl . Winkler 1984, S. 12 u. siehe auch Creutz 1990, S. 19
188 Löhr 1988, S. 10
189 vgl. Grimminger 1990, S. 16 ff., vgl. auch Creutz 1984, S. 22, einzelwirtschaftlich bedeutet der negative financial Leverage ein Tilgung durch - und damit ein 'Verzehr' von Eigenkapital, sofern die Eigenkapitalrendite die Fremdkapitalkosten unterschreitet. Die Alternative ist die 'Ansammlung' offener Verbindlichkeiten:Beides erhöht den Verschuldungsgrad.
190 vgl. hierzu auch S. 36 ff.
191 vgl. Grimminger 1990, S. 15 ff., vgl. Creutz 1990, S. 14 f., vgl. Schad 1986, S. 10, beispielhaft hierfür stehen z.B. die bekannten 'Banken mit Elektro- oder Kfz-abteilung', z.B. Siemens u. Daimler Benz, deren positiver Gewinnvortrag, wenn vorhanden, in den letzten Jahren v.a. auf Zinsgewinnen beruhte, die als 'interne Subvention' die Markterhaltung ihres 'ursprünglichen', zunehmend defizitären, Leistungsbereichs ermöglichten.
192 vgl. Schad 1986, S. 11f., vfl. Grimminger 1990, S. 17, eine überzyklische 'Analyse' ist in der zirkulativitätstheoretischen Literatur nur äußerst rudimentär entwickelt. Wenn überhaupt besteht die Profilierung hierbei vor allem in der Betonung des monetären Krisenmechanismus als Ursache einer entsprechenden realwirtschaftlichen Entwicklung. Genauere Betrachtungen der Symptomebene beruhen zumeist auf Anleihen bei anderen Schulen.
193 Otani 1981, S.207
194 Suhr 1986, S. 38, vgl. Creutz 1986, S. 26 f.
195 Winkler 1984, S. 8, vgl. Binn 1983, S.12
196 Winkler 1983, S. 24, was die Verwerfung der Naturkonstanzthese impliziert.
197 Suhr/Godschalk 1986, S. 57, vgl. Creutz 1991, S. 16
198 Winkler 1983, S. 24
199 ebd. S. 9
200 Otani 1981, S.205, vgl. auch Binn 1983, S. 35
201 Führer/Onken 1986, S. 18 f., vgl. Creutz 1986, S. 26 f.
202 Suhr/Godschalk 1986, S. 86 ff., vgl. Suhr 1986, S. 54
203 vgl. Suhr 1991, S. 4 ff., vgl. Suhr/Godschalk 1986, S. 82 f., vgl Senft 1989, S. 240 f. , vgl. auch ebd. S. 116 und siehe dazu auch Gesell 1984, S. 349 f., siehe auch Schad 1986, S. 6 ff. u. S.
204 Marx 1890, S. 529 f.
205 Marx 1857/58, S. 313 f., Eigenlob: vgl. zur Ökologie in der marxistischen Theorie auch Krause 1990
206 vgl. S. 13 und S. 15 dieser Arbeit
207 vgl. Suhr 1983, S. 18
208 Marx 1857/58, S.64 f.
209 Marx 1890, S. 742, vgl. hierzu Senft 1989, S. 137
210 Marx 1890, S. 742
211 vgl. Marx 1971, S. 235
212 vgl. Hüwe o.J., S. 3; vgl. Otani 1981, S. 69, vgl. Suhr 1983, S. 16
213 vgl. Suhr 1988, S. 12
214 Marx 1894, S. 51
215 Marx 1894, S. 51
216 vgl. Suhr 1988, S. 13f.; vgl. Otani 1981, S. 66
217 Marx 1890, S. 161
218 Marx 1857/58, S. 76
219 Marx 1890, S. 100
220 Marx 1890, S. 130, vgl. hierzu Suhr 1988, S.14 und siehe Hüwe o.J., S. 4
221 Marx 1890, S. 122, betr. alle Zitate seit Fußnote 214
222 Onken o.J., S. 14
223 Marx 1890, S. 120
224 Marx 1890, S. 742, vgl. hierzu Senft 1989, S. 117, vgl. auch Suhr 1988, S. 13, und siehe Otani 1981, S. 67
225 Senft 1989, S. 140
226 Marx 1890, S. 130, vgl. hierzu Suhr 1988, S.14 und siehe Hüwe o.J., S. 4
227 Hüwe o.J., S. 4, vgl. ebd, S.8 und vgl.Suhr 1988, S.13,
228 Engels 1894, S. 283 ff., vgl. hierzu auch Onken o.J., S. 17
229 vgl. Senft 1989, S. 139; vgl. Otani 1981, S. 53
230 Marx 1890, S. 161, betr. alle Zitate seit Fußnote 221
231 Marx 1890, S. 184
232 Marx 1862/63, S. 477 f., betr. alle Zitate im Absatz
233 Marx 1894, S.389, betr. alle Zitate seit Fußnote 225
234 vgl. Suhr 1986, S. 14
235 Marx 1862/63, S. 479; vgl. hirzu auch Marx 1894, S. 370 ff. u. S. 394
236 Marx 1862/63, S. 477 f.
237 vgl. Suhr 1988, S.16; vgl. Hüwe o.J., S. 9
238 vgl. Suhr 1988, S.16f., vgl. Otani 1981, S. 53
239 Marx 1862/63, S. 468
240 Marx 1970, S. 403, Hervorhebung von mir
241 vgl. Senft 1989, S. 137 f., vgl. Suhr 1988, S.16f. 242 Marx 1862/63, S. 468
243 Marx 1862/63, 484-486 Hervorhebung von mir.
244 Marx 1894, S. 396f.
245 Suhr 1988, S. 17; vgl. Hüwe o.J., S. 6
246 Marx 1894, S. 392, hiezu Onken o.J., S. 29 ff., vgl. Schmitt 1988, S. 176 ff.
247 Marx 1862/63, S. 477 f.
248 Marx 1862/63, 484-486
249 Engels 1894, S. 283 ff.
250 Spahn 1986, S. 112 ff. der dient nur als 'Sprachrohr', vgl. hiezu Schmitt 1988, S. 176 ff. siehe auch Hüwe o.J., S. 6; sowie Suhr 1988, S. 20
251 Marx 1890, S. 147
252 Marx 1862/63, 484-486
253 Marx 1890, S. 147
254 Marx 1890, S. 179, vgl. hierzu Senft 1989, S. 139
255 Marx 1894, S. 612
256 Marx 1890, S. 178
257 vgl. Suhr 1988, S. 29f., vgl. hierzu auch Onken o.J., S. 19
258 vgl. Hüwe o.J., S. 4f.; vgl. Suhr 1988, S. 18
259 Marx 1859, S. 79
260 vgl. Suhr 1988, S. 19
261 Marx 1859, S. 79
262 Marx 1857/58, S. 76, Hervorhebung von mir.
263 vgl. Suhr 1988, S. 25
264 Marx 1890, S. 104
265 Marx 1890, S. 104, vgl. hierzu Onken o.J., S. 13 f., vgl. Suhr 1988, S. 26
266 Marx 1890, S. 109
267 Marx 1890, S. 149
268 Marx 1890, S. 150, vgl. hierzu Suhr 1988, S. 26
269 Marx 1890, S. 149
270 vgl. Suhr 1988, S.27
271 Marx 1890, S. 150
272 vgl. Suhr 1988, S.27
273 Marx 1857/58, S. 117
274 Marx 1890, S. 144
275 Marx 1890, S. 144, vgl. hierzu Onken o.J., S. 14 f.
276 Marx 1890, S. 144, vgl. hierzu Onken o.J., S. 14 f.
277 Marx 1890, S. 144
278 vgl. Onken o.J., S. 19, vgl. Suhr 1988, S. 30
279 Marx 1857/58, S. 114
280 Marx 1857/58, S. 897f., betr. allle Zitate seit Fußnote 272, vgl. Suhr 1988, S. 30
281 Marx 1857/58, S. 67
282 Marx 1857/58, S. 144, vgl. hierzu Suhr 1988, S. 30 f.
283 Marx 1890, S. 83 f.,alle Zitate seit Fußnote 276, vgl. hierzu Hüwe o.J., S. 5
284 Marx 1862/63, S. 525
285 Marx 1857/58, S. 84, vgl. hierzu auch Suhr 1988, S. 31
286 Marx 1857/58, S. 76
287 Marx 1890, S. 145, vgl. hierzu Suhr 1988, S. 3
288 vgl. Suhr 1988, S. 32
289 Marx 1857/58, S. 64f.
290 Marx 1857/58, S. 67f.
291 Marx 1857/58, S. 69, vgl. Suhr 1988, S. 33, vgl. hierzu auch Marx 1890, S. 144
292 Marx 1857/58, S. 64
293 Marx 1857/58, S. 69
294 Marx 1857/58, S.64 f., vgl. Suhr 1988, S. 34
295 Suhr 1988, S. 34
296 Marx 1894, S.389
297 vgl. Suhr 1988, S. 34
298 Marx 1890, S. 146
299 Columbus zitiert in Marx 1890, S. 145, vgl. hierzu auch Onken o.J., S. 15 u. S. 26
300 Marx 1890, S. 152, vgl. auch Engels 1966, S. 172
301 Marx 1890, S. 152
302 vgl. Hüwe o.J., S. 4 f.
303 Marx 1890, S. 127
304 Marx 1859, S. 78
305 Marx 1890, S. 127
306 Marx 1859, S. 78
307 Marx 1890, S. 127, betr. alle Zitate Fußnote 300
308 Suhr 1988, S. 39
309 Marx 1890, S. 174f., Hervorhebung vom Autor
310 vgl. Hüwe o.J., S. 5
311 Marx 1890, S. 175
312 Suhr 1988, S. 40, betr. alle Zitate seit Fußnote 311
313 ebd. 1988, S. 41
314 ebd. 1988, S. 40
315 ebd. 1988, S. 41
316 Marx 1890, S. 175
317 Suhr 1988, S. 40
318 ebd. 1988, S. 42
319 ebd. 1988, S. 40
320 Marx 1890, S. 172, vgl. hierzu auch Hüwe o.J., S. 5
321 Gesell 1984, S. 316 f.
322 vgl. Schirmer 1990, S. 26
323 Marx 1890, S. 181, Hervorhebung von mir
324 vgl. Otani 1981, S. 64 ff.
325 Marx 1890, S. 183
326 Marx 1890, S. 183
327 Marx 1894, S. 51
328 Marx 1890, S. 130
329 Marx 1890, S. 183:
330 vgl. Otani 81, S. 68; vgl. Oppenheimer 1913, S. 6 ff.
331 Marx 1890, S. 183: wäre jeder Arbeiter Privateigentümer an Produktionsmitteln und hätte somit 'andre Sachen' zu verkaufen, wäre er nicht mehr der marxsche 'doppelt freie' Lohnarbeiter, aber nachwievor auf die 'Austauscherlaubnis' des Geldkapitals angewiesen
332 Gesell 1984, S. 324, vgl. hierzu Hüwe, S. 8 f., vgl. Suhr 1988, S.36 f.
333 Marx 1890, S. 209, betr. alle Zitate seit Fußnote 325, vgl. hierzu Otani 1981, S. 65f.
334 Marx 1862/3, S. 477
335 Marx 1890, S. 209
336 Marx 1890, S. 169.
337 vgl. Onken o.J., vgl. auch Suhr 1983, S. 21 u. S. 36 ff.
338 Otani 1981, S. 67
339 Suhr 1988, S. 37
341 Marx 1890, S. 53, vgl. Hüwe, S. 8f.
342 Suhr 1988, S. 48, vgl. auch Suhr 1983, S. 21
343 Marx 1857/58, S. 753
344 Marx 1857/58, S. 128, siehe Marx 1890, S 106, vgl. hierzu Otani 1981, S. 61
345 Marx 1890, S. 55
346 Marx 1890, S. 56
347 Marx 1890, S. 104
348 Marx 1894, S. 363
349 Marx 1894, S. 364
350 Suhr 1988, S. 52
351 vgl. Hüwe, o.J., S. 7; vgl. Suhr 1983, S. 19
352 Marx 1859, S. 82, vgl. hierzu Suhr 1988, S. 52
353 Marx 1857/58, S. 129
354 Marx 1857/58, S. 130
355 Suhr 1988, S. 49
356 Marx 1857/58, S. 130
357 Marx 1890, S. 101
358 Marx 1857/58, S. 83, vgl. hierzu Hüwe o.J., S.7
359 vgl. hierzu auch Suhr/Godschalk 1986, S. 92 ff.
360 Suhr 1988, S. 49, vgl. S. 31 dieser Arbeit
361 Marx 1859, S. 82
362 vgl. hierzu Hüwe o.J., S. 7 und siehe Suhr 1988, S. 48 u. S. 49 ff.
363 Marx 1894, S. 53, betr. alle Zitate im Absatz, vgl. dazu Suhr 1986, S.15
364 Marx 1894, S. 54, betr. alle Zitate im Absatz
365 Marx 1894, S. 360
366 vgl. dazu Suhr 1983, S.16
367 Marx 1857/58, S. 64
368 Marx 1894, S. 53, betr. alle Zitate im Absatz, vgl. dazu Suhr 1986, S.15
369 Keynes 1936, S. 317
370 vgl. hierzu S. 15 ff., S. 36 ff. u. S. 38 ff. dieser Arbeit
371 Marx 1890, S. 529 f., vgl. auch S. 44 ff. und S.46 ff. dieser Arbeit
372 vgl. Grimminger 1989, S. 5 ff.
373 vgl. S. 24 ff. u. S. 26. ff. dieser Arbeit
374 vgl. Suhr 1986a, S. 53 ff., vgl. hierzu auch Gesell 1892, S. 162 ff. u. S. 187 ff.
375 Kennedy 1991, S. 41
376 Suhr 1983, S. 36
377 Otani 1981, S. 258
378 Gesell 1984, S. 239 f.
379 Gesell 1989, S. 97 f.
380 vgl. S. 18 ff. u. siehe S. 25 f. dieser Arbeit
381 Suhr 1983, S. 37, vgl. hierzu auch Gesell 1906, S. 102 ff., sowie Gesell 1891, S. 105 ff.
382 Gesell 1984, S. 245, betr. alle Zitate im Absatz, vgl. auch Otani 1981, S 256. ff.
383 Gesell 1984, S. 246
384 Gesell 1984, S. 243
385 Suhr 1983, S. 35 f.: Neben dem etwas umständlich erscheinenden Konzept wurden noch etliche weitere Verfahren entwickelt. Etwa statt zu kleben, zu stempeln. vgl. auch Fisher 1933. Andere Verfahren wie das Auslosen von Seriennummern von Geldscheinen, oder nur mit möglicher, plötzlicher Gebührenerhebung zu drohen, zielen auf die Wirkung der Befürchtung der Geldbesitzer ab, daß schon die reine Möglichkeit mit Durchhaltekosten belangt zu werden, die Bereitschaft anregt Liquidität aufzugeben. Suhr z.B. 1986a und Suhr /Godschalk 1986 schlagen ein Konzept vor, das den 'Kapitalismus vom Konto abbucht' indem die Bundesbank neben den bisherigen Banknoten als Notenbankgeld zugleich Buchgeld ausgibt, das in Anlehnung an den 'Keynes-Plan' - vgl. z.B. Suhr 1988a - mit Durchhalte Kosten belastet wird und zugleich auch unter Annahmezwang steht, so daß über das sog. Grahamsche Gesetz dieses 'schlechtere' Geld das 'gute' bisherige verdrängt. Alle Konzepte und Verfahrensweisen zielen letztendlich auf 'neutrale Liquidität' bzw. 'neutrales Geld' ab.
386 Gesell 1984, S. 342
387 Gesell 1984, S. 343
388 Keynes 1936, S. 301, vgl. auch S. 8 dieser Arbeit
389 Keynes 1936, S. 317, vgl. auch S. 10 dieser Arbeit
390 Gesell 1984, S. 34, vgl. S. 10 dieser Arbeit.
391 Gesell 1984, S. 344, betr. alle Zitate im Absatz
392 vgl. hierzu S. 30 ff. dieser Arbeit
393 Rosenbohm 1989, S. 9 f.
394 Suhr 1983, S. 45, betr. alle Zitate seit der vorherigen Fußnote:Die grundlegenden erwarteten Wirkungen wurden bereits einleitend - vgl. S. 7 ff. - dargelegt. Indem die monetäre Zirkulativitätstheorie die thematisierten Widersprüche u. Folgeprobleme einer kapitalistischen Marktwirtschaft v.a. auf das Geldsystem zurückführt, und zwar explizit auf die Möglichkeit, den monetär vermittelten Doppeltausch zu unterbrechen, seien, aufgrund der Annahme mit Durchhaltekosten für Geld dieses Problem beseitigen zu können, mit einer Geldreform die positiven Aspekte aus dem Umkehrschluß der Kritik abzuleiten, weshalb in diesem Abschnitt darauf nicht weiter eingegangen wird: relevant ist nur die Vermutung, daß mit dem Geldzins als Fehlallokationsmechanismus, auch die Fehlallokation und daraus resultierende Kriesenerscheinungen - incl. ökölogischer - entfielen.
395 weitere Ansätzen z.B. bei Onken 1986, S. 63 ff. u. Kennedy 1991, S. 42 ff. u. S. 188 ff.
396 Otani 1981, S.198 f.
397 vgl. Otani 1981, S.199
398 vgl. Kennedy 1991, S. 139:"Die Benutzung der Alten Münzen war streng untersagt"
399 Weitkamp 1983, S. 55
400 vgl. Kennedy 1991, S. 139, vgl. in leichter Variation auch Senft 1989, S. 16
401 vgl Otani 1981, S. 199, vgl. auch Kennedy 1991, S. 140,
402 Otani 1981, S. 199, diese Behauptung ist möglicherweise für Magdeburg richtig, verallgemeinert könnte sie sich als 'Steuerlüge' erweisen: vgl. Damaschke 1922, S. 88 ff. sowie S. 107 f. u. S. 146
403 Weitkamp 1983, S. 57
404 Müller 1985, S. 56, vgl. Weitkamp 1983, S. 56
405 Senft 1989, S. 16
406 Weitkamp 1983, S. 60 betr. alle Zitate seit dem vorherigen Fußnotenzeichen. Nach Dama schke 1922, S. 131 ff. entsprach das zwar auch dem damaligen kantonischen Recht, dennoch kam es zu teilweise sehr hohen Zinsen, vgl. S. 136
407 Suhr 1988a, S. 82, vgl. Weitkamp 1983, S. 56
408 Suhr 1988a, S. 82
409 vgl. Weitkamp 1983, S. 60 f., vgl. Kennedy 1991, S. 142 ff., vgl. entsprechend auch Damaschke 1922, S. 105 und S. 119 ff.
410 Otani 1981, S. 199 f., nach Weitkamp 1983, S. 61 gab es teilweise 180 Feiertage im Jahr und eine 4-Tage Woche mit 6 Stunden täglicher Arbeitszeit. Kennedy 1991, S. 142 ff. nennt 5 1/2 Arbeitstage bei 8 Stunden täglich, und verweist darauf, daß "ein sächsischer Maurer ohne freie Kost in heutigem Geldwert 2600 Mark pro Monat" verdiente. Am genausten sind hier bestätigende Angaben von Damaschke 1922, S. 83 ff., S. 103ff., u. S. 146
411 vgl. Weitkamp 1983, S. 61
412 Weitkamp 1983, S. 62, meint Bergwerksknappen, vgl. Kennedy 1991, S. 146
413 Otani 1981, S. 200
414 zitiert nach Onken 1986, S. 66
415 Onken 1986, S. 66
416 vgl. Godschalk 1986, S. 36 f.
417 Godschalk 1986, S. 36
418 vgl. Godschalk 1986, S. 38
419 Onken 1986, S. 67
420 Onken 1983, S. 66
421 Timm 1949, S. 558, zitiert in Senft 1989, S. 218
422 Senft 1989, S. 218, betr. alle Zitate des Absatzes
423 Timm 1949, S. 556, zitiert in Senft 1989, S. 218
424 Onken 1983, S. 7
425 vgl. Onken 1983, S. 7, vgl. Godschalk 1986, S. 38
426 Senft 1989, S. 219, vgl. auch Kennedy 1991, S. 43
427 Godschalk 1986, S. 38
428 Onken 1983, S. 7
429 vgl. Senft 1989, S. 220
430 Onken 1986, S. 69, Senft 1989, S. 220 merkt hirzu an, daß Hebecker "die Bücher etwas frisiert" habe und daß das Bergwerk nicht nur Prestigeobjekt, sondern auch "ein Faß ohne Boden" gewesen sei, das die Tauschgesellschaft in immer kürzeren Abständen kreditär zu füllen hatte, so daß Helms 1966, S. 444 zu dem Schluß kommt, das Verbot sei im Sinne der Tauschgesellschaft, gewesen die dadurch vermied sich als 'Flop' zu offenbaren und so einen 'Propagandaeffekt' für das Freigeldkonzept sicherte. Problematisch für eine Bewertung ist zudem, daß genaueres 'Zahlenmaterial' etwa über den Umsatz der Wära-Tauschgesellschaft, die Entwicklung der Beschäftigten zahlen durch evtl. Multiplikatoreffekte etc., nicht oder schwer zugänglich ist. Dargestellt wird es in dieser Arbeit vor allem, weil es in der entsprechenden Literatur als das erste große, geplante Freigeldprojekt gilt.
431 vgl. Onken 1986, S. 70
432 Onken 1986, S. 70
433 vgl. Unterguggenberger 1983, S. 38 und vgl. Onken 1986, S. 70, die Zahlen variieren bei den Autoren leicht, vgl. auch Muralt 1989, S. 275
434 vgl. Senft 1989, S. 222
435 Onken 1986, S. 70, vgl. Unterguggenberger 1983, S. 38, evtl. wegen der Differenz von Soll und Habenzinsen beträgt die Zinslast mehr als 135.000 Schilling, jedoch variieren hier die Aussagen, vgl. Muralt 1989, S. 282
436 zitiert aus Senft 1989, S. 223
437 vgl. Muralt 1989, S. 276
438 Muralt 1989, S. 276
439 Unterguggenberger 1983, S. 38, also durchschnittlich ca. 3 Schilling pro Kopf, 150 weniger als der damalige Durchschnitt des Nationalbankgeldes vgl. Senft 1989, S. 225, nach Kennedy 1991, S. 42 lief das Freigeld "in Wörgl ...463 mal pro Jahr um", was einen jährlichen 'Leistungsumsatz' im Gegenwert von ca. 5,6 Mio damaliger Schillinge bedeuten würde. Kennedy geht fälschlicherweise von 14,8 Mio aus, weil sie den Umschlag von 32ooo Notgeldschilling, statt der tatsächlichen 12ooo ausgegebenen, vorraussetzt.
440 Onken 1983, S. 8
441 Senft 1989, S. 224 f., auch hier variieren die Zahlen, vgl. Unterguggenberger 1983, S.38
442 vgl. Onken 1983, S. 9, nach Senft 1989, S. 225 entspricht ein Schilling 1932 etwa dem 25-fachen von 1989 443 vgl. Unterguggenberger 1983, S. 38
444 vgl. Senft 1989, S. 225, nach Onken 1983, S. 9 war der Anstieg nur halb so hoch
445 Muralt 1989, S. 254
446 Onken 1983, S. 9, nach Senft 1989, S. 225 wollten sich 200 Gemeinden anschließen
447 vgl. Onken 1983, S. 11
448 Senft 1989, S. 227: Unterguggenberger wurde nach Beteiligung am "gescheiterten Februaraufstand 1934 gegen das faschistische Dolfußregime" als Bürgermeister abgesetzt
449 Gesell 1984, S. 190, betr. alle Zitate seit der letzten Fußnote, vgl. auch S.66 ff. u. S. 25 ff. dieser Arbeit
Häufig gestellte Fragen zu Grundrisse einer monetären Zirkulativitätstheorie
Was ist das Hauptthema von "Grundrisse einer monetären Zirkulativitätstheorie"?
Das Hauptthema ist die Untersuchung und Kritik des bestehenden Geldsystems als konstituierende Institution des Kapitalismus und die Analyse seiner allokativen Dysfunktionalitäten.
Wer sind die wichtigsten theoretischen Bezugspunkte in dieser Arbeit?
Die wichtigsten theoretischen Bezugspunkte sind Silvio Gesell, Pierre-Joseph Proudhon und Karl Marx, wobei Gesells Ideen im Vordergrund stehen und Marx kritisch betrachtet wird.
Was versteht die Arbeit unter "Monetärer Zirkulativitätstheorie"?
Es handelt sich um eine Theorie, die sich auf Veränderungen des bestehenden Geldsystems konzentriert, um systematische Dysfunktionalitäten der Wirtschaftsordnung zu beheben, insbesondere Kreislaufstörungen in ökonomischen Austausch- und Transaktionsprozessen.
Wie unterscheidet sich die "Monetäre Zirkulativitätstheorie" von der "Theory of Free Banking"?
Die "Monetäre Zirkulativitätstheorie" kritisiert vornehmlich Geldeigenschaften und Emissionskonzepte, während die "Theory of Free Banking" sich hauptsächlich mit dem staatlichen Emissionsmonopol und dem Annahmezwang auseinandersetzt.
Was ist das Kernkonzept von Silvio Gesells geld- und zinstheoretischer Kritik?
Gesells Kernkonzept ist das "Freigeld" oder "gestempeltes" Geld, das mit Durchhaltekosten versehen ist, um die Hortung von Geld zu verhindern und den Zinsfuß zu senken.
Wie wird die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes aus zirkulativitätstheoretischer Sicht kritisiert?
Die Wertaufbewahrungsfunktion wird als widersprüchlich angesehen, da sie das Geld als Mittel zur Unterbrechung des Kreislaufs anstatt als Mittel der Zirkulation betrachtet.
Was ist das Saysche Theorem und wie wird es in der Arbeit kritisiert?
Das Saysche Theorem besagt, dass jedes Angebot seine eigene Nachfrage schafft. Die Arbeit kritisiert, dass die Option zur Geldhaltung eine Nachfragevorenthaltung ermöglicht, wodurch nicht jedes Einkommen zur Nachfrage wird.
Was ist die "komperative Neutralitätsanalyse" und was soll sie zeigen?
Es ist ein analytischer Vergleich zwischen einer prämonetären und einer monetarisierten Ökonomie, der darauf abzielt, die Nicht-Neutralität des Geldes herauszuarbeiten.
Was versteht die Arbeit unter "Liquiditätstheoretischer Geld- und Zinsanalyse"?
Der Zins wird als Preis für die zeitweilige Überlassung des ökonomischen Nutzens der monetären Liquidität verstanden, nicht als Ertrag für bestimmte Eigenschaften von Produkten oder Produktionsmitteln.
Was sind "remanente Liquidisierungskosten"?
Es sind die Kosten der ermöglichten Teilnahme am realwirtschaftlichen Leistungsaustausch, die beim Kreditnehmer verbleiben, auch wenn Dritte den Nutzen der Liquidität in Anspruch nehmen.
Wie wird in der Arbeit die Rolle des Geldzinses als Fehlallokationsmechanismus dargestellt?
Der Geldzins wird als Mechanismus dargestellt, der Geld in "Kassen mit Geld ohne Bedarf" lenkt, was die Knappheit an Gütern erhöht und zu einer künstlichen Verteuerung führt.
Was ist die "Monetäre Kapitaltheorie" und wie unterscheidet sie zwischen primärem und sekundärem Kapitalcharakter?
Die Monetäre Kapitaltheorie besagt, dass Kapital "zinstragendes Eigentum" ist, wobei Geldkapital den primären und Sachkapital den sekundären, abgeleiteten Kapitalcharakter hat.
Wie wird der Krisenmechanismus in der Arbeit beschrieben?
Der Krisenmechanismus basiert auf dem Widerspruch zwischen dem Wachstumszwang, der aus der Fehlallokation monetärer Liquidität resultiert, und der Notwendigkeit induzierter Knappheit, um den Geldzins zu realisieren.
Was ist "Freigeld" und wie soll es funktionieren?
"Freigeld" ist Geld, das mit Durchhaltekosten (Carrying Costs) versehen ist, um die Hortung von Geld zu verhindern und die Zirkulation zu fördern.
Welche historischen Beispiele werden in der Arbeit zur Unterstützung des Freigeldkonzepts genannt?
Die "Brakteaten" des Mittelalters, die "Wära-Tauschgesellschaft" und das "Nothilfeprogramm von Wörgl" werden als Beispiele genannt, die zeigen, wie Umlaufgebühren die Wirtschaft ankurbeln können.
Welche Kritikpunkte werden abschließend an der "Monetären Zirkulativitätstheorie" und dem "Freigeldkonzept" geäußert?
Die Kritikpunkte umfassen die Höhe der Umlaufgebühren, die Vernachlässigung der sozialökonomischen Überlegenheit von Kreditgebern, mögliche Inflations- und Deflationsgefahren und die Vernachlässigung realwirtschaftlicher Faktoren sowie die Annahme vollkommener Konkurrenz.
Details
- Titel
- Grundrisse einer Monetären Zirkulativitätstheorie unter besonderer Berücksichtigung einer geldtheorethischen Kritik der Marxschen Kapitaltheorie
- Hochschule
- Freie Universität Berlin
- Veranstaltung
- Volkswirtschaftstheorie
- Note
- 1,3
- Autor
- Julius Krause (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1993
- Seiten
- 102
- Katalognummer
- V109619
- ISBN (eBook)
- 9783640077984
- ISBN (Buch)
- 9783640114337
- Dateigröße
- 761 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Grundrisse Monetären Zirlulativitätstheorie Berücksichtigung Kritik Marxschen Kapitaltheorie Volkswirtschaftstheorie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Julius Krause (Autor:in), 1993, Grundrisse einer Monetären Zirkulativitätstheorie unter besonderer Berücksichtigung einer geldtheorethischen Kritik der Marxschen Kapitaltheorie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/109619
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-