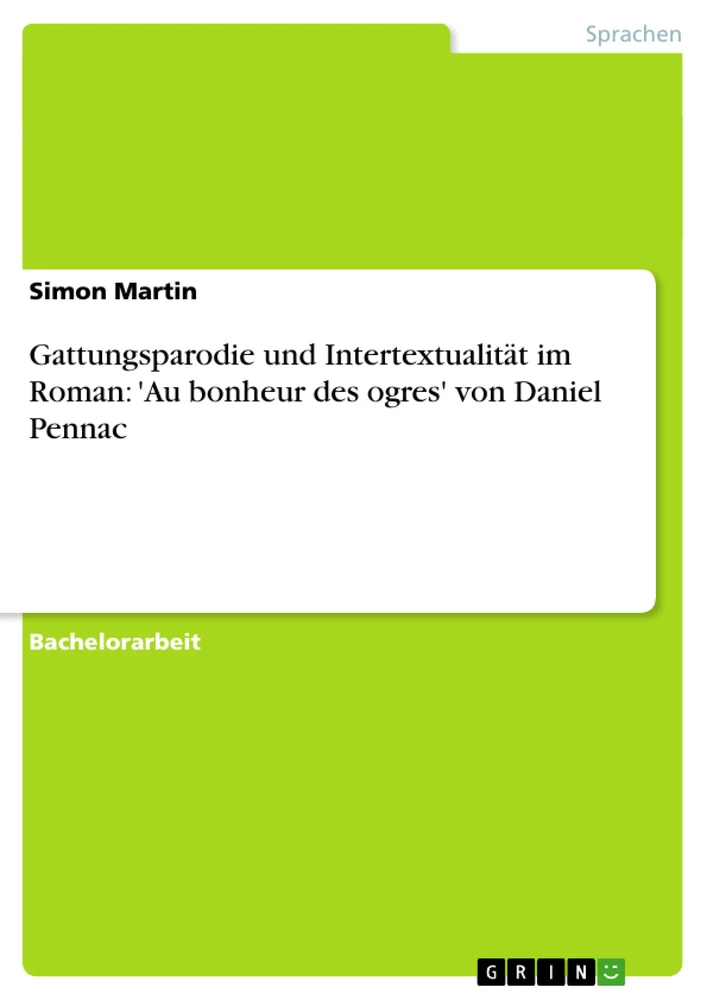
Gattungsparodie und Intertextualität im Roman: 'Au bonheur des ogres' von Daniel Pennac
Bachelorarbeit, 2003
44 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Konzepte
2.1 Intertextualität
2.2 Die Kriminalliteratur und ihre Strömungen
3. Gattungsparodie in „Au bonheur des ogres“
3.1 Die Parodie als intertextuelles Mittel
3.2 Strukturelemente des klassischen Detektivromans
3.2.1 Handlungsmuster
3.2.2 Figurentypologie des Detektivromans
3.2.3 Struktur der Schauplätze
3.3 Strukturelemente und Parodie in „Au bonheur des ogres“
3.3.1 Inhaltlicher Abriss
3.3.2 Die Figuren
3.3.2.1 Das familiäre Umfeld
3.3.2.2 Benjamin Malaussène
3.3.2.3 Die Ermittler Caregga und Coudrier
3.3.2.4 Der Täter
3.3.3 Handlungsstrukturierung
3.3.4 Struktur der Schauplätze
4. Intertextualität in „Au bonheur des ogres“
4.1 Paratextualität
4.2 Autotextualität
4.2.1 Autozitate
4.2.2 Der Roman im Roman
4.3 Verweise auf Fremdtexte
4.3.1 Verweise auf Kriminalliteratur
4.3.2 Verweise außerhalb der Kriminalliteratur
5. Schluss
Anhang
Literatur
1. Einleitung
Am Beginn einer Textanalyse, insbesondere der Analyse eines Romans, steht immer die Suche nach einem geeigneten Konzept. Einem Konzept, das es ermöglicht, Strukturen in Form und Inhalt als zusammenhängend zu erkennen und im Hinblick auf das Gesamtwerk zu interpretieren. Dabei steht nicht unbedingt die Frage im Vordergrund, ob der Autor sich bewusst an einem solchen Muster orientiert hat, sondern vielmehr inwieweit das heuristische Potenzial eines bestimmten Blickwinkels für die Analyse des Werkes trägt. Die Wahl der Interpretationsmethode ist abhängig von Kriterien quantitativer und qualitativer Art.. Interessant sind die Häufigkeit des Auftretens einer Struktur und ihre Beschaffenheit, d.h. ihre Augenfälligkeit sowie Differenzen zwischen den einzelnen Aktualisierungen innerhalb des Textes.
Tritt man unter dieser Perspektive an Daniel Pennacs Roman „Au bonheur des ogres“ heran, so wird mit voranschreitender Lektüre immer deutlicher, dass Pennac seinen Text ständig in Verhältnis zu anderen Texten setzt.Genauer: Er bezieht fremdes Material durch Zitat und Anspielungen ein und verwendet teilweise Textstrukturen als Folien – sei es, dass sie das Original überlagern oder dass sich beide deutlich voneinander abheben. Das Phänomen ist bei Pennac derart evident und allgegenwärtig, dass es in einer Interpretation seines Romans zwingend zur Sprache kommen muss, wenn es nicht sogar, wie in der vorliegenden Arbeit, alleiniges Objekt der Untersuchung ist.
Pennac ist nicht der erste, der in seinem Werk auf andere Texte implizit oder explizit Bezug nimmt. Auch die Erforschung dieser Technik ist nicht neu. Der Ansatz, der sich zur Bestimmung dieser Technik schließlich auf breiter Basis in der Literaturwissenschaft durchgesetzt hat, ist das mit dem Begriff der „intertextualité“ überschriebene Konzept von Julia Kristeva[1]. Mit wenigen Modifikationen stellt es auch für die hier vorgeschlagene Interpretation von „Au bonheur des ogres“ das Instrument der Wahl dar. Ziel der Analyse soll sein, mit Hilfe des Konzeptes der Intertextualität Beziehungen zwischen dem Roman und anderen Texten zu klassifizieren und ihre - möglicherweise verschobenen - Bedeutungen zu finden.
Angesichts der Fragestellung der vorliegenden Arbeit bietet sich die Einteilung in zwei Blöcke an. In einem ersten Teil werden Referenzen untersucht, die sich nicht auf einen konkreten Einzeltext beziehen, sondern charakteristische Strukturen eines Genres parodisierend wiedergeben. Nach der Terminologie von Ulrich Broich und Manfred Pfister (1985) widmet sich dieser Abschnitt der Systemreferenz in „Au bonheur des ogres“. Der zweite Teil geht dagegen auf Verweise ein, die einen bestimmten Autor oder Text evozieren; der Roman wird im Hinblick auf Einzeltextreferenz untersucht. Dabei soll neben der jeweiligen Referenzmethode auch die Bedeutung des Verweises für den Text zur Sprache kommen.
2. Konzepte
Vor der eigentlichen Bearbeitung des Problems von Parodie und Intertextualität im vorliegenden Roman sollen zunächst Konzepte und Terminologien, die bei der Analyse zum Tragen kommen, näher vorgestellt werden.
2.1 Intertextualität
Begründer der modernen Analyse von textübergreifenden Beziehungen ist Michail Bachtin. Sein Konzept der Dialogizität beschreibt die Besonderheit bestimmter Gattungen - zu denen er u.a. auch der Roman rechnet - die von „zweifacher Gerichtetheit des Wortes“ oder „Zweistimmigkeit“ geprägt sind; diese Zweistimmigkeit resultiert aus der Überlagerung der Intentionen des Autors mit der Stimme bzw. den Intentionen, die er den (Roman-) Figuren in den Mund legt. In der Tradition des mittelalterlichen Karnevals stehend, hat die Dialogizität subversives Potential (vgl. Pfister 1985a S. 3 ff.).
Der in der modernen Literaturwissenschaft gängige Begriff von Intertextualität geht zurück auf Julia Kristeva, die im Gegensatz zum vorwiegend intratextuellen und synchronischen Konzept Bachtins in ihrem Modell die diachronischen Beziehungen zwischen Texten hervorhebt (vgl. ebd., S. 4 f.). Auch Kristevas Textbegriff unterscheidet sich von dem Bachtins: Sie definiert „letztendlich alles, oder doch zumindest jedes kulturelle System und jede kulturelle Struktur“ als Text (ebd. S. 7), was folgerichtig zu einer „globalen Konzeption eines unendlichen Intertexts“ führt (ebd. S. 13). Die Vorstellung von der Welt als einziger universaler Intertext, innerhalb dessen sich die Grenzen einzelner Texte auflösen (vgl. ebd. S. 12), ist zwar aus philosophischer Perspektive interessant, birgt aber für die konkrete Textanalyse wenig heuristisches Potenzial (vgl. ebd. S. 15).
Aus oben genanntem Grund soll für den Rahmen der vorliegenden Arbeit der entgrenzte Textbegriff Kristevas eingeengt werden, sodass Intertextualität
zum Oberbegriff [wird] für jene Verfahren eines mehr oder weniger bewußten und im Text selbst auch in irgendeiner Weise konkret greifbaren Bezugs auf einzelne Prätexte, Gruppen von Prätexten oder diesen zugrundeliegenden Codes und Sinnsystemen (…). (ebd. S. 15)
An dieser Stelle kann unterhalb des Begriffes eine Kategorisierung vorgenommen werden, die für die weitere Analyse eine wichtige Rolle spielt: Bei Bezug des Textes auf einen konkreten Prätext wird von Einzeltextreferenz (vgl. Broich 1985b, S. 48), bei Bezug auf „Gruppen von Prätexten oder diesen zugrundeliegenden Codes und Sinnsysteme“ wird von Systemreferenz gesprochen (vgl. Pfister 1985b, S. 53). Das intertextuelle Verfahren der Parodie, das weiter unten noch genauer zur Sprache kommen wird, fällt in den Bereich der Systemreferenz.
Nach der Abgrenzung des Intertextualitätsbegriffes, der in dieser Arbeit verwendet wird, soll im folgenden ein kurzer Überblick über Klassifikationsversuche der Verbrechensliteratur gegeben werden, um spätere Unklarheiten zu vermeiden.
2.2 Die Kriminalliteratur und ihre Strömungen
Bei der Abgrenzung unterschiedlicher Strömungen innerhalb der Literatur, die sich im weiteren Sinne mit Verbrechen befasst, scheint es keine völlige Einigkeit unter den Forschern zu geben: Richard Alewyn grenzt den Kriminalroman vom Detektivroman ab (Alewyn 1971, S. 373), während Peter Nusser den Kriminalroman als Oberbegriff für Detektivroman und Thriller verwendet (Nusser 1980, S. 1 f.). Für die vorliegende Untersuchung bietet die Unterscheidung zwischen Detektivroman und Thriller mehr analytische Möglichkeiten. Sie soll daher bei der Interpretation herangezogen werden.
Unter dem Oberbegriff der Kriminalliteratur - solcher Texte also, die sich mit der Aufdeckung von Verbrechen befassen - stehen die Gattungen des Detektivromans und des Thrillers. Nusser sieht den Hauptunterschied der beiden Gattungen auf inhaltlicher Ebene und zwar in den Handlungsweisen des Detektivs und der Art ihrer Darstellung. Der Thriller stellt eine „Kette aktionsgeladener Szenen“ (ebd., S. 3) dar, in der sich der Held v.a. mit Muskelkraft und Waffengewalt behauptet. Der Detektivroman hingegen hat seinen Schwerpunkt im Erzählen detektivischer Nachforschungen, die der Held mit meist wissenschaftlichen Methoden anstellt. Neben diesem Merkmal unterscheidet sich der Detektivroman vom Thriller insofern, als das aufzuklärende Verbrechen immer Mord ist (vgl. Alewyn 1971, S. 373), und als dieser Mord auf die (unschuldig erscheinende) Umgebung, in der er geschieht, einen verfremdenden Effekt ausübt (vgl. ebd., S. 398). Diese Verfremdung ist beim Thriller weniger bis gar nicht ausgebildet, da der Schauplatz, an dem das bzw. die Verbrechen stattfinden, häufig in der „rauhe[n] Wirklichkeit der Unter- und Halbwelt“ liegt (Alewyn 1971, S. 398).
Ein weiterer wesentlicher Unterschied liegt auf der formalen Ebene, genauer in der Chronologie des Erzählens: „Der Kriminalroman[2] erzählt die Geschichte eines Verbrechens, der Detektivroman die Geschichte der Aufklärung eines Verbrechens“ (Alewyn 1971, S. 375). Im Detektivroman ist der Leser demnach mit zwei gegenläufigen Zeitvektoren konfrontiert, dem chronologischen Vektor der Erzählung der Aufklärungsprozesse und dem zeitlich invertierten Vektor der Verbrechensrekonstruktion (vgl. Nusser 1980, S. 34 f.).
3. Gattungsparodie in „Au bonheur des ogres“
3.1 Die Parodie als intertextuelles Mittel
Wie oben bereits erwähnt, gehört die Parodie zur Klasse der Systemreferenz. Die Parodie konstituiert sich in der - weitgehend impliziten - verfremdenden Bezugnahme auf einen einzelnen Text, einen Diskurstyp (vgl. Pfister 1985b, S. 54), eine Textgruppe oder eine Gattung. Intertextualität ist also ihr wichtigstes Merkmal, erst durch den Bezug zu einem anderen Text erhellt sich ihre Bedeutung (vgl. Müller 1994, S. 147). Die „Reaktion“ der Parodie auf andere Texte geschieht nie um ihrer selbst Willen, sondern ist immer Ausdruck einer Auseinandersetzung mit Methoden und Intentionen der Prätexte (vgl. Freund 1981, S. 14). Durch Analogie und Abweichung entstehen zwischen Parodie und Parodiertem Spannungen, die Komik erzeugen können (vgl. Müller 1994, S. 147) und die gleichzeitig auch die kritische Intention ihres Autors offen legen (vgl. Freund 1981, S. 11).
Der Begriff der Gattungsparodie beschreibt den Typ von Parodie, deren Vorlage Strukturen und Codes sind, die für eine ganze Gattung charakteristisch sind. Ihre intertextuelle Bezugnahme spiegelt sich also nicht (nur) auf der Textoberfläche wider, sondern v.a. in Stilelementen und im inhaltlichen Aufbau des Textes.
Für die sinnvolle Analyse eines parodistischen Textes ergibt sich daher die Notwendigkeit, die Vorlage ausreichend zu kennen. Im aktuellen Fall einer Gattungsparodie müssen also zunächst typische Strukturen der Zielgattung, hier des Detektivromans, ausgemacht werden.
3.2 Strukturelemente des klassischen Detektivromans
Der Detektivroman zeichnet sich, wie wohl kaum ein anderes literarisches Genre, durch strenge Regeln aus, besonders auf inhaltlicher Ebene. Einen exemplarischen Katalog legt S. S. van Dine vor, in dem er die Eigenschaften einer guten Detektivgeschichte katalogisiert (vgl. Dine 1971, S. 143 ff. ). Diese Regeln sind ein günstiger Ausgangspunkt für die nähere Betrachtung zentraler Strukturelemente.
3.2.1 Handlungsmuster
Die Handlung des Detektivromans lässt sich untergliedern in die drei Bereiche ‚Action’, ‚Analysis’ und ‚Mystery’. Die ‚Analysis’, die alle Elemente umfasst, die zur Rekonstruktion des Tatherganges beitragen, steht in direkter Konkurrenz zur Verschleierung des Geschehenen durch ‚Mystery’. Die klassische Analysis-Situation findet sich im Frage-Antwort-Spiel, bei dem der Detektiv Verdächtige vernimmt und (implizit oder explizit) einen Katalog von W-Fragen abarbeitet (vgl. Alewyn 1971, S. 382 f.). Als ‚Action’ werden allgemein Textabschnitte bezeichnet, die erzählend die Handlung vorantreiben (vgl. Nusser 1980, S. 33 f.).
Besonders das Verbrechen, das am Beginn aller Handlungen des Detektivromans steht und gewissermaßen den Auslöser darstellt , ist festgelegt: „Im Detektivroman muß es ganz einfach eine Leiche geben, und je toter sie ist, desto besser[3] “ (ebd., S. 144). Helmut Heißenbüttel gibt zusätzlich noch eine Angabe über die Position des Mordes im Roman: „Der Ermordete, der entweder vor Beginn der Erzählung oder auf den ersten Seiten sein Ende findet, bringt alles in Gang“ (Heißenbüttel 1971, S. 360). Nach dem Mord tritt der Detektiv[4] auf, es folgt zwangsläufig die Fahndung, die mit der Aufklärung des Mordes beendet ist. Den quantitativ weitaus größten Teil nimmt dabei die Fahndung ein (vgl. Nusser 1980, S. 34 f.), hier entwickelt sich Spannung – ein zentrales Merkmal des Detektivromans (vgl. Suerbaum 1971, S. 446). Der Mittelteil lässt sich wiederum aufgliedern in Beobachtung, Verhör, Beratung, Verfolgung (vgl. Nusser 1980, S. 28). Bei der Anordnung dieser Handlungselemente genießt der Autor größere Freiheit. Hier lässt sich auch der oft gebrauchte Vergleich der Detektivgeschichte mit dem Kreuzworträtsel zitieren[5]: Der Autor muss Personen, Motive, Räume, clues[6], Verhöre usw. so platzieren, dass der Detektiv (und auch der Leser) sie logisch verknüpfen kann und sie ihn schließlich zum Täter führen.
Im klassischen Detektivroman hat die Auflösung des Falles ihre eigene Choreographie. Oberste Regel ist der glückliche Ausgang der Geschichte. Seinen Ursprung hat das Happy End vermutlich im Grundsatz der Autoren, Verbrechen dürfe sich keinesfalls auszahlen (vgl. Schmidt 1989, S. 38 f.). Die endgültige Überführung findet coram publico statt. Die Verdächtigen werden versammelt und der Detektiv rekonstruiert den Tathergang, um schließlich den Täter zu überführen (vgl. Nusser 1980, S. 32 f.). Nach einem steilen Anstieg der Spannungskurve gipfelt die Handlung in dieser Pointe, die so weit wie möglich hinauszuzögern der Autor bemüht ist – schließlich ist der Leser in der folgenden Entspannungsphase weniger zum Weiterlesen motiviert, und die Geschichte sollte schnell ihr Ende finden.
3.2.2 Figurentypologie des Detektivromans
Peter Nusser teilt die Figuren des Detektivromans in zwei Gruppen ein: die kleine Gruppe der Ermittelnden und die große der Nicht-Ermittelnden (vgl. Nusser 1980, S. 38 ff.). Die nicht-ermittelnde Gruppe „bildet immer einen geschlossenen Kreis, d.h. die Figurenanzahl ist begrenzt, überschaubar und konstant“ (ebd.). Die Bildung des geschlossenen Kreises kann intrinsisch (Verwandtschaft, Beruf o.ä.) oder extrinsisch (Zugabteil, Insel o.ä.) motiviert sein (vgl. ebd., S. 39). Zum gesellschaftlichen Status der beteiligten Figuren kann man lediglich feststellen, dass sie vorwiegend aus gehobeneren Schichten stammen[7]. Die Gruppe der Nicht-Ermittelnden präsentiert sich gleichzeitig als die Gruppe der Verdächtigen, denn verdächtig sind zunächst alle[8].
Auch der Mörder ist Mitglied des hermetischen Zirkels. Das Primat der Spannungserzeugung gebietet, dass er sowohl unauffällig ist, als auch auf den Leser als unwahrscheinlicher Täter wirkt (vgl. ebd., S. 41). Zur Herkunft des Mörders ergänzt van Dine: „Geheimbünde, Camorras, Mafias usw. haben keinen Platz in der Detektivgeschichte“ (Dine 1971, S. 145). Die Verantwortung würde sich auf mehrere Figuren verteilen, der Mörder wäre dann lediglich die Exekutive eines vielköpfigen Apparates – auch ein Happy End wäre ausgeschlossen, da der Held eine ganze Verbrechervereinigung zu überführen hätte, was den beschaulichen Rahmen der Detektivgeschichte sprengen würde: „(…) die ganze Last des Lesers muß auf einem Paar Schultern ruhen: der ganze Unwille des Lesers muß sich auf ein einziges schwarzes Schaf konzentrieren können“ (ebd.).
Bei sämtlichen Charakteren der nicht-ermittelnden Gruppe lässt sich eine starke Typisierung feststellen, sie besitzen weniger eine Psychologie als vielmehr eine Funktion im Text (vgl. Nusser 1980, S. 39 f.), vergleichbar mit Schachfiguren. Für die Rätselstruktur des Detektivromans sind subtile Charakteranalysen letztendlich irrelevant (vgl. Dine 1971, S. 145). Großzügige Darstellungen des inneren Erlebens der Figuren finden hier deshalb keinen Platz.
Wie bereits erwähnt, ist der Detektiv die einzige garantiert integre Figur. Als Repräsentant des Lesers im Roman gehört er jedoch, überspitzt formuliert, „so wenig wie der Leser dem Personenkreis an, in dem das Verbrechen geschehen ist[9] “ (Alewyn 1971, S. 384 f.). Bei dieser Funktion wäre zu erwarten, dass sich der Leser mit ihm identifizieren soll, doch dagegen wirken die meist exzentrischen Charakterzüge des Detektivs, die ihn trotz, oder gerade wegen seiner kriminologischen Genialität zum Außenseiter machen (vgl. ebd., S. 385). Die gesellschaftliche Isolation des Detektivs spiegelt sich auch in seiner Unempfänglichkeit gegenüber erotischen Verlockungen wider (vgl. Nusser 1980, S. 45). Der Prototyp des dandyhaften, eigensinnigen Privatdetektivs ist A. C. Doyles Sherlock Holmes:
Er schnupft Kokain, injiziert sich Morphium, um die Langeweile des menschlichen Daseins besser zu ertragen, ist ein Virtuose auf der Violine und legt seinen Hochmut über die weniger klugen Durchschnittsmenschen selbst gegenüber seinem Assistenten und Chronisten Watson nie ganz ab. (Schmidt 1989, S. 46)
Doyle stellt mit verschiedenen Techniken Ansatzpunkte für Identifikation her, doch sie soll offensichtlich nicht zu stark werden; schließlich sind auch die meisten Leser die Durchschnittsmenschen, über die sich der Held erhebt. Der Detektiv ist ein unnatürliches Wesen, undurchschaubar und unerreichbar. Auch wenn er sich durch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten als „Zielscheibe der Projektion von Wunschvorstellungen“ (Nusser 1980, S. 45 f.) darbietet und gewiss Grundwerte verkörpert, die vom Leser geteilt werden, so kann wohl eher von „Mit-Gehen“ als von Identifikation gesprochen werden.
Das Mordopfer schließlich hat in seiner Rolle als „Hebel, der der Story den Anstoß liefert“ unter den Romanfiguren „den geringsten personalen Stellenwert“ (Heißenbüttel 1971, S. 360 f.). Mit seinem Tod hat das Opfer seine Aufgabe erledigt, und das bereits zu Beginn der Erzählung.
3.2.3 Struktur der Schauplätze
Der Detektivroman fordert fast ebenso streng die Einheit des Raumes wie das klassische Theater. Der isolierte Raum hat die Aufgabe, einerseits die Einheit der Figuren extrinsisch zu motivieren und andererseits das Feld der Nachforschungen des Detektivs konstant zu halten[10] (vgl. Nusser 1980, S. 50). Er stellt, um in der obigen Analogie zu bleiben, das Schachbrett dar, auf dem der Autor seine Figuren positioniert und wo sich die Realität den Regeln des Detektivromans beugt[11]. Zur Auswahl der Schauplätze, deren Beschaffenheit eng mit dem sozialen Status der dort agierenden Personen zusammenhängt, schreibt Nusser:
Die gewählten Schauplätze (Expreßzug, Flugzeug, Villa, Club, College usw.) vermitteln dem Leser alle das Wohlgefühl, das entweder von der Atmosphäre bürgerlichen oder aristokratischen Wohlstands ausgeht oder aber (…) zumindest von der Atmosphäre familiärer Geborgenheit („familiar homeliness“). (Nusser 1980, S. 52)
Als Schauplatz unpassend wäre demnach beispielsweise eine alte Baracke, in der eine Gruppe von Geschäftsleuten eingeschlossen ist.
Zur Erhöhung der Rätselkomplexität und zum Aufbau von Spannung trägt nicht nur die Isolation des Raumes bei, sondern auch die Anordnung der Objekte am Tatort. Detailreiche Schilderungen ihrer Eigenschaften und Disposition machen den Leser mit dem (Tat-)Ort vertraut, doch es sind gerade die genauen Darstellungen des Interieurs, die ihn aufmerken lassen sollen. Denn im Detektivroman wird nichts um seiner selbst Willen dargestellt: „Ein Detektivroman sollte keine langen beschreibenden Passagen, kein literarisches Verweilen bei Nebensächlichkeiten (…) enthalten“ (Dine 1971, S. 145).
Wie auf der makroskopischen Ebene des Schauplatzes stellt sich auf der mikroskopischen Ebene der Gegenstände ein Verfremdungseffekt ein: Die ursprüngliche Vertrautheit des Lesers mit der Umgebung wird von zunehmendem Misstrauen - u.a. gelenkt vom kritischen Blick des Detektivs - korrumpiert (vgl. ebd., S. 51 f.). Durch die Augen des Helden blickt er aus einer anderen Perspektive auf den Tatort. Wo er zuvor nur ein bewohntes Zimmer sah, entdeckt er nach und nach ‚clues’ aller Art: „Es gibt nichts, was zu trivial wäre, um nicht zum clue werden zu können“ (Alewyn 1971, S. 388). Die Clues als Differenz des aktuellen Zustandes eines Objekts vom gewöhnlichen Zustand führen den Detektiv gewissermaßen zurück in die Vergangenheit, in ihnen wird die Geschichte greifbar und nachvollziehbar.
3.3 Strukturelemente und Parodie in „Au bonheur des ogres“
Nachdem in den vorangehenden Abschnitten verschiedene Charakteristika des klassischen Detektivromans aufgezeigt und erläutert worden sind, sollen im folgenden Struktur und Inhalt des Romans „Au bonheur des ogres“ von Daniel Pennac analysiert und auf Analogie bzw. Unterschiede zum Detektivroman untersucht werden, wobei auch mögliche Intentionen des Autors zur Sprache kommen. Um zu vermeiden, dass die spätere Analyse mit notwendigen Erklärungen zum Inhalt überfrachtet wird, soll zuvor die Handlung kurz dargestellt werden.
3.3.1 Inhaltlicher Abriss
Benjamin Malaussène, Angestellter in einem großen Pariser Kaufhaus, trägt nach dem Rückzug seiner Mutter aus dem Familienleben die Verantwortung für seine fünf Halbgeschwister. Sein Alltag als Sündenbock in der Kundenserviceabteilung nimmt eine andere Richtung, als am Abend des 24. Dezember im Kaufhaus eine Bombe explodiert, die einen Menschen tötet. Da er in nächster Nähe der Explosion stand, ist er für den Polizeibeamten Coudrier der Hauptverdächtige. Dessen Verdacht erhärtet sich, als einige Tage später eine weitere Bombe explodiert und zwei Personen in den Tod reißt – auch diesmal war Malaussène am Tatort. Kurz zuvor hatte er noch eine attraktive Ladendiebin, die er „Tante Julia“ nennt, vor der Verhaftung durch den Kaufhausdetektiv bewahrt. Im Laufe der Zeit explodieren noch zwei weitere Bomben nach dem gleichen Schema, jede fordert ein einzelnes Opfer (bei der vierten Bombe aber ist nicht Malaussène anwesend, sondern seine Halbschwester Thérèse). Für die Polizei deuten alle Indizien auf den Helden hin, dessen ganze Familie einschließlich Hund Julius nach und nach involviert wird. Malaussène beginnt schließlich seinerseits Nachforschungen anzustellen. Sekundiert wird er dabei von seinen Geschwistern Thérèse, die mittels Astrologie Zusammenhänge zwischen den Opfern herzustellen versucht, der photographiebegeisterten Clara, und Jérémy, der während des Schulunterrichts experimentell eine der Kaufhausbomben nachbaut. Doch auch das Zusammenwirken der verschiedenen Helfer (zu denen auch die Ladendiebin gehört, mit der er ein Verhältnis eingeht) kann den Täter nicht überführen. Dieser gibt sich ihm schließlich selbst zu erkennen und deckt dabei die Geschichte auf, die hinter der Mordserie steht: Alle Opfer waren Mitglieder in einer satanistischen Vereinigung, deren Verbrechen er gerächt habe. Außerdem kündigt er auf Tag und Stunde genau einen letzten Mord an, bei dem auch Malaussène zugegen sein werde. Benjamin findet sich zum angekündigten Zeitpunkt im Kaufhaus ein, der Mörder ist ebenfalls dort. Als dieser einen Spielzeugroboter auf ihn losschickt, fürchtet er um sein Leben, versucht ihn zu entschärfen – und zündet dabei die Bombe, die der Mörder am Körper trägt. Mit diesem finalen Selbstmord hat er sein Werk vollendet: Alle sechs Mitglieder des Satansbundes sind ausgelöscht, und die Schuld daran hängte er dem Sündenbock Benjamin an. Glücklicherweise lässt sich Kommissar Coudrier nicht täuschen, und mit dem letzten Toten fügt sich für ihn der perfide Plan zusammen, dessen eigentliches Opfer immer Malaussène hatte sein sollen.
3.3.2 Die Figuren
3.3.2.1 Das familiäre Umfeld
Im Hinblick auf eine Beschreibung der Hauptfigur Benjamin Malaussène erweist sich zunächst eine nähere Betrachtung seine Umfeldes als hilfreich. Denn im Gegensatz zum typischen Einzelgängerhelden des Detektivromans, der allenfalls noch einen treuen Begleiter hat (vgl. Nusser 1980, S. 48), ist Malaussène von einer vielköpfigen Familie umgeben, für die er die Verantwortung trägt.
Mit der Einführung einer Familie, die zudem beträchtlichen Einfluss auf den Handlungsverlauf hat, erscheint ein Element, das im klassischen Detektivroman keinen Platz findet[12]. Wenn sie dennoch erwähnt wird, dann kann das der Erhöhung der Rätselkomplexität dienen, aber nicht der Erzeugung von Atmosphäre. Im vorliegenden Roman wird die Differenz noch dadurch verschärft, dass die Familie Malaussène hinsichtlich ihres Kinderreichtums fast eine Großfamilie ist: Vom Kind (der namenlose „le petit“ bzw. „l’enfant“, S. 20) bis zur jungen Frau in den Zwanzigern (Louna) sind alle Stadien der Entwicklung vertreten. Die Mitglieder der Familie leben miteinander in einem Haushalt, der sogar ein Haustier umfasst. Die flächendeckende Präsenz der Familie als Ganzes sowie der einzelnen Familienmitglieder bildet ein konstantes, fast schon idyllisches Moment emotionaler Stabilität. Dieses wird gleich zu Beginn manifest in der unmittelbaren Reaktion der Familie auf die erste Kaufhausbombe, repräsentiert durch Lounas Sorge:
Au moment où j’arrive, le téléphone est en train d’insister. Je me précipite toujours quand on me sonne.
– Ben, tu n’as rien?
C’est Louna, ma sœur.
– Comment ça, rien?
– La bombe, au Magasin… (S. 23)
Selbst die Mutter, deren Rückzug aus der Familie Spekulationen über ihr Verantwortungsbewusstsein erlaubt, erkundigt sich umgehend nach Benjamin:
A peine ai-je raccroché, complètement lessivé, que ça résonne.
– Allô, mon tout-petit, ça va?
Maman. (S. 24)
Das dritte Kapitel stellt auf wenigen Seiten das familiäre Umfeld von Benjamin Malaussène vor. Die Dialoge sind von Wärme geprägt, die aber nicht die familiären und persönlichen Probleme der Mitglieder verdeckt: Lounas Abtreibungsgedanken (S. 23), die Selbstvorwürfe der Mutter (S. 25) und die beunruhigenden Monsterzeichnungen des „Petit“ (S. 26 f.). Für Malaussène stellt sich die Familie als ein Refugium dar, sowohl vor dem emotional anstrengenden Berufsalltag als auch vor den zusätzlichen psychischen Belastungen, die die Verdächtigungen von Seiten der Mitarbeiter bedeuten. Die Kehrseite des Familienlebens ist die Verantwortung, die seine Rolle mit sich bringt. Er sieht sich selbst als „pédagogue“ und „éducateur“ (S. 223), als „frère de famille“: Das in dem Wortspiel enthaltene „père“ gibt den väterlichen Aufgabenbereich[13] wieder, den er übernommen hat. Wie folgender Textausschnitt verdeutlicht, kennt er die individuellen Probleme jedes einzelnen Familienmitgliedes:
– Jérémy n’est pas collé cette semaine ? (…)
– Thérèse s’est convertie au rationalisme ? (…)
– Les cartes disent que tu auras la moyenne à ton bac de français ? (…)
– Le Petit ne rêve plus d’Ogres Noël ? (…)
– Louna fait une grossesse nerveuse ? (S. 141)
Der (hier um Claras Repliken gekürzte) stichomythische Dialog fasst mit viel Humor die ungewöhnlichen Sorgen zusammen, denen Benjamin sich stellen muss.
In vielerlei Hinsicht besondere Momente sowohl der Verarbeitung der Geschehnisse als auch des Gemeinschaftsgefühls sind die abendlichen Geschichten, die Benjamin seinen Geschwistern erzählt und deren Inhalt stark an den tatsächlichen Vorfällen des Tages angelehnt ist. Funktionen und Auswirkungen dieser Technik des Autors sollen jedoch an späterer Stelle genauer analysiert werden.
Der Raum, den Pennac der Familie im Roman einräumt, ist umso größer, als die Aufklärung des Falles zu einem großen Teil der mit empirischen (Jérémys Nachbau der Kaufhausbombe, S. 223) und rationalen[14] (Thérèses astrologische Gedankenexperimente) Methoden geführten Untersuchungen der Geschwister zu verdanken ist. Benjamin selbst trägt letztlich wenig zur Auflösung bei, er ist (auch im etymologischen) Sinn eine eher passive Figur.
3.3.2.2 Benjamin Malaussène
Der Erzähler in „Au bonheur des ogres“ hat, nach der Klassifikation der Erzählperspektiven von Gérard Genette, den Status „intradiégétique - homodiégétique“ inne (vgl. Genette 1972, S. 255 f.), dies gilt ohne Einschränkung. Aus der Perspektive von Benjamin Malaussène, des Helden des Romans, wird der Leser durch die Geschichte geführt, in die Malaussène selbst involviert ist. Bereits auf dieser Betrachtungsebene lässt sich ein Bruch mit der traditionellen Detektivgeschichte erkennen, die die „neutrale“ dritte Person oder die Ich-Perspektive des Gefährten vorzieht, jedoch niemals den Detektiv selbst erzählen lässt[15]. Im Laufe der Analyse werden im Roman noch weitere charakteristische Elemente des Thrillers aufgedeckt werden, deren spielerische Kombination mit typischen Elementen der Detektivgeschichte ein wesentliches Merkmal des Schreibens von Daniel Pennac ist.
Im Gegensatz zum Helden[16] des klassischen Detektivromans, der vorwiegend den Leser im Roman vertritt, ist Malaussène eine vollwertige Figur mit Persönlichkeit und mit einem Leben außerhalb des Kriminalfalles, ein Subjekt mit einer Vergangenheit, die bis in die Erzählgegenwart hineinreicht:
Elle [Maman] fait allusion à la gentille quincaillerie du rez-de-chaussée où j’ai passé mon enfance à ne pas apprendre le bricolage, et qu’on a fini par transformer en appartement pour les enfants. (S. 24)
Mit dem rational agierenden Helden des Detektivromans oder mit dem treffsicheren und schlagkräftigen Thrillerhelden hat er überhaupt wenig gemeinsam. Ganz im Gegenteil: Als Sündenbock des Kaufhauses ist er nur dazu da, die Wut der Kunden auf sich zu nehmen und bei ihnen „compassion“ zu erwecken (S. 16). Doch gerade im Fehlen herausragender Fähigkeiten steckt, was die Figur Benjamin Malaussène auszeichnet: seine Menschlichkeit. Sein Verhalten ist in den meisten Fällen das von jedermann. Als er die Überreste des ersten Bombenopfers sieht, muss er sich ganz unheldenhaft übergeben (S. 20). Das Schwärmen „Tante Julias“ von der Standfestigkeit der Südseemänner hat einen fatalen Effekt auf diejenige Benjamins (S. 65 ff.). Während der Held des Thrillers gewöhnt ist, viel Alkohol und Kaffee zu sich zu nehmen, reagiert Benjamin darauf sehr empfindlich: „Au même instant une porte claque et je fais un bond de deux mètres. Putain de café brésilien! Il m’a retourné la peau.“ (S. 77). Von der Innenperspektive unterstützt[17], trägt der sympathische, durchschnittliche Charakter Malaussènes zur Identifikation des Lesers bei.
Die eindeutige Rollenzuordnung des Helden, die im Detektivroman gefordert wird, löst Pennac völlig auf. Malaussène ist alles gleichzeitig, Täter, Opfer, Verdächtiger, Ermittler und wenigstens beim letzten Mord sieht es so aus als wäre er der Täter. Und da er vom eigentlichen Mörder zum Täter gemacht wurde, ist er ebenso Opfer - wie er vermutet, und was am Schluss bestätigt wird. Der Mörder ist soweit erfolgreich, als er Malaussène für die Polizei und andere über lange Zeit zum Hauptverdächtigen macht (selbst für seinen besten Freund Théo, siehe S. 158). Auch die Rolle des Detektivs übernimmt Malaussène streckenweise, denn er stellt auf eigene Faust Nachforschungen an, stellt Hypothesen auf und überprüft sie (wobei er von seinen Geschwistern unterstützt wird).
Pennac spielt auch auf sprachlicher Ebene mit den Genres: Zu Beginn des 25. Kapitels lässt er Malaussène in erlebter Rede die Vorfälle zusammenfassen und Schlussfolgerungen ziehen und zwar in klar strukturierten, rationalen, elliptischen Sätzen in kühler Sprache, die eindeutig dem Stil einer Detektivgeschichte entsprechen:
Admettons. Admettons que note poseur de bombes ne tue pas au hasard. (…) Supposons donc que les flics soient perdus (…). Questions: (…) 1) Pourquoi dans le Magasin exclusivement? Objection, il peut très bien en éliminer ailleurs et que tu n’en saches rien. D’accord, mais peu probable. Quatre victimes en un lieu rendent cette hypothèse peu probable. (S. 180)
Doch bereits auf der nächsten Seite unterbricht er jäh seine Folgerungen, der Mensch Malaussène gewinnt die Oberhand:
Bien, question numéro 5 : qu’est-ce que je viens de faire là-dedans, moi ? Parce que c’est un fait, j’y suis chaque fois que ça pète. Et à chaque fois, je m’en sors vivant. Du coup, sueur froide (…). (S. 181)
Der distanzierte Blick weicht der nackten Angst („sueur froide“), die gehobene Stilebene fällt zurück in die Alltagssprache („ça pète“). Der Versuch Malaussènes, wie ein Meisterdetektiv zu denken, führt zu kurz: Er ist nicht fähig, seine Reflexionen außerhalb des von ihm selbst konstruierten Paradigma zu führen, in dem er das eigentliche Ziel der Attentate ist. Daher bleiben ihm die wahren Zusammenhänge verschlossen. Seinen mangelnden Erfolg erkennend ironisiert er sich selbst als „Benjamin Marlowe ou Sherlock Malaussène[18] “ (S. 182).
So weit zur überspitzt detektivischen Seite Malaussènes; an anderer Stelle geht er wiederum vor wie ein Thriller-Held:
Pas l’ombre d’un client dans le secteur. Au poil. Je presse le pas. On se rencontre.
– Salut, Cazeneuve !
Et je lui balance un uppercut au foie, un vrai, avec tout le poids de mon corps. (J’ai appris ça dans les livres.) Il se casse en deux. J’ai juste le temps de faire un petit saut en arrière, pour qu’il dégeule sur ses chaussures, pas sur les miennes. (S. 127)
Malaussène will sich rächen und er handelt nicht im Affekt. Er schlägt Cazeneuve nicht etwa beim zufälligen Zusammentreffen nieder, sondern plant seinen Angriff aus einem starken Bedürfnis heraus, das ihn fast besessen macht („il faut que je trouve absolument“, „Urgence“, „Doux Jésus, faites qu’il soit encore là“; ebd.). Die Gewaltanwendung wird drastisch geschildert, ein Anglizismus aus der Boxersprache sowie umgangssprachliche Ausdrücke (balancer, dégueuler) deuten Nähe zum Thriller an. Hier relativiert ein Erzählerkommentar, der zusätzlich durch Klammern hervorgehoben wird, das Geschehen,: „J’ai appris ça dans les livres.“ (Dass mit den „livres“ Kriminalromane gemeint sind, ist in dem Zusammenhang evident).
Die wohl am häufigsten thematisierte Rolle Benjamin Malaussènes im Roman ist die des Sündenbocks, die - z.B. durch Tante Julia und den Kommissar Coudrier - oft in einen theologischen und kulturhistorischen Kontext gesetzt wird. In der Einführung des Prinzips Sündenbock entfernt sich „Au bonheur des ogres“ am deutlichsten von der Kriminalliteratur; denn im Südenbock ist angelegt, dass einem Unschuldigen die Schuld an einem für die Gesellschaft mehr oder weniger bedrohlichen Unglück zugeschoben wird. Als Sinnbild für soziale Grausamkeit und Willkür, gegen die ja gerade Polizei und Gesetze vorgehen sollen, hat er keinen Platz im Detektivroman – dort soll ja der wahre Schuldige gefunden werden, und kein Strohmann für dessen Untaten büßen. Ob das für die Realität so gilt ist zweifelhaft. Doch der Detektivroman soll ja nicht primär die Realität abbilden, sondern dem Leser spannende und entspannende Unterhaltung bieten[19]. Pennac treibt das Spiel an die Spitze, indem er den Helden selbst zum Sündenbock macht. Damit bricht er gleichzeitig mit zwei Grundsätzen des Detektivromans: erstens mit der bereits oben beschriebenen Regel, dass der echte Täter überführt werden muss und zweitens mit der Regel, dass der Held nicht selbst der Täter sein darf (vgl. dazu das Zitat in Fußnote 8).
Von Anfang an ist das Thema Sündenbock stark präsent: Schon auf paratextueller Ebene werden zwei Motti aus „Le Bouc Emissaire“ zitiert, und nach nur vier Seiten Text wird die Arbeitstechnik Benjamins erklärt, in der er das Mitleid der Kunden und den Mechanismus des Sündenbocks funktionalisiert. Zweimal erlebt man ihn in Aktion mit Kunden, und sowohl die Mutter mit Kind als auch der furchteinflößenden Taucher ziehen beim Anblick des weinenden Malaussène ihre Beschwerden zurück. Berechnend verrichtet Malaussène seine Arbeit, ohne allzu große Reflexionen über die moralische Bedenklichkeit seiner Methode anzustellen. Erst die belesene Tante Julia ordnet seine Tätigkeit in einen kulturellen Rahmen ein, den Benjamin offenbar kaum nachvollziehen kann:
– C’est mon boulot, oui.
– Mais ce n’est pas un boulot, ça, Malo ! (J’ai toujours détesté être appelé Malo) c’est une vraie tranche de mythe ! Le mythe fondateur de toute civilisation ! Tu as conscience de ça ?
(Allons bon, voilà autre chose, tante Julia qui s’allume.)
– Pour ne pas parler que du judaïsme, par exemple, et du christianisme, son petit frère clean ! Malo, t’es-tu déjà demandé comment Yahvé, le Parano Sublime, faisait fonctionner ses innombrables créatures ? En leur désignant le Bouc Emissaire à chaque foutue page de son foutue Testament, mon chéri ! (…)
(Ma parole, cette fille a une théorie pour chaque micro-circonstance de la vie.) (S. 118 f.)
Malaussène scheint wenig Wertschätzung für die kulturellen und historischen Wurzeln seiner Arbeit aufzubringen, mokiert sich sogar darüber. Er interessiert sich hingegen nur für Julias Begeisterung, die er dann in seinem Racheplan gegen Sainclair einsetzen kann. Mehr Vergnügen bereitet ihm dagegen ihre provokative Bemerkung, er sei in seiner Rolle weniger Masochist als Heiliger (S. 127). Dieses Motiv bildet in der darauffolgenden Prügel-Szene ein komisches Element[20], sei es in Malaussènes herablassend-flegelhaften Ausdrucksweise im Stoßgebet zu Gott („Exaucez mon vœu, bordel!“) oder in der scheinheiligen Rechtfertigung für seine Gewalttätigkeit: „Le problème, avec les saints, c’est qu’ils ne peuvent pas l’être vingt-quatre sur vingt-quatre.“ (ebd.). Religiosität nimmt in seinem Weltbild keinen Platz ein, auch hat er keine beruflichen Ambitionen oder große Ziele, er will nur überleben:
– Mais une chose me tracasse, monsieur Malaussène; pour vous acquitter si parfaitement d’une tâche aussi ingrate, quel est votre secret ? Une philosophie personnelle ?
– Le salaire, patron, la philosophie du gros salaire. (S. 132)
Es liegt gewiss Ironie in seiner Antwort, doch der Tenor ist klar: Als Pragmatiker wäre er wohl bereit, jede Arbeit auszuüben (wie sein Wechsel zum Verlag am Ende des Romans zeigt). Er fühlt sich keinen „hehren Prinzipien“ verpflichtet, es zählt nur das Auskommen.
3.3.2.3 Die Ermittler Caregga und Coudrier
Nach dem ersten Attentat wird Malaussène von Inspektor Caregga verhört, einer typischen Polizistenfigur, humorlos, routiniert, deren Auftritt ihn nicht überrascht: „Exactement ce à quoi je m’attendais.“ (S. 31). Auch der Leser ist darauf vorbereitet, denn gemäß dem Handlungsablauf im Kriminalroman folgt auf den Mord das Verhör der Verdächtigen durch den bzw. die Ermittler. Benjamins Verhör nach dem zweiten Mord führt der Kommissar Coudrier, im Gegensatz zu Caregga
„un chercheur né, sans passion. Il cherche des truands, des assassins, aujourd’hui un poseur de bombes, mais il aurait aussi bien pu partir en quête de la scission de l’atome ou de la potion anti-cancer. Ce sont les hasards de ses études supérieures qui l’ont placé devant moi plutôt que derrière un microscope.“ (S. 76)
Auf den ersten Blick zwar keine sehr faszinierende Gestalt, doch hat sie in ihrem Verhältnis zur Verbrechensaufklärung gewisse Ähnlichkeit mit den rational denkenden Helden der Detektivromane. Außerdem besitzt er Intuition: „Vous ne bénéficiez plus que d’un seul atout : ma conviction intime.“ (S. 238). Er ist es auch, dem am Ende des Romans das Privileg zukommt, die Schlussfolgerungen zu ziehen und die Auflösung des Falles zu verkünden. Dabei werden auch solche Fragen beantwortet, die sich dem Leser bis zuletzt stellen, wie die nach dem Motiv des Mörders (und der Opfer) oder der Übereinstimmung der Tatzeiten mit Thérèses astrologisch getroffenen Vorhersagen (S. 282). Coudrier ist ein ambitionierter Beamter mit einer schrulligen Verehrung für Napoleon Bonaparte, die sich in der Einrichtung seines Büros im Empire-Stil niederschlägt – bei Malaussène bewirkt dies eine Assoziation Coudriers mit Fouché, dem berüchtigten Polizeiminister Napoleons I. (S. 79). Doch auch die intransparente[21] und durch ihre Klarsicht und Autorität relativ ehrfurchtgebietende Figur des Kommissars hat ihre belächelnswerte und durchschaubare Seite:
Léger accroissement de la lumière pour indiquer la gravité du moment. (C’est d’une discrète pression du pied sur une poire ad hoc que le commissaire Coudrier crée ces variations de lumière. Je suppose que chaque flic a son truc à lui.) (S. 235 f.)
Der Metakommentar in Klammern zerstört die suggestive Wirkung der Lichtveränderung. Dramatisierende Techniken dieser Art werden seit je her von Kriminalautoren eingesetzt, um Schlüsselszenen einen außergewöhnlichen Rahmen zu geben. Dabei sind besonders eindrucksvolle, u.U. furchteinflößende Wetterereignisse wie starke Windböen, Donner und Blitze beliebte Requisiten. Pennac geht auf diese Tradition ein und parodiert sie, wobei er sie von jeglichem metaphysischen Zauber befreit und ins Lächerliche zieht.
Unter den Figuren in „Au bonheur des ogres“ ist Coudrier derjenige, der den Überblick behält und die Zusammenhänge erkennt[22] – möglicherweise auch mehr auf Grund seiner Erfahrung und intensiven Arbeit als aus kriminologischer Genialität heraus. Dass Malaussène nicht schon nach den ersten beiden Morden dem allgemeinen Schuldgefühl zum Opfer fällt (vgl. Alewyn 1971, S. 392), hat er Coudrier und dessen Handlanger Caregga zu verdanken: Er ist sein Schützling.
3.3.2.4 Der Täter
Was die Figur des Täters betrifft, geht Pennac kein Risiko ein und orientiert sich auf den ersten Blick stark am klassischen Detektivroman: Der „tout petit vieux à tête de criquet“ (S. 248), einer der Alten, um die sich Théo kümmert, ist schon seit der zweiten Textseite bekannt[23] und wurde auch in überschaubaren Abständen immer wieder erwähnt (S. 135; S. 214). Es handelt sich außerdem um einen einzelnen Täter (er ist zwar mit Weiteren im Bunde, doch deren Kreis ist scharf abgegrenzt). Als problematischer erweist sich die Feststellung der Verantwortung. Der kleine Alte ist kein Mörder im eigenen Interesse, sondern er leistet vielmehr Beihilfe zum Suizid für die Angehörigen der satanistischen Gruppe. Verschärft wird die Lage noch dadurch, dass die Selbstmorde auch dazu dienen, sich aus der Verantwortung für frühere Verbrechen zu ziehen.
In Pennacs Roman können zwei gegenläufige Linien von Verbrechen isoliert werden: Erzählchronologisch stehen die Morde, die sich als Selbstmorde entpuppen, am Anfang. Diese dienen jedoch lediglich der Auslöschung der Erinnerung an die Kindsmorde, die vor ca. 30 Jahren begangen wurden. Die Mitglieder der „Chapelle des 111“ wollen ihre verheimlichten Verbrechen durch öffentliche Verbrechen vergessen machen, eine gegen sich selbst gewandte Form von Selbstjustiz[24]. Der kleine Alte hat Benjamin Malaussène als seinen Henker auserwählt. Er soll die Schuld tragen an den Selbstmorden sowie, indirekt, an den Kindesmisshandlungen tragen.
Die Struktur der Zusammenhänge zwischen Tätern, Taten, Opfern und Strafe in „Au bonheur des ogres“ ist komplex. Man kann Muster auf temporaler und chronologischer sowie auf kausaler Ebene erkennen, die ihrerseits wiederum miteinander verwoben sind. Was Motive und Täter sowie deren Verschmelzung im Verbrechen betrifft, hat Pennac eine weit reichende Mischung aus Einzelmotiv und Gruppenmotiven, individueller Geschichte und soziologischem sowie kulturellem Kontext geschaffen. Diese besondere Mischung erzeugt die Spannung des Romans und weckt bzw. hält das Interesse des Lesers aufrecht.
3.3.3 Handlungsstrukturierung
Wie im klassischen Detektivroman hat die Handlung in „Au bonheur des ogres“ ihren Auslöser in einem Mordfall, doch die nähere Betrachtung der Handlung fördert Brüche zutage, die durch das Spiel Pennacs mit Traditionen des Kriminalromans entstehen. So findet der Mord nicht in übersichtlicher Umgebung und ohne Zuschauer statt, wie es ein diskreter Täter vorziehen würde, sondern inmitten eines großen Kaufhauses zur Weihnachtszeit und unter den Augen einer „foule épaisse de clients“ (S. 11). Für wenig Überraschung sorgt wiederum das auf die Tat folgende Verhör. Das Grundelement Tat-Verhör wiederholt Pennac nun in regelmäßigen Abständen und gibt so der Romanhandlung immer wieder einen neuen Anstoß: Die Romanfiguren befinden sich in ständiger Unsicherheit und erwarten jederzeit einen weiteren Anschlag[25]. Dass die kontinuierliche Dynamisierung der Handlung notwendig ist, zeigt die Reaktion der Kaufhausleitung auf die erste Bombe, deren Spuren sie mit allen Mitteln auszulöschen versucht:
Je passe devant le rayon des jouets. Aucune trace de l’explosion. Le comptoir n’a pas été réparé, mais remplacé, dans la nuit, par le même, exactement. Impression étrange, comme s’il n’y avait pas eu d’explosion, comme si j’avais été victime d’une hallucination collective. Comme si on cherchait à me découper un morceau de mémoire. (S. 43)
Der Kaufhausalltag könnte hiernach wieder in gewohnten Bahn verlaufen, doch die Rückkehr zum Alltag fällt mit jedem Anschlag schwerer. Der Zyklus, die Wiederkehr des Gleichen in partiell abgeänderter Form, ist eine beliebte Technik Pennacs. Sie findet sich auch in den Nachforschungen der Familie Malaussène wieder. Dabei setzen die Geschwister der Reihe nach zu einem bestimmten Zeitpunkt auf unkonventionelle Weise ihre jeweiligen Begabungen ein, um einen Teil des Rätsels aufzuklären[26].
Pennac greift bei der Erzeugung von Dynamik nicht zuletzt auf Techniken zurück, die ihren Ursprung im Film (insbesondere im Kriminalfilm) haben und von dort auch in Comicstrips übernommen worden sind. Dazu gehören Kapitelübergänge, die einen Filmschnitt imitieren:
[Kapitel 27, letzter Absatz, linke Buchseite:]
– OK ma chérie, ça suffit comme ça. Tu me planques soigneusement tout ça, et dès demain je rends la photo à Th¢2222éo pour qu’il l’envoie à la police.
[Kapitel 28, rechte Buchseite:]
– Pas question, plutôt crever ! (S. 202 f.)
Hier liegt eine spezielle Form der „offenen Frage“ am Ende der Seite bzw. im letzten Bild des Comicstrips vor, die dessen Konzeption als Fortsetzungsgeschichte Rechnung trägt. Das Ende des Kapitels kündigt eine Aktion an und versetzt den Leser in eine bestimmte Erwartung, die am folgenden Kapitelanfang direkt verifiziert oder falsifiziert[27] ird. Begünstigt wird das Arbeiten mit Übergängen durch die für den ca. 270 Seiten langen Roman relativ hohe Anzahl von 39 Kapiteln (durchschnittlich umfasst ein Kapitel sieben Seiten). Die resultierende Unterteilung strukturiert den Inhalt insofern, als nahezu jeder Übergang eine lokale oder temporale Verschiebung der Handlung markiert. Comicähnliche Elemente finden sich auch auf inhaltlicher Ebene, wie etwa der abgerissene Arm des Opfers bei der zweiten Explosion, die Cazeneuve im Flug eine Ohrfeige gibt (S. 61).
3.3.4 Struktur der Schauplätze
Die im Detektivroman herrschende Einheit des Ortes wird bei Pennac aufgebrochen. Wie bereits erwähnt, finden die Morde in aller Öffentlichkeit statt. Außerdem steht das Kaufhaus nahezu prototypisch für den offenen Ort, dessen Publikum sich ständig ändert. Die Hauptstränge der Handlung - Anschlagsserie und Aufklärungsversuche - spielen v.a. im Kaufhaus sowie in Malaussènes Wohnung und haben dort ihren stabilen Rahmen. Die zahlreichen Exkurse in ein algerisches Restaurant (S. 52 ff.), ein Krankenhaus (S. 63 f., S. 219 ff.), einen Friedhof (S. 225 ff.) das Verlagshaus (S. 263 ff.) usw. nehmen im Roman wenig Raum ein. Sie lockern auf und bringen teilweise auch über Umwege Beiträge zum Haupterzählstrang (wie der Krankenhausaufenthalt Jérémys nach der Explosion seiner selbstgebauten Bombe).
Die Vielseitigkeit der Orte führt zu einer Entgrenzung der Gruppe der Verdächtigen. Denn jede Person, „die in der Geschichte eine mehr oder weniger bedeutende Rolle gespielt hat“ und „die dem Leser mehr oder weniger vertraut ist“, kommt als Täter in Frage (Dine 1971, S. 144). Pennac hütet sich aber davor, sein Spiel zu übertreiben: Auf der eigenen Suche nach dem Mörder hilft dem Leser die Innenperspektive des Erzählers, die zumindest eine Täterschaft Malaussènes nicht zulässt. Ebenso sicher kann der Leser wohl die minderjährigen Geschwister Malaussène und die Polizeibeamten Caregga und Coudrier ausschließen.
Die Haupthand[28] ung findet größtenteils im Kaufhaus statt. Dort ist Malaussène angestellt, dort trifft er seine exzentrischen Freunden Théo und Stojilkovitch, die ihrerseits viel Zeit im Kaufhaus verbringen und dort geschehen auch die Morde. Der zweite wichtige Ort ist die Wohnung Benjamins, die kontrapunktisch zur bedrohlichen Arbeitswelt für Rückzug und Geborgenheit steht. Die Vermischung der Orte wird erst durch die Attentate im Kaufhaus initiiert. Die Grenzen zwischen den beiden Orten verwischen und im Laufe des Romans durchdringen sich die beiden Welten zunehmend gegenseitig. So finden die Bomben Niederschlag in den Geschichten, die Benjamin seinen Geschwistern erzählt (S. 28) und der Inspektor Caregga führt das erste Verhör in ihrer Wohnung (S. 30). Die Geschwister wenden sich ihrerseits mit wachsendem Interesse den Vorgängen im Kaufhaus zu: Clara macht Photographien für Tante Julias Reportage (S. 129) und schließlich geht Thérèse persönlich dort hin, um ihre Hypothesen zu überprüfen (S. 229).
Durch die Morde selbst findet im eigentlichen Sinne keine Verfremdung des Kaufhauses statt. Diese geht eher von der Kaufhausleitung aus, sei es, dass sie die Auswirkungen der Bombe beseitigt (S. 43: „Impression étrange, comme s’il n’y avait pas eu d’explosion, comme si j’avais été victime d’une hallucination collective.“) oder die Kunden durchsuchen lässt (S. 97). Auch die Kundschaft verhält sich paradox: Gerade der Tatort zieht sie magisch an (S. 48: „Quand je redescends, le rayon des jouets est noir de monde.“) und auch die Durchsuchungen wirken ganz und gar nicht abstoßend: „Il faut croire que la clientèle aime ça.“ (S. 97).
Für die Offenbarung seines Motivs in Gegenwart Malaussènes wählt der kleine Alte die Pariser Metro (S. 248), einen neutralen Ort, der eigentlich ein Un-Ort ist: Sie ist ständig in Bewegung, hat keinen angestammten Platz und im statischen Zustand verliert sie ihre Funktion für die Menschen. Aus dem Thriller sind öffentliche Verkehrsmittel, allen voran Untergrundbahnen, als Schauplätze dramatischer Szenen bekannt. Der Dialog zwischen Malaussène und dem Alten verläuft dagegen ohne Zuschauer und äußerlich unspektakulär: „Pas une seconde il n’a pensé que je pouvais lui sauter dessus, le saucissonner, et le livrer franco de port à Coudrier. Pas une seconde l’idée m’est venue“ (S. 249). Benjamin erlebt die Situation innerlich aber sehr intensiv, was sich in der detaillierten und subtilen Beschreibung des Alten niederschlägt:
Eh bien! Je le tenais mon tueur sans faim, là, assis devant moi.
Il s’était installé comme un nain sur un trône, tortillant ses fesses pour atteindre le dossier. Ses jambes battaient le vide, comme celles de mes petits sur leurs plumards superposés. Et ses yeux brillaient du même éclat que les leurs. [etc.] (ebd.)
Pennac legt den Handlungsschwerpunkt an öffentlich zugängliche Plätze, dennoch spielen sich praktisch alle Interaktionen innerhalb eines Kreises bekannter Figuren ab. Die Zahl der handelnden Akteure vergrößert sich auch im Laufe des Romans nicht signifikant. So bleibt das Geschehen überschaubar, die Geschichte bleibt „gemütlich“ (vgl. Dine 1971, S. 146)
4. Intertextualität in „Au bonheur des ogres“
In den vorangehenden Kapiteln wurde der Roman „Au bonheur des ogres“ aus systemreferentieller Perspektive betrachtet und Ebenen und Techniken der Parodie im Werk vorgestellt. Der zweite Teil der Analyse konzentriert sich auf Textstellen, die sich auf Einzeltexte bezi[29] hen. Dabei sollen verschiedene Typen von Referenz unterschieden und ihre jeweilige Bedeutung im Werk herausgestellt werden.
4.1 Paratextualität
Unter den Komponenten, die das Gesamtwerk konstituieren, werden vom Leser gewiss die Paratexte als erstes wahrgenommen. Eine besondere Stellung kommt hier wiederum dem Titel zu, der Aufmerksamkeit erregen soll und sozusagen die Schwelle in den Text darstellt. Der Titel „Au bonheur des ogres“ ist eine Anspielung auf den Roman „Au bonheur des femmes“ von Emile Zola aus dem Zyklus „Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire.“ Wie jede Anspielung wirkt auch diese nur auf den Leser, der den Prätext zumindest in groben Zügen k[30] nnt. Auf den ersten Blick fällt dann die delikate Ersetzung von „femmes“ mit „ogres“ auf – ein humorvoller Seitenhieb auf die randalierenden Kundinnen des Kaufhauses in Zolas Roman (Au bonheur des dames, S. 125). Auf inhaltlicher Ebene setzt sich der Bezug fort: „Au bonheur des dames“ handelt von einem gleichnamigen großen Kaufhaus in der Pariser Innenstadt, dessen Geschäftsführung bereit ist, mit allen Methoden Kunden zu gewinnen. Pennac transponiert den Schauplatz in einen zeitgenössischen Kon[31] ext. Die kritische Stimme in Zolas Roman, die sich gegen hemmungslose Ausbeutung und Vermarktung richtet (vgl. Schwendemann, S. 370), findet man bei Pennac pervertiert wieder im Anliegen des satanistischen Zirkels, den „temple de l’espérance matérialiste“ zu „profaner en y sacrifiant des victimes innocentes, attirées là par le chatoiement des objets.“ (S. 281 f.).
Als Motti zitiert Pennac zwei Stellen aus „Le Bouc Emissaire“ von René Girard und eine Sentenz von Woody Allen. Auf letztere verweisen mehrere Stellen des Textes, deren Bedeutung nur unter Berücksichtigung der Paratextualität (vgl. Pfister 1985a, S. 17) klar wird: „Pas de doute, il a un don, Sainclair. Il a compris un truc que je ne comprendrai jamais.“ (S. 39). Später bekennt sich Malaussène selbst, nicht ohne gemischte Gefühle und in (bewusster oder unbewusster) Anspielung auf Woody Allen, zum Pfad der Tugend: „Envie démente de faire plonger cette bande d’abrutis. Mais, « vade retro Satanas », l’ange diaphane, en moi, répond « non », tout en se disant que les anges sont des[32] ons.“ (S. 152).
4.2 Autotextualität
Die Autotextualität umfasst Verweise innerhalb des selben Werkes, sie steht am intratextuellen Pol der Skala, die den Grad der Distanz zwischen Text und Prätext markiert (vgl. Broich 1985, S. 49 f.). Es mag Autoren geben, die Intra- und Intertextualität als isolierte Phänomene betrachten. Demnach wäre Intratextualität im Thema der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt. Doch in Pennacs Roman ist das Spiel mit autoreferentiellen Verweisen derart präsent, dass es bei der Analyse nicht außer acht gelassen werden sollte. Des weiteren stellen derartige Verweise naturgemäß Objekte dar, an denen sich Autoreflexivität des Erzählers explizit oder auch implizit kristallisiert. Die Autoreflexivität lässt ihrerseits Rückschlüsse auf das literaturtheoretische Konzept des Autors zu.
4.2.1 Autozitate
Ein Eigenzitat ist besonders augenfällig. Dabei handelt es sich um die ersten vier Sätze des Kapitels 14 (S. 88), die die Niederlage Malaussènes beim Schach spielen gegen Stojilkovitch zusammenfassen. Mit dem exakt gleichen Wortlaut beginnt auf Seite 143 das Kapitel 21, lediglich eingeleitet durch ein vorangehendes „Et[33] ebelote“. Auf der semantischen Ebene liegt jedoch ein gravierender Unterschied vor, denn in Kapitel 14 stellt sich im zweiten Absatz die metaphorische Bedeutung des geschilderten Kampfes heraus, welche auf der Analogie von Schachspiel und Boxkampf aufbaut. Beim Zitat hingegen beziehen sich die Sätze auf eine echte Prügelei, der Malaussène zum Opfer fällt. Pennac spielt mit den Erwartungen des Lesers, zweimal belehrt er ihn eines besseren. Und er geht noch weiter: Malaussène selbst scheint in Erinnerung an das Schachspiel bei der echten Prügelei zu denken, es handle sich wieder nur um ein Spiel. Erst ein stummer Schrei aus dem „Off“ bringt ihm die eigentliche Situation ins Bewusstsein. Narration und Handlung, die Wahrnehmung des Lesers und der Romanfigur vermischen sich kurzzeitig und dies geschieht mit einem hohen Grad an Kommunikativität des intratextuelle[34] Bezugs.
4.2.2 Der Roman im Roman
Das Verhältnis von Literatur und Oralität ist ein Thema, das Daniel Pennac fasziniert. In seinem Plädoyer für das Lesen „Comme un roman“ betont er, auch auf Grund seiner Erfahrung als Französischlehrer, die Bedeutung des Geschichtenerzählens (S. 19 f.) und des Vorlesens (S. 58 f.) als Grundstein für einen späteren Zugang zur Literatur. Seine Faszination spiegelt sich auch in „Au bonheur des ogres“ wider. Benjamin Malaussène erzählt seinen Geschwistern abends Geschichten, in die er Personen und Geschehnisse aus der Romanrealität einbaut. Durch ‚mise en abyme’ entsteht eine Parallelwelt, in der die Realität für den Erzählenden über Verzerrung, Ausschmückung und Erweiterung steuerbar wird.
Intratextualität liegt insofern vor, als der Inhalt der Geschichten an den Roman selbst angelehnt ist, wie z.B. an das erste Attentat (S. 28). Das Beispiel zeigt auch, welch enorme, an den Grenzen zum Irrationalen stehende Umformungen Malaussène vornimmt – die Begründung liefert er gleich mit: „le Petit a eu son histoire d’ogre, Jérémy son récit de guerre, Clara sa dose d’humour“ (ebd.). Da sein Erzählen stark zuhörerorientiert verläuft und das Publikum aus Kindern besteht, muss (und will) er den Inhalt nach den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder ausrichten. Wie anspruchsvoll das Publ[35] kum ist, was Kohärenz und logische Abfolge der Handlung angeht, zeigt sich in den gezielten Nachfragen der Kinder: „Comment il l’a paumé, son vrai bras ? (…) Et comment il s’en est tiré ? (…) Et qu’est-ce qu’il a mangé pendant ces trois jours ?“ (ebd.). Pennac demonstriert, dass der Begriff der Realität relativ ist: Aus der Leserperspektive sind die Geschichten Benjamins Fiktionen zweiten Grades – fiktive Romanhandlung, die ihrerseits fiktionalisiert wird. Für die Figur Benjamin sind seine Erzählungen dagegen Fiktionen ersten Grades, seine eigenen Erlebnisse in abgeänderter Form. Und die Kinder als Publikum können manchmal seine Fiktionen nicht mehr von der Realität unterscheiden, was er gezielt ausnützt:
Pour Julius, il ne faut pas que les petits sachent. Il est trop moche à voir. Alors il s’est fait renverser par une bagnole en venant me chercher hier soir et on l’a transporté dans une clinique pour clebs. « Ses jours ne sont pas en danger. » D’accord ? (S. 108)
Zunächst bleiben derartige ‚mises en abyme’ episodisch. Einen völlig neuen Stellenwert bekommen sie in Kapitel 26. Dort wird der Leser in medias res in eine Geschichte versetzt, die sich stilistisch, erzähltechnisch und inhaltlich stark vom Rest des Romans unterscheidet. Der plötzlich auktoriale Erzähler beschreibt in reißerischem Ton einen gewaltigen Medien- und Polizeieinsatz, an dessen Spitze der sich napoleonesk gebärdende Coudrier steht. Nach fünf Seiten beendet ein Einwurf der Kinder das Illusionsspiel, es wird klar, dass es sich wieder um eine von Benjamins Geschichten handelt.
Über das bereits bekannte Spiel mit der Fiktionalität hinaus - die Nachfragen der Kinder und die opulente Ausgestaltung der Handlung - zieht Pennac in diesem Kapitel noch einmal deutliche Parallelen zwischen Thriller und (Action-) Film. Dafür kombiniert er filmische Techniken, die teilweise sogar explizit erwähnt werden („La caméra saisit leur visage comme ils s’avançaient vers leur chef.“, S. 190), mit dem dramatischen Stil und der bildreichen Sprache des Thrillers („Trois casernes de pompiers lâchèrent leurs monstres rouges dont les chromes hurlaient plus fort que des sirènes.“, ebd.). Dass auch der Thriller logisch schlüssig zu sein hat, wenn er auch weniger Rätsel konstituierende Elemente als der Detektivroman enthält, betont Malaussène, indem er auf unzulässige Erzähl-„Tricks“ hinweist: „Ils cherchent s’il n’y a pas une entourloupe, quelque facilité de narration (ellipse abusive, flou trompeur, escamotage) (…)“ (S. 193 f.).
Wirklich interessant werden derartige Meta-Kommentare unter dem Blickwinkel, dass durch sie nicht nur die Romanfigur Malaussène ihre Erzählungen auf der Metaebene beurteilt, sondern dass sie auf das nächsthöhere Niveau angehoben werden können und dann ni ch t nur im Roman, son dern für den Roman selbst gelten. Über die Figur Benjamin Malaussène reflektiert so gesehen Daniel Pennac über die Regeln des Kriminalromans und er tut dies in einer sehr expliziten Form des „zweifach gerichteten Wortes“.
Und Pennac geht noch weiter: Clara schickt sämtliche Geschichten Benjamins, die Thérèse regelmäßig mitgeschrieben hat, an elf Pariser Verlage. Damit sind die Texte aus der Oralität in die Literalität überführt. Außerdem vervielfacht sich damit auch (potenziell) die Größe des Publikums. Einen Höhepunkt bildet die Ablehnung des Manuskripts[36] durch die Verlagsdirektorin „Reine Zabo“ mit den Worten:
Ecoutez, monsieur Malaussène, ce n’est pas un livre, ça, il n’y a aucun projet esthétique, là-dedans, ça part dans tous les sens et ça mène nulle part. Et vous ne ferez jamais mieux. Renoncez tout de suite, mon vieux, là n’est pas votre vocation ! (S. 266)
Natürlich existieren auch bei dieser Äußerung mehrere Bedeutungsebenen : Auf Romanebene ist sie ganz einfach tragisch-komisch, da sie die selbstschmeichlerischen Hoffnungen Malaussènes zunichte macht, vielleicht doch noch ein gutbezahlter Autor zu werden („Pas désagréable de découvrir qu’on est un génie malgré soi“, S. 263). Außerdem macht sich Pennac in der Reine Zabo und ihrem Adlatus über das affektierte, snobistische Gehabe der Verlagsindustrie lustig („Sourire, toussotement, signes extérieurs de l’embarras distingué“, S. 265). Und schließlich zeugt die Bemerkung von der Selbstironie Pennacs, denn er ist ja der Autor der Folie für Malaussènes verrissenen Roman, von „Au bonheur des ogres“, und die Kritik von Reine Zabo fällt letztendlich auf ihn zurück.
Der Titel des Manuskripts, „implosion“ (S. 264) enthält einen weiteren werkimmanenten Bezug. Im Gegensatz zu den Geschichten selbst, die aus der anaphorischen Aufbereitung entstehen, enthält der von Clara gewählte Titel einen kataphorischen, quasi prophetischen Verweis auf das Ende des Romans. Dort nämlich stirbt der Täter durch eine Bombe, die im Inneren seines Körpers explodiert. Malaussène stellt lapidar fest: „Impl(S. 277).
4.3 Verweise auf Fremdtexte
Die recht große Anzahl an intertextuellen Verweisen lässt sich grob nach der Gattung der Prätexte unterteilen. Dabei gehören sechs der insgesamt ca. 20 unterschiedlichen erwähnten Texte zur Kriminalliteratur, der Rest speist sich aus diversen Genres: Die Spannweite reicht von der Bibel (S. 70) über das klassische Theater Frankreichs (Le malade imaginaire, S. 155) bis zu den Erzählungen von E. T. A. Hoffmann (S. 129). Des weiteren lassen sich Unterschiede feststellen, was die Kommunikativität, d.h. die Deutlichkeit der Verweise angeht. Am weitaus häufigsten lässt Pennac nur den Namen eines Autors fallen, weniger häufig den Titel eines Werkes (ohne den Autor zu erwähnen) und nur selten spielt er auf eine bestimmte Passage an oder zitiert sie gar.
4.3.1 Verweise auf Kriminalliteratur
An der äußeren Grenze der Kriminalliteratur steht der Comicstrip „Tintin“ von Georges Rémi alias Hergé (in der deutschen Übersetzung „Tim und Struppi“), dessen gleichnamiger Held auf seinen Abenteuern immer wieder mit Verbrechern zu tun hat. Diese überführt er meist durch Trickreichtum und Körperkraft. Unvergleichlich mehr als im deutschsprachigen Raum gehören in Frankreich die Geschichten von Tintin seit Jahrzehnten[37] für Kinder und Erwachsene zum Allgemeinwissen. Malaussène, der sich selbst als Experte für die Abenteuer Tintins sieht („je connais les quelque vingt-quatre mille vignettes des albums de Tintin“, S. 85), fordert Sainclair zu einem Wissensduell heraus und muss erkennen, dass dieser auf dem Gebiet ebenfalls bewandert ist[38] (S. 103 f.).
Auch Klassiker der Kriminalliteratur lässt Pennac nicht unerwähnt, allen voran Edgar Allan Poe. Beim Anblick des regungslosen Julius, dessen einziges Lebenszeichen sein Herzklopfen ist, zieht er eine Analogie zu der Erzählung „Das verräterische Herz“; darin treibt die Halluzination, das Herz des Opfers schlüge unter dem Zimmerboden weiter, den Mörder zum Geständnis. Zwei weitere anglophone Klassiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Arthur Conan Doyle und Raymond Chandler, bzw. ihre berühmten Romanhelden Sherlock Holmes und Philip Marlowe, bindet Pennac auf S. 182 ein (vgl. Fußnote 16).
Unter den zitierten Autoren von Kriminalromanen kommt dem Amerikaner schwarzer Hautfarbe Chester Himes ein besonderer Platz zu. Als Malaussène zum wiederholten Male einen schmerzhaften Taubheitsanfall bekommt, hat er eine „vision grotesque“ aus einem Roman Himes’: Er assoziiert sich in seinem Schmerz mit „un grand Noir, courant dans la nuit new-yorkaise, un couteau planté dans la tempe et dont la lame ressort de l’autre côté.“ (S. 212). In Frankreich wurde Himes mit seinen hard-boiled stories bekannt, in denen er ein starkes Engagement gegen Rassendiskriminierung vertritt. Nach einer kurzen Verbrecherlaufbahn verbrachte er mehrere Jahre im Gefängnis. Die Erfahrungen aus dieser Zeit flossen teilweise in seine Erzählungen ein (vgl. WWW-Seite). Pennac räumt zusätzlich Himes’ bekanntester Figur „Coffin Ed“ Platz ein: Für Malaussènes Geschwister sind „Pat les Pattes“ und „Jib la Hyène“, die Protagonisten der abendlichen Geschichten, die Steigerungen von Ed Cercueil alias Coffin Ed und dem „Tchèque en Bois[39] “ (S. 34).
Der einzige frankophone Kriminalautor, auf den im Werk verwiesen wird, ist Gaston Leroux, auf dessen Erzähltechnik Malaussène bei den abendlichen Geschichten rekurriert und sich dafür innerlich bei ihm bedankt (S. 110). Die Parallelen zwischen Leroux und Malaussène bzw. Pennac gehen tiefer, als das kurze Aufblitzen seines Namens zunächst vermuten lässt. An dieser Stelle ist es schwer, zwischen Einzeltext- und Systemreferenz zu unterscheiden, denn die vorliegende Referenz bezieht sich auf die Strukturen im Schreiben eines einzelnen Autors.
Wenn Leroux’ Detektiv Rouletabille davor warnt, sich nicht „durch die Außenseite der Dinge verführen zu lassen“ (vgl. Roudaut 1971, S. 101), verstößt Malaussène auf der ganzen Linie gegen diese Regel: Bis kurz vor dem Ende ist er davon überzeugt, dass es der kleine Alte auf ihn abgesehen hat („Et je comprends. (…) Et c’est ma mort qu’il m’envoie.“, S. 275) und läuft ihm so geradewegs in die Falle. Sein Fehler ist, dass er nicht - wie Rouletabille - auf der „dritten Stufe“ denkt, um die wirklichen Ziele des Täters zu verstehen (vgl. Roudaut 1971, S. 100). Er bleibt auf der ersten Stufe und lässt sich von der Oberfläche der Geschehnisse täuschen. So interpretiert er die Selbstmorde als Morde, deren Opfer eigentlich er sein sollte („C’est à moi qu’il en a, et à moi seul.“, S. 181) und liegt damit völlig neben der Realität.
Pennacs Techniken des Spiels mit Realität und Fiktion, die durch Intertextualität als Einbettung der romanexternen Realität erweitert werden, wurden bereits weiter oben beschrieben. Gaston Leroux wendet zwar teilweise andere Methoden an, z.B. den Einsatz eines Erzählers mit seinem Namen[40] mit vorgespiegelter „fonction testimoniale“ (vgl. Roudaut 1971, S. 110), doch die Effekte sind ähnlich: Auflösung der Trias Autor-Erzähler-Leser, deren Elemente voneinander isoliert sind, und Anstoßen des Lesers zur Reflexion (vgl. ebd.). Intertextualität ist in ihrer kommunikativen Funktion sowohl für Pennac als auch für Leroux ein wichtiges Mittel weniger zur Erzeugung von Spannung, als vielmehr zur Einreihung des Werkes in einen literarischen Gesamtkontext (vgl. Siepe 1988, S. 95). „Au bonheur des ogres“ versucht dabei keineswegs an den Kanon „hoher Literatur“ anzuschließen, ebenso wenig wie sich Daniel Pennac selbst als Intellektueller versteht (vgl. WWW-Seite). Wie die Texte Leroux’ speist sich auch Pennacs Roman aus anderen Texten (vgl. Siepe 1988, S. 98) und bietet dem gewillten Leser geistige Exkurse in die literarische Landschaft. Dabei setzt Pennac die Ideen aus seinem Manifest „Comme un roman“ konsequent um und belohnt seine Leser ganz einfach mit Komik und der Freude am Erkennen von inhaltlichen und formalen Zusammenhängen.
Keinem anderen Autor räumt Pennac in seinem Roman so viel Raum ein wie Carlo Emilio Gadda. Beim Buchhändler des Kaufhauses vertieft sich Malaussène in Gaddas „Die gräßliche Bescherung in der Via Merulana“, offensichtlich einer seiner bevorzugten Texte („N’ayant rien de plus beau à espérer, je me plonge dans les délices de la première page“, S. 137). Es folgt das Zitat der ersten Sätze, deutlich hervorgehoben durch Anführungszeichen und Kursivschrift. Wenige Seiten später fällt er bei einer Schlägerei in Ohnmacht. Im Delirium vermischen sich für Benjamin kurzzeitig Romanrealität - das Dienstzimmer von Coudrier, wo er aufwacht - und der Inhalt der „Via Merulana“: Coudriers Bitte an seine Sekretärin evoziert bei Malaussène den Inspektor Ingravallo, der im Rom der späten 20er Jahre einen Mord zu klären und dabei erhebliche Schwierigkeiten hat, Ordnung in den verworrenen Fall zu bringen. Darin ist er Malaussène recht ähnlich: Auch mit ihm „geschieht“ die Handlung, er ist ihr ausgeliefert, anstatt sie nach seinem eigenen Willen zu lenken. Für Ingravallo ist sein Versagen freilich weitaus peinlicher, denn als Polizeibeamter ist Verbrechensaufklärung sein Beruf. Der Inspektor Coudrier kennt Gadda und auch seinen Roman, denn auch er zitiert den ersten Satz und bringt ihn, ganz vernetzt denkender Polizist, mit der Rolle Malaussènes bei dem Kaufhausmorden in Zusammenhang (S. 147). Sein Wissen über Literatur, das seinen eigenartigen Charakter noch unterstreicht, weicht der Arbeit und ihren realen Problemstellungen.
4.3.2 Verweise außerhalb der Kriminalliteratur
Als wohl bekanntester Text der Welt erfüllt die Bibel die wichtigste Voraussetzung eines idealen Prätextes (vgl. Pfister 1985a, S. 27). Und bedenkt man, dass das von Pennac gebrauchte Konzept des Sündenbocks in der christlichen Mythologie stark verwurzelt ist[41], so ist es nicht verwunderlich, dass er mehrere Zitate und Anspielungen auf die Heilige Schrift einbettet. Oben bereits erwähnt wurde der Verweis von S. 70 auf den Heiligen Petrus (vgl. Fußnote 17), auch auf die unzähligen Allusionen von geringer intertextueller Kommunikativität[42] kann in diesem Rahmen nicht eingegangen werden. Erwähnenswert ist hier jedoch Malaussènes durchaus belustigender „Durchzieher“ durch die allseits bekannten Bibel-Gemeinplätze, die der Professor Fraenkhel[43] für seine Propaganda funktionalisiert:
Tout y passe : « Laissez venir à moi les petits enfants, le chameau, le riche et le trou de l’aiguille, heureux les simples, la première pierre à qui n’a pas péché », pour finir par cette phrase, tirée de Saint Thomas ou d’un autre : « Mieux vaut naître malsain et contrefait que de ne naître point. » (S. 125)
Pennac übt indirekte Kritik an der hypokritischen Verwendung von Bibelzitaten durch jeden, der für seine Sache Anhänger gewinnen will.
Eine Erwähnung wert sind zwei unauffälligere Anspielungen, die Malaussène im Rahmen seiner Reflexionen über den Abtreibungsgegner Léonard wählt. Den Titel von Diderots „Jacques le Fataliste“ stellt er um in „Léo le Nataliste“ (S. 155). Später im Roman wird Léonard in die lange Tradition von Quacksalbern des Typs Monsieur Diafoirus in „Le malade imaginaire“ von Molière eingereiht. Beide Stellen haben wohl keine direkte Funktion für den Text, jedoch weisen sie den Leser auf eine weitere Facette der Person Malaussène hin, nämlich seine klassische Bildung und Kenntnisse in der Literatur[44].
An Selektivität kaum zu überbieten ist das fast vollständig abgedruckte Gedicht von Jules Laforgue. Obwohl es vom „Kleinen“ mündlich vorgetragen wird, verzichtet Pennac völlig auf Markierung der Oralität und übernimmt die formale Einteilung in Verse und Strophen. Selbst den Namen des Autors setzt er darunter, der bei der Rezitation des Kleinen gewiss nicht an dieser Stelle genannt wird. Pennac legt mehr Wert auf das Wissen um den Autor als um den Titel, den er gar nicht erst erwähnt. Zieht man zum Vergleich das Original heran, fällt auf, dass die zitierten Strophen selbst nur ein Teil des Gedichtes „Ile“ ist und dort im Verfahren der ‚mise en abyme’ ein Gedicht im Gedicht darstellen (vgl. Anhang). Pennac schickt den Leser bewusst auf die Suche nach Unterschieden, die im Gesamtkontext von „Au bonheur des ogres“ ihre Bedeutung erhalten. So findet sich im vierten Vers der ersten Strophe von „Ile“ die Passage „Des veuves de Titans“, die sich erstens mit dem Girard-Motto überschneidet und zweitens auf den selben Mythos verweist wie Goyas „Saturn frisst seine Kinder“. Gemeinsam haben der Ausschnitt[45] aus „Ile“ und das genannte Gemälde die morbide Thematik, die den Kleinen zu faszinieren scheint. Einen besonderen Reiz üben die drastischen Interpretationen des Stoffs durch Laforgue und auch durch Goya aus, die beide mit den spezifischen Mitteln ihrer jeweiligen Kunst erzielen: In „Ile“ mit sarkastischen Formulierungen, bei „Saturn frisst seine Kinder“ mit dramatischen farblichen Kontrasten[46].
Der letzte intertextuelle Verweis, der in diesem Kapitel analysiert werden soll, bezieht sich auf das extravagante Theaterstück „Ubu Roi“ von Alfred Jarry durch Zitierung des Titels: „(…) mais moi, moi, Ubu Roi, « citadelle vivante », je biche tellement que je ne vois pas passer les stations qui me séparent d’ Actuel (…)“ (S. 116). Eine inhaltliche Verbindung besteht zwischen der Figur des König Ubu und Malaussènes momentaner Verfassung: Er ist völlig von seiner Idee eingenommen (S. 115: „je jubile“; „je biche“), läuft durch die Stadt, ohne links und rechts zu schauen („comme une tornade lessivante“, S. 115). In seinem egozentrischen Strudel, der sich in sprachlich in einem wahren Assoziationswahn ausdrückt, ähnelt er König Ubu. Dieser missbraucht, als er an die Macht kommt, den Staat zur hemmungslosen Befriedigung all seiner Bedürfnisse.
Parallelen finden sich auch im poetischen Konzept von Pennac und Jarry. Ihre beiden Werke sind Gattungsparodien. „Ubu Roi“ enthält ebenfalls zahlreiche Einzeltextreferenzen (vgl. Grimm 1982, S. 49 f.). Alfred Jarry geht bei seiner Parodie freilich schonungsloser vor: Er stellt „Ubu Roi“ explizit in die ehrwürdige Tradition des klassischen Dramas in fünf Akten, um dann dessen strenge Regeln auszuhöhlen (vgl. ebd., S. 45 f.). Wie bereits gezeigt wurde, geht Pennac nach einem ähnlichen Verfahren vor, doch sprengen seine Abweichungen nicht den Rahmen der Vorlage. Seine parodistischen Methoden sind weniger auffällig, aber konstitutiv für Tiefe und Wirkung des Textes.
5. Schluss
Im Laufe der Untersuchung wurde deutlich, dass Daniel Pennac in „Au bonheur des ogres“ eine Fülle von diversen Zitaten und Anspielungen eingebettet hat und dass es ihm gelungen ist, zwischen der formalen und der inhaltlichen Ebene, zwischen Text und Prätexten ein feinverzweigtes Netz zu spinnen. Ziel ist es nun, in diesem Netz eine Struktur zu erkennen, die es erlaubt, Pennacs Text in einen größeren Zusammenhang einzuordnen und auch Rückschlüsse auf sein literarisches Projekt zu ziehen.
Insgesamt lässt sich in seinem Schreiben ein gleichzeitig spielerischer und pragmatischer Umgang mit Sprache und Literatur erkennen. Zu den spielerischen Elementen gehört u.a. eine hohe Autoreflexivität, die sich in häufigen Kommentaren des Erzählers zum Geschehen und zum Verhalten des Helden ausdrückt. Zahlreiche Wortspiele und die Orientierung an Alltagssprache und Argot - nicht nur in Dialogen - weisen darauf hin, dass für Pennac Sprache zuallererst ein zwischenmenschliches Ereignis ist, und dass aus seiner Sicht die Literatur ihre Legitimation aus der mündlichen Kommunikation, d.h. aus Erzählung und Vortrag, erhält. In „Comme un roman“ weist Pennac darauf hin, dass der erste, unmittelbare Zugang des Kindes zur Literatur über die Stimme der Eltern stattfindet: „En somme, nous lui avons tout appris du livre en ces temps où il ne savait pas lire.“ (S. 19).
Als pragmatisch ist sein Schreiben insofern zu sehen, als er Techniken wie Einzeltextreferenz und Parodie nicht dazu einsetzt, ein komplexes Kunstwerk von rein ästhetischem Wert zu schaffen, sondern auf Zusammenhänge hinzudeuten, die hinter den Dingen stehen (ganz im Sinne von Leroux’ Rouletabille). Dabei scheint er nicht einmal allzu großen Wert auf den konkreten Einzelfall zu legen, wie in „Au bonheur des ogres“ die Verknüpfung von kriminalliterarischen Traditionen, sondern es geht ihm ganz allgemein um den Blick für Systeme, und noch allgemeiner um das Lernen[47] (es ist evident, dass der Begriff des „Lernens“ hier nicht das Aufnehmen von Fakten meint, sondern in einem universaleren Sinn geistiges Heranreifen). Auf der Suche nach geeigneten literarischen Mitteln muss Pennac die Erkenntnis gekommen sein, dass er bei seinen Lesern den größten Effekt erzielen würde, wenn er sie zur Reflexion über das Verhältnis von Fiktion und Realität anregen könnte. Das Ergebnis steht in einer Linie mit Strömungen im Frankreich der achtziger Jahre, in denen „nicht wenige Romanciers (…) einen die Literatur überschreitenden Sinn [entdeckten], ohne deshalb auf die fiktionalen Möglichkeitswelten zu verzichten.“ (Asholt 1994, S. 12). Das Interesse der Leser gewinnt Pennac durch ein mehrstufiges Modell, das unterschiedlichen Ansprüchen gerecht wird: Er adaptiert traditionelle Methoden des Detektivromans zur Verrätselung der Handlung und zur Erzeugung von Spannung, kombiniert sie mit der handfesten Sprache des Thrillers und versetzt das Produkt mit Querverweisen. Im gleichen Zug wendet er das für den Detektivroman konstitutive Konzept des „Scheinens[48] “ auf seinen eigenen Text an und bringt so den Leser dazu, Fragen zu stellen: Ist der Text ein Detektivroman? Gibt es einen Detektiv? Wer hat die Kontrolle? Die Kreuzworträtsel-Metapher, die sich eigentlich auf den isolierten Roman beschränkt, hebt Pennac auf die Meta-Ebene. Wer sich dorthin begibt, findet einen Kreuzworträtsel-Intertext vor, bei dem sich neue Bedeutungen erschließen, und vielleicht auch ein Sinn finden lässt.
So kommt der Leser möglicherweise letzten Endes dorthin, wo Pennac ihn hinführen will: „Ainsi découvrit-il la vertu paradoxale de la lecture qui est de nous abstraire du monde pour lui trouver un sens.“ (Comme un roman, S. 19).
Anhang
L'île
C'est l’Ile; Eden entouré d'eau de tous côtés!
Je viens de galoper avec mon Astarté
A l'aube des mers; on fait sécher nos cavales,
Des veuves de Titans délacent nos sandales,
Eventent nos tresses rousses, et je reprends
Mon Sceptre tout écaillé d'émaux effarants !
On est gai, ce matin. Depuis une semaine
Ces lents brouillards plongeaient mes sujets dans la peine,
Tout soupirants après un beau jour de soleil
Pour qu'on prît la photographie de Mon Orteil.
Ah! non, c'est pas cela, mon Ile, ma douce île
Je ne suis pas encore un Néron si sénile
Mon île pâle est au Pôle, mais au dernier
Des Pôles, inconnu des plus fols baleiniers!
Les Icebergs entrechoqués s'avançant pâles
Dans les brumes ainsi que d'albes cathédrales
M'ont cerné sur un bloc; et c'est là que, très-seul,
Je fleuris, doux lys de la zone des linceuls,
Avec ma mie !
Ma mie a deux yeux diaphanes
Et viveurs! et, avec cela, l'arc de Diane
N'est pas plus fier et plus hautement en arrêt
Que sa bouche! (arrangez cela comme pourrez)
Oh! ma mie… - Et sa chair affecte un caractère
Qui n'est assurément pas fait pour me déplaire :
Sa chair est lumineuse et sent la neige, exprès
Pour que mon front pesant y soit toujours au frais,
Mon Front Equatorial, Serre !’Anomalies!.
Bref, c'est, au bas mot, une femme accomplie.
Et puis, elle a les perles tristes dans la voix.
Et ses épaules sont aussi le premier choix.
Et nous vivons ainsi, subtils et transis, presque
Dans la simplicité les gens peints sur les fresques.
Et c'est l’Ile. Et voilà vers quel Eldorado
L’Exode nihiliste a poussé mon radeau.
O lendemains de noce où nos voix mai éteintes
Chantent aux échos blancs la si grêle complainte :
LE VAISSEAU FANTOME
Il était un petit navire
Où Ugolin mena ses fils,
Sous prétexte, le vieux vampire!
De les fair' voyager gratis.
Au bout de cinq à six semaines,
Les vivres vinrent à manquer,
Il dit : « Vous mettez pas en peine;
es fils n' m'ont jamais dégoûté! »
On tira z'à la courte paille,
Formalité! Raffinement!
Car cet homme, il n'avait d’entrailles
Qu' pour en calmer les tiraillements.
Et donc, stoïque et légendaire,
Ugolin mangea ses enfants,
Afin d' leur conserver un père…
Oh! quand j'y song', mon cœur se fend!
Si cette histoire vous embête,
C'est que vous êtes un sans-cœur!
Ah! j'ai du cœur par d’ssus la tête,
Oh! rien partout que rir's moqueurs!...
Jules Laforgue
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Francisco Goya, „Saturn frisst
seine Kinder“ (Madrid, Museo Nacional
del Prado)
Literatur
Primärliteratur
Die Bibel, Einheitsübersetzung. Freiburg; Basel; Wien, Herder.
Gadda, Carlo Emilio (1998): Die gräßliche Bescherung in der Via Merulana. Berlin, Wagenbach.
Jarry, Alfred (1981): König Ubu. Zürich, Die Arche.
Pennac, Daniel (2002) : Au bonheur des ogres. Paris, Gallimard.
Pennac, Daniel (1992): Comme un roman. Paris, Gallimard.
Zola, Emile (1927): Au bonheur des dames. Paris.
Sekundärliteratur
Alewyn, Richard (1971): „Anatomie des Detektivromans“. In: Vogt, Jochen (1971): Der Kriminalroman II. München, Wilhelm Fink. S. 372.
Asholt, Wolfgang (1994): Der französische Roman der achtziger Jahre. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Brecht, Bertolt (1971): „Über die Popularität des Kriminalromans“. In: Vogt, Jochen (1971): Der Kriminalroman II. München, Wilhelm Fink. S. 315.
Broich, Ulrich (1985a): „Formen der Markierung von Intertextualität“. In: Broich, Ulrich/Pfister, Manfred (Hgg.)(1985): Intertextualität. Tübingen, Niemeyer. S. 31.
Broich, Ulrich (1985b): „Bezugsfelder der Intertextualität: Zur Einzeltextreferenz“. In: Broich, Ulrich/Pfister, Manfred (Hgg.)(1985): Intertextualität. Tübingen, Niemeyer. S. 48.
Broich, Ulrich (1985c): „Intertextualität in Fieldings ‚Joseph Andrews’“. In: Broich, Ulrich/Pfister, Manfred (Hgg.)(1985): Intertextualität. Tübingen, Niemeyer. S. 262
Colin, Jean-Paul (1990): Dictionnaire de l’argot. Paris, Larousse.
Dine, S. S. van (1971): „Zwanzig Regeln für das Schreiben von Detektivgeschichten“. In: Vogt, Jochen (1971): Der Kriminalroman I. München, Wilhelm Fink. S. 143.
Eckert, Otto (1971): „Der Kriminalroman als Gattung“. In: Vogt, Jochen (1971): Der Kriminalroman II. München, Wilhelm Fink. S. 528.
Flügge, Manfred (1993): Die Wiederkehr der Spieler: Tendenzen des frnazösischen Romans nach Sartre. Marburg, Hitzeroth.
Freund, Winfried (1981): Die literarische Parodie. Stuttgart, Metzler.
Genette, Gérard (1972): Figures III. Paris, Seuil.
Grimm, Jürgen (1982): Das avantgardistische Theater Frankreichs 1895-1930. München, C.H. Beck
Haas, Willy (1971): „Die Theologie Im Kriminalroman“. In: Vogt, Jochen (1971): Der Kriminalroman I. München, Wilhelm Fink. S. 116.
Heißenbüttel, Helmut (1971): „Spielregeln des Kriminalromans“. In: Vogt, Jochen (1971): Der Kriminalroman II. München, Wilhelm Fink. S. 356.
Müller, Beate (1994): Komische Intertextualität: Die literarische Parodie. Trier, WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier.
Nusser, Peter (1980): Der Kriminalroman. Stuttgart, Metzler.
Pfister, Manfred (1985a): „Konzepte der Intertextualität“. In: Broich, Ulrich/Pfister, Manfred (Hgg.)(1985): Intertextualität. Tübingen, Niemeyer. S.1.
Pfister, Manfred (1985b): „Bezugsfelder der Intertextualität: Zur Systemreferenz“. In: Broich, Ulrich/Pfister, Manfred (Hgg.)(1985): Intertextualität. Tübingen, Niemeyer. S. 52.
Revzin, I. I. (1971): „Zur semiotischen Analyse des Detektivromans am Beispiel der Romane Agatha Christies“. In: Vogt, Jochen (1971): Der Kriminalroman I. München, Wilhelm Fink. S. 139.
Roudaut, Jean (1971): „Gaston Leroux im Umriss“. In: Vogt, Jochen (1971): Der Kriminalroman I. München, Wilhelm Fink. S. 98.
Schmidt, Jochen (1989): Gangster, Opfer, Detektive: Eine Typengeschichte des Kriminalromans. Frankfurt am Main; Berlin, Ullstein.
Schwendemann, Irene (Hg.) (1976): Hauptwerke der französischen Literatur: Einzeldarstellungen und Interpretationen. München, Kindler.
Siepe, Hans T. (1988): Abenteuer und Geheimnis: Untersuchung zu Strukturen und Mythen des Populärromans bei Gaston Leroux. Frankfurt am Main; Bern; New York; Paris, Peter Lang.
Suerbaum, Ulrich (1971): „Der gefesselte Detektivroman“. In: Vogt, Jochen (1971): Der Kriminalroman II. München, Wilhelm Fink. S. 437.
Weber, Johannes (1998): „Terrorismus im Kriminalroman? ‚Gálvez en Euskadi’ (Jorge Martínez Reverte) und ‚Au bonheur des ogres’ (Daniel Pennac)“. In: Pöppel, Hubert (Hg.) (1998): Kriminalromania. Tübingen, Stauffenburg. S. 199.
WWW-Seiten
Zu Chester Himes: http://www.kirjasto.sci.fi/chimes.htm
Zu Joseph Wambaugh: http://www.mauvaisgenres.com/hbd16_jw_oeuvre.htm
Interview mit Daniel Pennac: http://www.france.diplomatie.fr/label_france/france/dossier/2000bis/11pouvoir.html
[...]
[1] Vgl. dazu Kristeva, Julia (1969) : Sémeiotiké: Recherches pour une sémanalyse. Paris.
[2] Der Alewynsche Begriff des Kriminalromans ist an dieser Stelle gleichwertig mit dem des Nusserschen Thrillers (vgl. Nusser 1980, S. 4). Hier werden die erwähnten terminologischen Differenzen deutlich.
[3] Van Dine liefert hierfür auch seine persönliche Begründung: „Schließlich müssen des Lesers Mühe und Energieaufwand belohnt werden“, wenn er sich schon entschlossen hat, mehrere hundert Seiten Text durchzuarbeiten (Dine 1971, S. 144). Dass der Leser mit einem Mord „geködert“ werden muss, um auch über die ganze Länge des Romans durchzuhalten, sagt viel über die Meinung van Dines zur literarischen Qualität des Genres.
[4] Zum Auftritt des Detektivs präzisiert van Dine: „Es darf nur einen Detektiv geben – d.h. nur einen Helden der Schlußfolgerung, nur einen deus ex machina “ (Dine 1971, S. 144). Die Verwendung des Ausdrucks „Deus ex Machina“ macht außerdem deutlich, dass der Auftritt des Detektivs nicht besonders gerechtfertigt werden muss, beispielsweise durch Verwandtschaft mit dem Opfer (vgl. dazu Alewyn 1971, S. 385).
[5] Z.B. Bertolt Brecht: „Der Kriminalroman handelt vom logischen Denken und verlangt vom Leser logisches Denken. Er steht dem Kreuzworträtsel nahe, was das betrifft.“ (Brecht 1971, S. 315).
[6] Das englische Wort „clue“ bezeichnet in etwa ein Indiz, eine Spur (vgl. Alewyn 1971, S. 387 ff.).
[7] Die Auswahl des Autors von Personen aus höheren sozialen Positionen gründet im intendierten Verfremdungseffekt: Morde in niederen Milieus werden vom Leser eher erwartet als in höheren Schichten. Gerade der Umstand, dass die Motive hier wie dort die selben sind, macht die Verfremdung aus – denn die Angehörigen gehobener Schichten distanzieren sich im Allgemeinen von den niederen Antrieben der Liebe und der Geldgier.
[8] Ausgenommen ist natürlich der Held: „Niemals sollten der Detektiv selbst oder einer der Ermittlungsbeamten sich als Missetäter herausstellen“ (Dine 1971, S. 143).
[9] Den Detektiv auf die extra-literarische Ebene des Lesers zu heben, ist m.E. weder zweckmäßig noch korrekt. Das Zitat soll hier nur auf die herausgestellte Stellung des Detektivs unter den Romanfiguren hinweisen.
[10] Eine besondere Herausforderung für den Autor (und auch für den Leser) stellt die Variante des völlig geschlossenen Raums dar, in dem ein augenscheinlich unmöglicher Mord geschieht (vgl. Nusser 1980, S. 51).
[11] Gemeint ist hier nicht etwa die Außerkraftsetzung physikalischer Gesetze oder die Einführung metaphysischer Phänomene. Ganz im Gegenteil ist Plausibilität ein wesentliches Merkmal des Detektivromans; Er soll lediglich abgegrenzt werden gegenüber Gattungen, die die Darstellung der z.B. gesellschaftlichen Realität zum Ziel haben.
[12] Ein denkbarer Grund ist das Tabu der Kopplung der Themen „Kinder“ und „gewaltsamer Tod“, das seinerseits im Detektivroman schlechterdings unvermeidlich ist.
[13] Der Verbleib der leiblichen Väter der Malaussène-Geschwister wird mit keinem Wort erklärt.
[14] „Rational“ meinte in diesem Sinne „nicht empirisch“.
[15] Erst mit der zunehmenden körperlichen Beteiligung des Helden im Thriller setzte sich allmählich die erste Person durch (vgl. Schmidt 1989, S. 51 ff.).
[16] Alewyn geht so weit, den Detektiv nicht als Romanhelden zu bezeichnen, da er keinen greifbaren Charakter darstellt sondern lediglich eine Funktion erfüllt und zwar die der Repräsentation des Lesers im Roman (vgl. Alewyn 1971, S. 385).
[17] Im dritten Kapitel beispielsweise wird der Leser in medias res bis in den Schoß der Familie hinein getragen und schlagartig mit den teilweise sehr intimen Nöten der Akteure konfrontiert ohne Hintergrundwissen zu erhalten. Man hat den Eindruck, dort Gast zu sein und unfreiwillig eingeweiht zu werden.
[18] Eine weitere Verquickung Pennacs: Der „hard-boiled“-Charakter Philip Marlowe, Seite an Seite mit dem berühmtesten Vertreter des Detektivgenre Sherlock Holmes. Das Namenspiel wird vervollständigt durch die Kombination mit dem Namen Malaussènes, dessen Charakter weder zum einen noch zum anderen Bereich passt.
[19] Zu diesem Zweck wird u.a. die finale Gerechtigkeit als weltordnendes Prinzip eingeführt, die den Mörder bestraft und das Verbrechen sühnt. Der Leser kann sich so auf seinen Gerechtigkeitssinn verlassen.
[20] Schon zuvor tauchen vereinzelt Anspielungen auf die christliche Theologie und ihre Heiligen auf: „Salaud de Julius, je ne te connais plus. Par trois fois. Le reniement de saint Pierre.“ (S. 70). Hier stilisiert sich Benjamin als Petrus, der dreimal Christus verleugnet.
[21] Selbst Malaussènes provokative Offenheit bewegt Coudrier zu keinerlei Reaktion:
– En quoi consiste exactement votre fonction au Magasin? (…)
– Je suis Bouc Emissaire, monsieur le commissaire.
Le commissaire divisionnaire Coudrier me renvoie un regard absolument vide. (S. 79 f.)
[22] „Assis devant moi, le commissaire divisionnaire Coudrier semble le seul homme éclairé dans la nuit parisienne.“ (S. 237). „Eclairé“ ist hier durchaus zweideutig zu verstehen.
[23] Vgl. dazu Alewyn 1971: „Der Täter muß eine Person sein, die in der Geschichte eine mehr oder weniger tragende Rolle gespielt hat – eine Person also, die dem Leser vertraut ist und für die er sich interessiert.“ (S. 144)
[24] Es wäre jedoch falsch, hier von einem Eingeständnis von Fehlern oder gar Reue zu sprechen. Die Satanisten waren von der Zeit überholt worden, sie konnten die Veränderungen und das Versagen ihrer Antimoral nicht verarbeiten und beschlossen daher, ihr Leben zu beenden. Eine Selbstbestrafung fand soweit statt, als sie ihr Versagen nicht akzeptieren konnten.
[25] Die Verunsicherung der Kaufhausangestellten kommt in einer Versammlung zum Ausdruck: „La panique est la plus forte. Chacun hurle sa trouille, sa rage, ou tout simplement son opinion.“ (S. 82).
[26] Als Thérèse mit Hilfe astrologischer Berechnungen Geburts- und Todesdatum des vorletzten Toten (S. 235) prognostiziert, hat es sogar den Anschein, als setze sich Pennac über die Regel hinweg, die die Metaphysik aus dem Kriminalroman verbannt (vgl. Dine 1971, S. 144).
[27] [27] Die Methode verwendet Pennac u.a. auch bei den Übergängen von Kapitel 34 auf 35 (S. 254 f.) und von Kapitel 35 auf 36 (S. 262 f.).
[28] [28] Haupthandlung meint hier alle Szenen des Romans, in denen das Thema der Mordserie behandelt wird und die mittelbar oder unmittelbar zu ihrer Aufklärung beitragen.
[29] [29]Manfred Pfister (1985b, S. 53) weist darauf hin, dass Intertextualität nur beim Verweis eines Textes auf versprachlichte Systeme vorliegt; Demnach wäre beispielsweise die Erwähnung eines geographischen Ortes nicht als intertextuell zu betrachten. Die vorliegende Analyse orientiert sich an dieser Kategorisierung, wird jedoch in (begründeten und gekennzeichneten) Ausnahmefällen den Intertextualitätsbegriff etwas dehnen.
[30] [30]M.E. bleibt die Referenz aber relativ allgemein, sodass genauere Textkenntnisse nicht unbedingt nötig sind.
[31] [31]Die Liebe des Inspektor Coudrier zu Empire-Möbeln (S. 79) ist als belustigender Anachronismus mit Anspielung auf „Au bonheur des dames“ zu verstehen.
[32] [32] Wenige Seiten später weitet Malaussène seine Aussage aus: „Les enfants sont des cons. Comme les anges.“ (S. 169).
[33] [33] Das „Dictionnaire de l’argot“ gibt zu dem Ausdruck folgende Erläuterung: „Indique qu’on recommence une même action ou qu’un fait identique se reproduit“ (S. 538)
[34] [34]Explizit wird der Verweis zwar nicht angesprochen, doch sorgen die kongruente Form sowie die Thematisierung der Schachpartie dafür, dass er für den Leser praktisch unübersehbar ist.
[35] [35]Vgl. auch „Comme un roman“: „Dès que l’occasion s’en présentait, nous déléguions une autre voix auprès de lui, (…) qui déchantait souvent devant ses exigences de public tatillon“. (S. 38)
[36] [36] Schon davor war das Werk von einem anderen Verlag wegen der „structure quelque peu brouillonne“ (S. 241) abgelehnt worden, und unter Verweis auf die „affaire similaire“, die zu dem Zeitpunkt die Stadt bewegt. Diese Ablehnung macht auf Benjamin aber weniger Eindruck, da er selbst der Idee seiner Schwester argwöhnisch gegenüber steht.
[37] Der erste Band, „Tintin au Congo“, erschien 1931, der letzte 1974.
[38] Später macht Malaussène noch eine Anspielung auf eine Figur aus Tintin, für deren Verständnis eine gute Kenntnis des Prätextes erforderlich ist: „(…) une grande bonne femme, style Castafiore“ (S. 216). Damit bezieht er sich auf die korpulente italienische Diva, die mit ihrem Gesang Gläser splittern lässt und in ihrer aufdringlichen Art für Aufsehen sorgt.
[39] Der „Tchèque en Bois“ ist eine Figur von Joseph Wambaugh, einem ehemaligen Polizeibeamten. Seine Romane waren zunächst sehr realistisch, später mit immer mehr fiktionalen Elementen durchsetzt (vgl. WWW-Seite). Pennac wählt beim Vergleich der Kinder wohlbedacht auf der einen Seite den Helden eines Schriftstellers mit verbrecherischer Vergangenheit, auf der anderen Seite denjenigen eines früheren Polizeibeamten. Böse und gut vermischen sich, sind nicht mehr trennscharf, das gerechte Urteil über den Täter wird unmöglich – denn sein Richter war womöglich selbst einmal Täter.
[40] Pennac dagegen redupliziert nicht sich selbst, sondern seinen Erzähler Malaussène in dessen Roman.
[41] In der Bibel ist vom „Sündopferbock“ die Rede (vgl. 3. Buch Mose, 16).
[42] Diese sind durch den jahrtausendelangen intensiven Einfluss der Bibel auf den europäischen Kulturkreis allgegenwärtig und stehen durch ihre größtenteils unreflektierte Verwendung am Randbereich der Intertextualität (ein Beispiel hierfür ist die Zahl 666 (S. 248), in der Bibel Symbol für Satan).
[43] Zusätzliche Komik entsteht durch die Spannung zwischen dem abstoßenden Bild Fraenkhels als „créature (…) sortie de la cervelle d’un Frankenstein sous acide“ (S. 215) und seinen Äußerungen. Aus der Perspektive der christlichen Moral ist der Versuch des Doktor Frankenstein, Leben zu erschaffen, ein Verstoß gegen das Schöpfungsmonopol Gottes (in diesem Zusammenhang muss auch Fraenkhels Beruf, Geburtshelfer, gesehen werden).
[44] Dass Benjamin Zitate nicht nur dazu verwendet, sein Wissen zur Schau zu stellen und sich dadurch selbst zu überhöhen, zeigt folgende Textstelle: « Vézarde », dirait Rabelais. (Chiasse, quoi.)“ (S. 271). Die derbe Sprache Rabelais’ stößt ihn nicht ab, im Gegenteil: Er kann sie mühelos in moderne Umgangssprache übersetzen und holt sie gleichzeitig vom hohen Sockel der Literatur zurück auf den Boden des Alltags.
[45] Beim Vergleich mit dem Original fällt auch auf, dass Pennac die letzte Strophe des Gedichts nicht in seinen Text übernommen hat. Da diese fünfte Strophe stark appellativ die Herzlosigkeit der Gesellschaft anklagt, hielt sie Pennac möglicherweise aus dem Mund eines Kindes für unpassend oder unglaubwürdig.
[46] Vgl. Abbildung im Anhang.
[47] M.E. ist hier der Rückgriff auf Pennacs Biographie, die ihn als leidenschaftlichen Pädagogen ausweist, durchaus legitim, auch wenn der pädagogische Aspekt seines Textes nicht überbewertet werden sollte.
Häufig gestellte Fragen zu "Au bonheur des ogres"
Was ist "Au bonheur des ogres" und worum geht es?
"Au bonheur des ogres" ist ein Roman von Daniel Pennac. Er erzählt die Geschichte von Benjamin Malaussène, einem Sündenbock in einem Pariser Kaufhaus, der in eine Reihe von Bombenanschlägen verwickelt wird. Er muss seine Unschuld beweisen und gleichzeitig seine fünf Halbgeschwister versorgen.
Welche Themen werden in "Au bonheur des ogres" behandelt?
Der Roman behandelt Themen wie Familie, Verantwortung, Sündenbockmechanismen, Vorurteile, Gewalt, Liebe und die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Er spielt auch mit verschiedenen literarischen Genres, insbesondere dem Kriminalroman und dem Thriller.
Was ist das Konzept des Sündenbocks in Bezug auf Benjamin Malaussène?
Benjamin arbeitet als Sündenbock im Kaufhaus und nimmt die Wut der Kunden auf sich. Dies ist aber auch eine Metapher für seine Rolle im Leben, da er oft für Dinge verantwortlich gemacht wird, für die er nicht verantwortlich ist. Der Roman untersucht, wie die Gesellschaft Einzelpersonen zu Sündenböcken macht, um von ihren eigenen Problemen abzulenken.
Wer sind die Hauptfiguren im Roman?
Zu den Hauptfiguren gehören:
- Benjamin Malaussène: Der Protagonist und Sündenbock.
- Die Malaussène-Familie (seine Halbgeschwister): Eine große und ungewöhnliche Familie, für die Benjamin die Verantwortung trägt.
- Kommissar Coudrier: Der Ermittler, der Malaussène zunächst verdächtigt, aber schließlich von seiner Unschuld überzeugt ist.
- Tante Julia: Eine Ladendiebin und Journalistin, die eine Beziehung mit Benjamin beginnt.
Welche Rolle spielt Intertextualität in "Au bonheur des ogres"?
Intertextualität ist ein wichtiges Stilmittel im Roman. Pennac bezieht sich auf zahlreiche andere literarische Werke, darunter Kriminalromane, klassische Literatur und Comics. Diese Verweise dienen dazu, den Roman in einen breiteren literarischen Kontext zu stellen und seine Bedeutungsebenen zu erweitern.
Wie parodiert "Au bonheur des ogres" den Kriminalroman?
Der Roman parodiert Elemente des klassischen Detektivromans, indem er beispielsweise den typischen Helden-Detektiv durch eine eher passive und durchschnittliche Figur wie Malaussène ersetzt. Er bricht auch mit der traditionellen Einheit des Ortes und der klaren Trennung zwischen Täter und Opfer.
Welche Bedeutung haben die Geschichten, die Benjamin seinen Geschwistern erzählt?
Die Geschichten sind ein wichtiges Element des Romans. Sie dienen dazu, die Geschehnisse des Tages zu verarbeiten und den Kindern auf altersgerechte Weise zu erklären. Sie sind auch ein Beispiel für Pennacs Spiel mit Fiktion und Realität.
Welche Rolle spielt die Familie im Roman?
Die Familie spielt eine sehr wichtige Rolle. Im Gegensatz zu den isolierten Ermittlern in vielen Kriminalromanen, ist Malaussène eingebettet in eine große, bunte Familie, für die er verantwortlich ist. Die Geschwister tragen aktiv zur Aufklärung des Falles bei und bieten Benjamin emotionale Unterstützung.
Welche verschiedenen Erzählperspektiven werden im Roman verwendet?
Der Roman wird aus der Ich-Perspektive von Benjamin Malaussène erzählt. Dies ermöglicht dem Leser, die Geschichte aus seiner Sicht zu erleben und sich mit ihm zu identifizieren. Allerdings mischt Pennac diese Perspektive auch mit Elementen anderer Genres und Erzähltechniken.
Was ist das Besondere an dem Stil und der Sprache von Daniel Pennac?
Pennacs Stil ist humorvoll, spielerisch und oft ironisch. Er verwendet Alltagssprache und Argot und mischt verschiedene Stilebenen. Seine Sprache ist bildreich und voller Anspielungen.
Details
- Titel
- Gattungsparodie und Intertextualität im Roman: 'Au bonheur des ogres' von Daniel Pennac
- Hochschule
- Universität Bayreuth
- Note
- 1,0
- Autor
- Simon Martin (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 44
- Katalognummer
- V109978
- ISBN (eBook)
- 9783640081561
- Dateigröße
- 789 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Gattungsparodie Intertextualität Roman Daniel Pennac
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Arbeit zitieren
- Simon Martin (Autor:in), 2003, Gattungsparodie und Intertextualität im Roman: 'Au bonheur des ogres' von Daniel Pennac, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/109978
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









