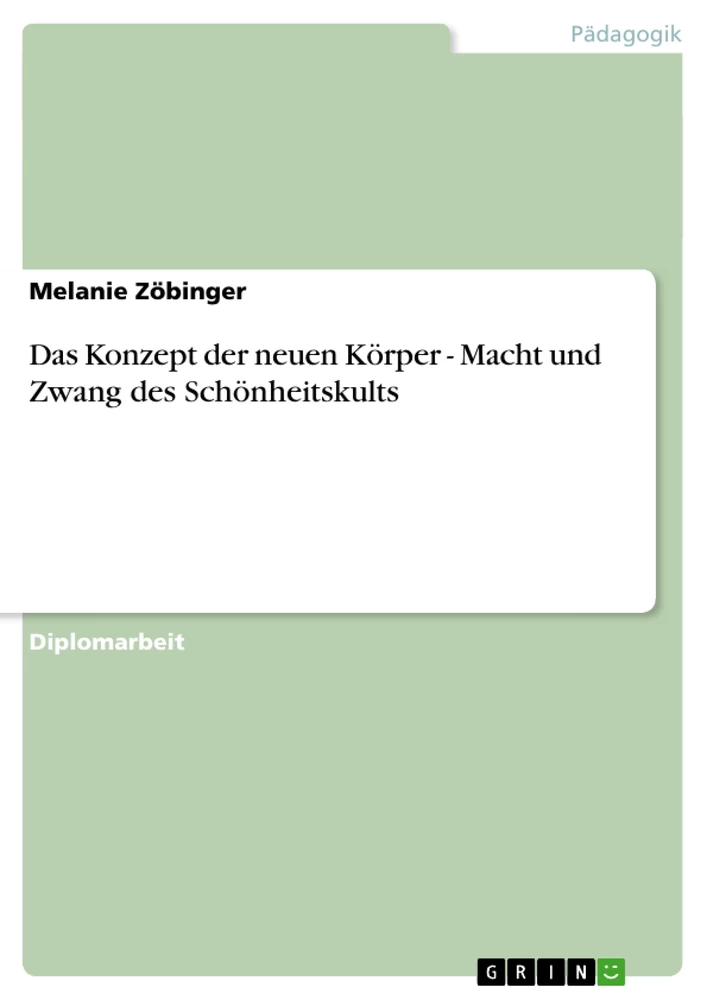
Das Konzept der neuen Körper - Macht und Zwang des Schönheitskults
Diplomarbeit, 2003
100 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Das Ideal des Schönen
2.1. Der Kanon der Schönheit
2.2. Die Formel der Schönheit
3. Exkurs zur Attraktivitätsforschung
3.1. Durchschnittlichkeit = Schönheit
3.2. Symmetrie = Schönheit
3.3. Das „Kindchenschema“
4. Schönheitsideale – ein kulturelles Gut oder biologische Determinante?
5. Wandel der Ideale – von gestern bis heute
5.1. Bis ins 20. Jahrhundert
5.2. Die Schönheitsideale im Zeitalter der Medien
6. Ursächliche Mechanismen für das „Konzept der neuen Körper“
6.1. Konsum – und Überflussgesellschaft
6.2. Die Technisierung des Körpers
6.3. Die Medien und das Verschwinden der Wirklichkeit
6.4. Verlust von Religion und Tradition
6.5. Schönheit und die feministische Sichtweise
6.6. Die Sozialisation des schönen Körpers
7. Schönheit als soziale Macht
7.1. Was schön ist, ist auch gut?
7.2. Charakterbeurteilung aufgrund äußerer Merkmale
7.3. Physische Attraktivität und das Verhalten anderer
7.4. Schönheit und soziale Realität
7.5. Zwischenmenschliche Beziehungen
7.6. Berufseignungskriterium Schönheit?
8. Schönheitskult – der machbare Körper
8.1. Schlankheitswahn und Muskelmasse
8.2. Jugendlichkeit
8.3. Natürlich künstlich
8.4. Schönheitschirurgie
9. Folgen und psychosoziale Probleme des Schönheitskults
9.1. Körperentwicklung, Schönheitsnorm und Selbstwert
9.2. Verzerrte Selbstwahrnehmung und negatives Körperbild
9.3. Rollenkonfusion
9.4. Narzisstische Störungen
9.5. Sexualitäts– und Partnerschaftsprobleme
9.6. Konkurrenzverhalten
9.7. Essstörungen
10. Konsequenz für die soziale Arbeit
10.1. Schönheitskult – ein Thema für die Gesundheitsförderung
10.2. Aufgaben der sozialen Arbeit
10.3. Präventionsmöglichkeiten
10.3.1 Medienpädagogische Methoden
10.3.2 Gesundheitsaufklärende Maßnahmen
10.3.3 Sexualpädagogische Mädchenarbeit
11. Resümee
12. Quellenverzeichnis
13. Abkürzungsverzeichnis
14. Eidesstattliche Erklärung
1. Einführung
Schönheit an sich ist etwas, dass seit jeher zum menschlichen Dasein gehört. Sich an ihr zu erfreuen und sie zu bewundern gehört zum Leben, weil sie das Leben erst lebenswert macht. Ein Dasein ohne Orientierung am Schönen ist undenkbar, sie macht uns glücklich und spendet Lebensfreude.
Auch der menschliche Körper gilt seit jeher als Plattform, um Schönheit auszudrücken. Die Verschönerung und Pflege des Körpers ist ein ursprüngliches Bedürfnis der Menschheit.
In allen Kulturen und zu allen Zeiten haben Menschen gesalbt und geölt, ihren Körper bemalt oder verziert. Natürliche Schönheitsmittelchen und Rezepturen für Kosmetika wurden häufig traditionell überliefert und in Arzneibüchern niedergeschrieben, mit dem Zweck, die natürliche Schönheit aufrecht zu erhalten oder zu verbessern und auch dem Schönheitsdeal der jeweiligen kulturellen Epoche zu entsprechen.
Selbst mit schmerzhaften Techniken wurde der menschliche Körper umgestaltet. In Japan wurden die Füße eingebunden, damit sie klein bleiben, burmesische Frauen legen sich auch heute noch Ringe um den Hals, um ihn zu verlängern und in afrikanischen und südamerikanischen Stämmen werden Ohrlöcher und Lippen überdimensional vergrößert. Diese schmerzhaften Veränderungen des menschlichen Körpers haben sich allerdings aufgrund langer Traditionen entwickelt. Sie sind kultische Handlungen, welche die Verehrung von Gottheiten oder den sozialen Status der Personen demonstrieren.
In der heutigen westlichen Industriegesellschaft hat der Körper jedoch eine andere Bedeutung.
Durch Einfluss und Veränderung vielfältiger Mechanismen hat der Körper als Ausdruck traditioneller und religiöser Hintergründe und als Vehikel des Geistes und der Seele seine Bedeutung verloren. Körperrituale und Opfergaben werden heute durch Styling ersetzt. Die Verehrung von Gottheiten weicht somit der Verehrung des menschlichen Körpers und ein grundlegendes Verschönerungsbedürfnis ist zum Zwang geworden. Zudem verliert auch die Gestaltung des menschlichen Körpers als Ausdruck bestimmter Werte, Überzeugungen und Lebensinhalte immer mehr an Bedeutung.
Im Gegensatz dazu wird ein schöner, schlanker Körper selbst zum Wert. Die Medien sind heute voll von Berichten über Schönheitsoperationen. Dies häufig schon bei ganz jungen Mädchen, die mit ihrer Nase oder ihrer Brust unzufrieden sind oder sich Fett absaugen lassen. Diät- und Bodystylingtipps flimmern ständig über den Fernsehapparat, gleichzeitig sind überall Berichte über magersüchtige oder bulimische Mädchen zu hören und zu lesen. Die Macht des Schönheitskults bewegt anscheinend Menschen dazu, sich ihm zwanghaft unter zu ordnen und der Körper wird zur beliebig gestaltbaren Masse.
Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich deshalb der Frage nachgehen, durch welche Prozesse der Schönheitskult der heutigen Zeit sich entwickelt hat, welche Macht die Schönheit eines Menschen ausübt, und mit welchen Verschönerungstechniken der menschliche Körper heute bearbeitet wird. Zentrale Bedeutung haben die daraus resultierenden Konsequenzen, welche durch ein neues gesellschaftliches „Körperverständnis“ beim Menschen zu zahlreichen psychosozialen Folgen und Problemen führen können und deshalb die Notwendigkeit eines Handlungsauftrag der sozialen Arbeit nach sich ziehen. Die Transformation dieses Themas auf beide Geschlechter hat sich allerdings als schwierig herausgestellt, da Frauen und Mädchen vom Schönheitskult und von Schönheitsidealen mehr beeinflusst werden als Männer und Jungen.
Zu Beginn möchte ich mich allerdings im philosophischen und künstlerischen Verständnis dem Thema Schönheit annähern. Jahrhunderte lang haben Wissenschaftler versucht, Schönheit zu definieren. Heute untersucht insbesondere die Attraktivitätsforschung, welche Merkmalsausprägungen des menschlichen Körpers objektiv als ansprechend gelten und sie belegt durch zahlreiche Forschungsergebnisse, dass evolutionspsychologische und biologische Aspekte dafür verantwortlich sind. Schönheitsideale sind aber einem permanenten Wandel unterlegen und verändern sich immer schneller. Deshalb möchte ich im nachfolgenden Kapitel aufdecken, ob nun gewisse Schönheitsideale kulturabhängig entstehen, oder ob auch hier evolutionspsychologische und biologische Aspekte eine Rolle spielen. Um aufzuzeigen, wie extrem sich ein Verständnis von Schönheit und die damit verbundenen Techniken hinsichtlich des menschlichen Körpers ändert und welche gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Faktoren hierbei eine Rolle spielten, ist eine historische Betrachtung der westlichen Welt notwendig.
Anschließend möchte ich zum Hauptteil meiner Arbeit übergehen. Hierbei wird dargestellt, welche Entwicklungen und Mechanismen der westlichen Gesellschaft als Ursache betrachtet werden können, um die Entstehung eines derartigen Schönheitskults und eines neuen „Körperkonzeptes“ zu erklären. Auch möchte ich mich mit dem Thema „Schönheit als soziale Macht“ beschäftigen, um aufzuzeigen, wie die Attribute „hübsch“ und „schlank“ gesellschaftlich, beruflich und privat honoriert werden und wie Schönheit das menschliches Verhalten und Handeln beeinflusst.
Die wichtigsten Techniken und Handlungen der Körperformung und Ästhetisierung, sowie deren gesellschaftliche Verbreitung werden im darauffolgenden Kapitel dargelegt. Anschließend möchte ich mögliche Konsequenzen des Schönheitskults aufzeigen. Hierbei soll betrachtet werden, welchen Einfluss der Schönheitskult auf den Menschen und dessen Selbstwert und Selbstbewusstsein haben kann und welche psychosozialen Probleme und Folgen daraus entstehen können. Schwerpunktmäßig möchte ich die Folgen bei jungen Mädchen darstellen. Das hat verschiedene Gründe, welche ebenfalls in diesem Kapitel und auch in 6.5 und 6.6 angesprochen werden. Der anschließende mögliche Handlungsauftrag der sozialen Arbeit ergibt sich weitgehend aus den vorherig genannten Konsequenzen des Schönheitskults und bezieht sich deshalb auf Aspekte im Rahmen der Gesundheitsförderung. Abschließend möchte ich noch Möglichkeiten aufzeigen, welche im Handlungsfeld der sozialen Arbeit präventiv gegen einen krankmachenden Kult wirken könnten.
2. Das Ideal des Schönen
2.1. Der Kanon der Schönheit
Von der Antike bis heute wird Schönheit als eine Form erklärt, welche sich durch Proportionen und Zahlen ausdrücken lässt. Faktoren wie die Elemente Klarheit, Symmetrie, Harmonie und intensive Farbgebung spielen hierbei eine bedeutende Rolle.
Nach Platon gehöre zur Schönheit das richtige Maß und die richtige Größe von Teilen, welche sich harmonisch zu einem nahtlosen Ganzen zusammenfügen lassen. Diesen Gedanke der Proportionen des Schönen bezog er auf alle Dinge wie z.B. Poesie, Musik, Sprache etc..
Augustinus hob die geometrischen Formen und deren Ausgewogenheit hervor. So waren für ihn gleichseitige Dreiecke schöner als ungleichseitige, Vierecke aus gleichlangen Segmenten schöner als gleichseitige Dreiecke, Kreise würden Vierecke noch um ein Vielfaches übertreffen und der vollkommene unteilbare Punkt war für ihn die vollendete Schönheit einer Form.
Auf seine Frage, worin die Schönheit eines Körpers besteht, antwortete Aristoteles: „In einer Harmonie seiner Teile und einer gewissen, angenehmen Farbe“. (zit. in Etcoff, S. 23)
Auch für Aristoteles war Schönheit „Ordnung, Symmetrie und Eindeutigkeit“.
Cicero schrieb von „einer gewissen symmetrischen Gestalt der Gliedmaßen, verbunden mit einem gewissen Reiz der Färbung“ (zit. in ebd., S. 23) und Plotin betonte die „Symmetrie der einzelnen Teile untereinander und als Ganzes (...) das Schöne ist im Wesentlichen symmetrisch.“ (zit. in ebd., S. 23) Er glaubte, dass Schönheit im Detail ebenso präsent sein müsse, wie im Ganzen. Sie könne nicht aus Hässlichkeit erschaffen werden, ihr Gesetz müsse insgesamt gelten.
Diese Theorien haben alle gemeinsam den selben Gedanken. Die Eigenschaften, welche Schönheit ausmachen, sind die gleichen: Schönheit ist, was sich Harmonie wiegt und Universalität besitzt, ein göttliches Prinzip, egal ob bei Mensch, Tier, Blume, Landschaft, Kreis usw..
Ein sehr bedeutendes Proportionssystem der westlichen Kultur geht nach dem Kunsthistoriker George Hersey, auf den griechischen Bildhauer Polyklet (500 v.Chr.) zurück, welcher sowohl die Skulptur eines männlichen Speerträgers, als Kanon bekannt, als auch die einer Amazone anfertigte. Sein Zeitgenosse Praxiteles schuf mit der Aphrodite von Knidos ebenfalls ein ähnliches Kunstwerk. Diese bedeutenden Werke beeinflussten die gesamte westliche Kunst von 450 v.Chr. bis ins 20. Jh.[1]
2.2. Die Formel der Schönheit
Schon der römische Architekt und Schriftsteller Marcus Vitruvius Pollio verfasste die „10 Bücher über Architektur“ 25 v.Chr., in welchen er empfahl, Tempel analog zur menschlichen Anatomie zu errichten, da seiner Meinung nach der Körper eine vollkommene Harmonie zwischen seinen Teilen erkennen ließe.[2]
Im 12. Jh. erklärte Bonaventura, dass ein Ding schön genannt wird, „(...) wenn in ihm Harmonie der Teile und Gleichheit vorhanden ist. Denn die Schönheit ist eine numerische Gleichheit (...).“ (Bonaventura zit. in Assunto, S. 233).
Etwas später schrieb Dante Alighieri: „Man nennt das schön, dessen Teile in entsprechendem Verhältnis zueinander stehen; denn aus der Harmonie der Teile entspringt Wohlgefallen. Ein Mensch erscheint dann als schön, wenn seine Glieder in entsprechendem Verhältnis zu einander stehen. Einen Gesang nennen wir dann schön, wenn die einzelnen Stimmen nach den Gesetzen der Musik einander entsprechen.“ (Alighieri zit. in Assunto, S. 237).
Später, im 16. Jh. stellte auch der Franziskanerpate Luca Pacioli fest, dass der menschliche Körper als Welt im Kleinen die Formel für Schönheit aller Dinge enthalte. Nach ihm offenbart Gott hier sein innerstes Geheimnis der Natur. Die berühmte Zeichnung von Leonardo da Vinci des vitruvianischen Menschen als ideale Gestalt greift diese Theorie auf und illustriert sie. Der Körper ist hier mit ausgestreckten Armen und Beinen in einem Kreis und einem Quadrat eingepasst.[3]
Diese Einbindung des menschlichen Körpers in die beiden geometrischen Formen beruht auf der archetypischen Vorstellung von der „Quadratur des Kreises“ und faszinierte schon den antiken Menschen deshalb, weil Kreis und Quadrat als heilige und vollkommende Formen galten. So stand der Kreis als Symbol der himmlischen Sphären, während das Quadrat die Erde symbolisierte. In Verbindung mit dem menschlichen Körper bedeutet dies, dass die menschliche Gestalt selbst eine Einheit von Himmel und Erde darstellt. Diese Vorstellung findet auch heute noch Bedeutung in vielen Mythologien und Religionen.[4]
Dieses Verhältnis von Harmonie wurde schon früh als der goldene Schnitt oder die Zahl Phi bekannt, in Anlehnung an den griechischen Bildhauer Phidias. Hierbei wird eine Linie oder Figur so geteilt, dass das Verhältnis des kleineren zum größeren Teil das gleiche ist, wie das des größeren Teils zum Gesamten[5] oder anders gesagt, entsteht der goldene Schnitt, „(...) wenn sich bei Teilung einer Strecke oder Fläche der längere Teil zum Ganzen wie der kürzere zum längeren verhält (...)“. (Cramer, S. 270f.) Das Verhältnis der Strecken, Flächen oder Figuren ergibt eine irrationale Zahl (1:1,618). Dieses Verhältnis, das als klassisches Verhältnis für schöne Formen geläufig ist, ist also ein irrationales Proportionsverhältnis und entspringt dem Chaosprinzip.[6]
Tatsache ist, dass viele, vor allem biologische Formen dieses Verhältnis aufweisen. In Muscheln, Blütenblättern, Architektur, Gemälden, menschlichen Gesichtern und Körpern, wie Friedrich Cramer im Buch „Natur im Umbruch“ beweist, ist diese Gesetzmäßigkeit zu finden. Beispielsweise steht die Länge der drei Glieder eines Fingers im Verhältnis des goldenen Schnitts zueinander. Das Pentagramm (Symbol der pythagoreischen Bruderschaft) besteht aus Liniensegmenten, die nach dem Goldenen Schnitt alle im Verhältnis zu den Segmenten der nächstkleineren Länge stehen.[7]
Hier gilt es anzumerken, dass der Goldene Schnitt nicht als statisches Phänomen angesehen werden darf, da er durch rückgekoppelte Wachstumsprozesse entsteht.[8] Cramer sagt hierzu, dass „Schönheit (...) entsteht, wenn ein dynamisches System gerade noch von dem Chaos ausweichen kann; Schönheit ist eine Gratwanderung zwischen Chaos und Ordnung, zwischen Zerfall und Erstarrung.“ ( Cramer, S. 276) In Kunst und Architektur nimmt der Goldene Schnitt seit langem eine bedeutende Rolle ein und „(...) ihm galt seit jeher das Augenmerk der Psychologie der Ästhetik.“ ( Henss, 1998, S. 55)
Weiter gibt es zahlreiche andere Literatur und Wissenschaftler, die diese Universalität der schönen Form beschreiben und beweisen.
Im Bezug auf die menschlichen Körperproportionen kam im Mittelalter auch der „magischen Zahl 7“ eine wichtige Rolle zu. So wurde das ideale Gesicht wie folgt beschrieben: „Das Haar bedeckt das obere Siebtel des Kopfes. Die Stirn nimmt zwei Siebtel der Kopfhöhe ein, ebenso die Nase. Ein Siebtel reicht von der Nase zum Mund, ein weiteres Siebtel vom Mund zur Kinnspitze“. (Lieggett , zit. in Henss, 1998, S. 55 )
Nach Hess kommt der Siebener-Regel und dem Goldenen Schnitt heute weniger Bedeutung zu, dagegen werden die Goldene Mitte bzw. der Durchschnitt und die Symmetrie stark diskutiert.[9] Dies werde ich im nächsten Kapitel näher beleuchten.
3. Exkurs zur Attraktivitätsforschung
3.1. Durchschnittlichkeit = Schönheit
Im 19. Jahrhundert begann der Naturforscher und Eugeniker Sir Francis Galton einen Idealtypus von Kriminellen zu konstruieren, indem er hunderte Aufnahmen derer Gesichter überblendete und die physischen Merkmale summierte. Überraschenderweise musste er feststellen, dass das „gemischte Gesicht“, welches als Resultat zustande kam, viel attraktiver erschien, als die individuellen Einzelgesichter. Das zusammengesetzte Gesicht ließ nach seiner Meinung „(...) Unebenmäßigkeiten, die das Aussehen individueller Gesichter entstellen“ verschwinden. ( Galton zit. in Etcoff, S. 163)
Das Resultat der Montage entsprach obendrein dem Schönheitsideal seiner Epoche.[10]
Galton verfolgte seine Studie nicht weiter, weil er wohl zu anderen Ergebnissen kam als er eigentlich durch das Morphen der Gesichter von Kriminellen beabsichtigt hatte. Trotzdem beeinflusste er damit die weitere Attraktivitätsforschung in hohem Maße.
Heute gibt es weltweit zahlreiche Studien, welche die Schönheit von Durchschnitten, auch „Goldene Mitte“ genannt,[11] mit Hilfe von digitalen Kompositionen erforschen und zum größten Teil mit Galtons Studie übereinstimmen.[12]
Anzumerken ist hierbei, dass es sich bei der Forschung von „Durchschnittsgesichtern“ um Gesichter handelt, welche den mathematischen Mittelwert einer Population entsprechen. Es handelt sich also nicht um Gesichter, die als „gewöhnlich“ oder „mittelmäßig“ gelten, sondern um ein Gesicht, das in allen Proportionen ein mittleres Gesicht darstellt.[13]
Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Koinophilie – die Liebe für das Gewöhnliche, auf einen neuronalen Schaltkreis im Gehirn zurückzuführen ist, welcher dafür zuständig ist, menschliche Gesichter wieder zu erkennen. Der Anthropologe Donald Symons spricht hierbei von einem „Mechanismus des Gehirns zur Durchschnittsbestimmung von Gesichtern“. (Symons zit. in Etcoff, S.165) Dieser angeborene Mechanismus des menschlichen Gehirns funktioniert demnach genauso, wie die Herstellung von gemorphten Gesichtern. Es werden Eindrücke von verschiedenen gesehenen Gesichtern gesammelt, welchen wir im Laufe von Jahren begegnen.
Aus diesen unterschiedlichen Gesichtern wird eine Art Prototyp oder Schablone gebildet, ein „internalisiertes Kompositum“, mit welchem das Äußere jeder Person, die zum ersten mal gesehen wird, verglichen und beurteilt wird.[14] Hier ist wichtig anzumerken, dass dieser Prototyp bei verschiedenen Geschlechts- und Altersgruppen variiert. Dies liegt daran, dass sich die Schablone immer wieder aktualisiert.[15] Laut Studien von Nancy Etcoff sind Gehirnregionen, welche mit der optischen Wahrnehmung und emotionalem Lernen zu tun haben, hierfür verantwortlich. Nach ihr sei besonders der rechte Temporallappen und eine darunter liegende subkortikale Struktur, welche als Amygdala bezeichnet wird, daran beteiligt. Diese steuern das Erkennen von Gesichtern und auch Gesichtsaudrücken.[16]
Beweise für dieses angeborene neuronale Referenzmuster kann folgendes Beispiel von Eibl-Eibesfeldt liefern. So betrachten nach diesen Studien Neugeborene Gesichtsattrappen, welche aus zwei Augenflecken, einem in der Mitte platzierten Mundfleck und einem durch eine Linie abgegrenztem Gesichtsoval bestehen, mit großer Aufmerksamkeit. Wenn man dagegen das Gesichtsschema um 180° dreht und so die Beziehung der Gesichtszüge zueinander nicht mehr stimmen, wird diesem Schema wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ebenfalls liefert das Krankheitsbild des Prosopagnosie-Syndrom ähnliche Beweise der angeborenen neuronalen Referenzmuster.[17] Dieses Syndrom kann durch Unfälle oder Verletzungen am Kopf entstehen und führt dazu, dass diese Patienten andere Personen und sogar sich selbst nicht mehr erkennen können. Erst durch Sprechen oder andere Reize, wie ein bestimmter Duft, können diese Personen andere Menschen identifizieren.[18]
Die Entdeckung der Galton`s Hypothese: Attraktivität = Durchschnitt, bedeutet aber nicht, das eine Abweichung vom Durchschnitt eine mindere Attraktivität erzeugt. Dies belegt die Studie von Perret, May und Yoshikawa.
Ausgangsthese dieser Studie war, dass sich die Attraktivität von Durchschnittsgesichtern durch Übertreibung von Merkmalen, welche für attraktive Gesichter charakteristisch sind, noch steigern lässt.
Diese These wurde von den Wissenschaftlern anhand eines Experimentes getestet.
Je 60 Gesichter von Kaukasierinnen und Japanerinnen wurden mit denjenigen der selben Kultur gemischt. Hierbei entstand ein Durchschnittsgesicht (a). Aus den 15 attraktivsten Einzelgesichtern wurde ein attraktives Gesicht (b) gemischt.
Weiter wurde die Differenz vom Durchschnittsgesicht zum attraktiven Gesicht nochmals um 50% gesteigert. Hieraus entstand ein übertrieben attraktives Gesicht (c).
Diese drei Gesichtstypen wurden anschließend Probanden, Männer und Frauen kaukasischer und japanischer Herkunft, vorgelegt. Alle kamen zum gleichen Resultat. Das attraktive Gesicht (b) wurde gegenüber der durchschnittlichen Komposition (a) bevorzugt, und das übertrieben attraktive Gesicht (c) wurde gegenüber dem attraktiven bevorzugt.
Nach Henss kann eine überragende Schönheit nicht mit dem Durchschnitt einer unausgelesenen Stichprobe gleichgesetzt werden. Dass aber ein Durchschnittsgesicht allgemein als ansprechend gilt, wird nochmals im nächsten Kapitel näher beleuchtet.
3.2. Symmetrie = Schönheit
Wie im zweiten Kapitel dargestellt, haben Künstler, Naturwissenschaftler und Philosophen der vergangenen Jahrhunderte die Symmetrie als Indikator menschlicher Attraktivität schon häufig angesprochen. Heute ist sie Hauptdiskussionsthema der Attraktivitätsforschung. Laut Henss ist im Zusammenhang mit der Symmetrie vorauszuschicken, dass der Prozess der Durchschnittsbildung zwangsläufig zu einer gewissen Symmetrie führt, weil sich durch das Übereinanderkopieren Abweichungen gegenseitig aufheben würden.
Nach einigen Studien werden symmetrische ebenso wie durchschnittliche Gesichter attraktiver eingestuft. Andere empirische Befunde besagen, dass es keine hohe Korrelation von Attraktivität und Symmetrie gibt. Wieder andere zeigen auf, dass perfekte symmetrische Gesichter nicht attraktiv erscheinen, weil solche Kompositionen, die es in der realen Welt nicht gibt, uns als unnatürlich erscheinen.[19]
Laut Etcoff werden auf einer Skala von eins bis zehn symmetrische Gesichter von sechs bis acht eingestuft, nicht aber bis zehn. Genauso wie Durchschnittlichkeit kann Symmetrie Bestandteil des attraktiven Gesichts sein, eine Garantie für außergewöhnliche Schönheit ist somit aber nicht gewährleistet.[20]
3.3. Das „Kindchenschema“
Ein weiterer Bestandteil der Attraktivitätsforschung bezieht sich auf die „Kindchenmerkmale“ eines Gesichts.
Hierzu ließen V. S. Johnston und M. Franklin (1993) Studenten mit Hilfe eines Computerprogramms ein Idealgesicht einer schönen Frau komponieren. Es kam ein Gesicht zustande, dass dem Durchschnittsgesicht der Population entsprach, in welcher die Studenten lebten, aber mit kindlichen Zügen ausgezeichnet.[21]
Wenn die vorher aufgeführte Studie von David Perritt u.a. nochmals näher betrachtet wird, kommt man zu der Erkenntnis, dass durch die Entstehung eines übertriebenen attraktiven Gesichts (c) die jugendlichen Merkmale besonders hervorgehoben wurden. Die Probanden fanden also das Gesicht, welches attraktiver als der Durchschnitt war und zudem noch kindliche Züge aufwies, am Schönsten.
Warum sich die Attraktivitätsforschung nun eingehend mit der „Durchschnittlichkeit“, „Symmetrie“ und dem „Kindchenschema“ befasst, hat evolutionspsychologische und biologische Hintergründe. Hiermit werde ich mich im nächsten Abschnitt näher befassen.
4. Schönheitsideale – ein kulturelles Gut oder biologische Determinante?
Ob Schönheitsideale nun aufgrund kultureller Einflüsse entstehen oder ob sie auf biologische Faktoren zurückgehen – hierüber streiten sich die Wissenschaftler.
Die Sozialwissenschaften befassen sich erst seit den 70er Jahren mit der menschlichen Schönheit, nachdem Ende der 60er Lindzey forderte, „(...) die Schönheit und andere morphologische Variablen wieder zum Studium sozialer Phänomene zuzulassen“. (Lindzey, zit. in Etcoff, S. 30)
Texte zur Psychologie und Anthropologie, welche vor dieser Zeit verfasst wurden, besagten, dass die physische Erscheinung eines Menschen nichts mit seinen Einstellungen, Gefühlen und geistigen Leben zu tun habe. Die Sozialwissenschaftler hatten die Meinung vertreten,
„(...) dass Schönheit eine Angelegenheit des individuellen Geschmacks oder kulturellen Diktats sein müsse.“ (Etcoff, S. 29). Diese Erkenntnis wurde belegt durch den Behaviorismus (nach Watson), nach dem jeder Mensch formbar ist und es keine genetischen Determinanten als Grundlage für menschliches Verhalten gibt.[22]
Auch heute vertreten noch viele Sozialwissenschaftler die Meinung, dass die Maßstäbe, nach denen Menschen als schön beurteilt werden, willkürliche kulturelle Definitionen sind, welche einem unablässigen Wandel unterlaufen sind.
Dies würde bedeuten, dass die Entstehung von Kriterien zur Beurteilung körperlicher Schönheit aufgrund kulturell vereinbarter Normen erlernt ist.
Diese Annahme des „erlernten Verständnisses für Schönheit“ lässt sich nachvollziehen, wenn betrachtet wird, wie schnell die Schönheitsideale im Laufe der letzten Jahrhunderte und vor allem in den letzten Jahrzehnten wechselten.
Nach evolutionspsychologischer und biologischer Sicht bezieht sich das Erkennen und Bevorzugen von Attraktivität allerdings auf den Fortpflanzungserfolg einer Spezies.[23]
Dieser Mechanismus ist bereits aus der Tierwelt bekannt und eingehend erforscht worden. Beispielsweise sind Pfauenmännchen mit besonders schönen und großen Schwänzen (die meisten Augen) bei der Partnerwerbung erfolgreicher als diejenigen, die nicht mit solch einer bewundernswerten Ausstattung versehen sind. Dies liegt aber nicht nur an der äußerlichen Attraktivität, sondern auch daran, dass Pfauenmännchen so den Weibchen signalisieren, dass sie stark genug sind, den Schwanz bei der Futtersuche mit sich herumzutragen und trotz der schweren Last dem Feind schnell genug entkommen können. Weitere Belege liefert das männliche Rotkehlchen. Es lockt die Weibchen mit der roten Kehle, welche gleichzeitig eine Bedrohung für Feinde darstellt und somit Stärke zeigt; auch der Hirsch prahlt mit seinem großen Geweih um die Gunst der Weibchen.
Diese Ausstattung mit Körperschmuck und Stärke signalisiert hier dem Andersgeschlechtlichen eine Art Fitnessindikator. Dies bedeutet die Fähigkeit eines Organismus, in einer bestimmten Umwelt zu überleben und sich fortzupflanzen zu können.
Da evolutionsbedingt nur gesunde und starke Gene weitergegeben und dadurch Mutationen und Schwächen ausgelöscht werden, reagiert die Wahrnehmung auf Merkmale, die eine erfolgreiche Reproduktion der Gene versprechen.[24]
Dass eine sexuelle Auslese bei Tieren stattfindet, erscheint plausibel und ist schon seit längerem bekannt, aber existiert diese auch beim Menschen? Haben wir den Tieren nicht voraus, dass wir unser Denken und Verhalten kontrollieren können? Und wenn ja, warum ist uns das Aussehen dann so wichtig?
Evolutionspsychologen gehen davon aus, dass auch beim Menschen die Attraktivität mit dem Partnerwert korreliert.[25]
Diese Sensibilität für Schönheit ist nach Etcoff auf einen Schaltkreis im Gehirn zurückzuführen, welcher durch natürliche Auslese der Evolution entstanden ist und auch beim Menschen darauf abzielt, den Erhalt der Gene, das Überleben der Spezies und die erfolgreiche Produktion der nächsten Generation zu sichern.
Zwar lässt sich die heutige Lebensweise nicht mehr mit prähistorischen Zeiten vergleichen und die Fortpflanzung ist in Zeiten von Verhütung auch nicht mehr so wichtig, trotzdem ist dieser Vorgang, wenngleich er unbewusst und unerwünscht ist, ein instinktives Überbleibsel unserer Vorfahren.
Dies wird deutlich, wenn wir uns bewusst machen, dass der Mensch bisher 99% Jäger und Sammler in der Menschheitsgeschichte war[26] und die Lebensbedingungen, welche sich im Zuge der industriellen Revolution in den letzen 200 Jahren entwickelt haben, weniger als 0,01% in der Geschichte der Menschheit ausmachen. Auch wenn Menschen frei denken und handeln können, sind sie ein Produkt der Evolution und Instinkte können sich nicht so schnell verändern.
Henss schreibt hierzu: „Viele Errungenschaften des modernen Lebens sind so neu, dass sich noch keine spezifischen Anpassungen daran entwickelt haben können.“ ( Henss, 1998, S. 81)
Um eine angeborene Sensibilität für Schönheit zu beweisen, haben Samuels und Ewy (1985) ein Experiment mit Säuglingen im Alter von drei bis sechs Monaten durchgeführt. Den Säuglingen wurden zwölf Bildpaare von Gesichtern vorgelegt, wobei eines als attraktiv und das andere als unattraktiv galt. Diese Bewertung wurde durch einen Vorversuch mit der Beurteilung von Erwachsenen ermittelt. Die Auswertung der Blickzeit ergab, dass bei allen Bildpaaren das attraktive Gesicht länger angeschaut wurde, als das unattraktive.[27]
In weiterer Literatur habe ich zu diesem Experiment Angaben gefunden, dass die zwölf Bildpaare aus Gesichtern unterschiedlicher Kulturen bestanden.[28]
Mit diesem Beweis ist es laut einiger Autoren (Henss, Etcoff) schwer nachzuvollziehen, dass die Bewertung von Attraktivität allein auf kulturelle Einflüsse zurückzuführen ist.
Dass die Säuglinge auch Gesichter attraktiv fanden, die anderen Rassen angehörten und mit welchen sie vorher keinen Kontakt hatten, ist vielleicht sogar ein Zeichen dafür, dass gewisse Merkmale universell als attraktiv gelten. Hierzu möchte ich noch folgenden Versuch von Jones und Hill (1993 bzw. 1996) skizzieren.
In dieser Studie wurden Personen aus Brasilien, USA, Salvador, Russland den Hiwi–Indianern aus Venezuela und Ache–Indianern aus Paraguay Fotos vorgelegt. Zu beurteilen waren Personen unterschiedlicher Kulturen und Rassen (Indianer, Afroamerikaner, Amerikaner asiatischer Abstammung, Weiße, gemischtrassische Brasilianer).
Das Ergebnis dieser Untersuchung war, dass Amerikaner, Russen und Brasilianer weitgehend übereinstimmten. Zwischen den Hiwi– und Ache–Indianern und den drei Gruppen waren hingegen weniger Gemeinsamkeiten zu erkennen.
Nach diesem Zwischenergebnis könnte man zum Resultat kommen, dass dies ein eindeutiger Beweis dafür wäre, dass Schönheitsideale kulturellem Gut entspringen.
Trotzdem stellt sich die Frage, warum die beiden Indianerstämme ähnliche „Definitionen von Schönheit“ wählten, obwohl sie sich über Jahrtausende hinweg unabhängig voneinander entwickelt haben und kein Kontakt bestand.
Nach Jones und Hill besteht der Grund hierfür darin, dass sich die Hiwi– und Ache–Indiander gegenseitig am Attraktivsten fanden, weil ihre Gesichtszüge sich ähnelten. Bisher hatten sie keinen Kontakt zur „weißen“ Bevölkerung und sahen wohl diejenigen nicht als typische Angehörige ihrer Gruppe an. Nach Henss seien aus evolutionspsychologischer Sicht bestimmte interkulturelle Unterschiede ebenso zu erwarten, wie gewisse interindividuelle Unterschiede.[29]
Gemeinsamkeiten aller Versuchspersonen bestanden darin, dass sie ähnliche geometrische Proportionen attraktiv fanden. Auch wurden von allen Frauengesichter bevorzugt, die mit großen Augen (im Verhältnis zur Länge des Gesichts) und mit zierlichen unteren Partien ausgestattet waren.[30]
Wenn diese Feststellung nun mit der Attraktivitätsforschung in Verbindung gebracht wird, stellt sich die Frage, ob Menschen wirklich weltweit ähnliche Attraktivitätsstandards besitzen und dies bedeuten würde, dass Schönheitsideale keine kulturellen Definitionen sind. Evolutionspsychologen und Biologen haben hierzu folgende Erklärung:
Als Maßstab für Attraktivität ist die Gesundheit eines Menschen anzusehen. Körperliche Deformationen und sichtbare Anzeichen einer Krankheit (Infektionskrankheiten, Seuchen) sind offensichtliche Hinweise für einen geringen Partnerwert, da die erfolgreiche Reproduktion der Gene gefährdet wäre.
Durchschnittliche Merkmalsausprägungen, Symmetrie und Jugendlichkeit haben sich durch die Evolution als Indikatoren für gesunde, widerstandsfähige und zur Fortpflanzung geeignete Partner entwickelt, und werden deshalb unbewusst bevorzugt.[31]
Diese Erklärung der Evolutionspsychologie scheint einleuchtend und wird auch durch zahlreiche Studien belegt. Welche Rolle spielen aber dann die kulturellen Einflüsse?
Die Evolutionspsychologen John Tooby, Jerome Barkow und Leda Cosmide stellten hierzu fest: „Kultur existiert nicht grundlos und ist nicht entkörpert. Sie entsteht auf vielfältige und komplexe Weise durch informationsverarbeitende Mechanismen, die im menschlichen Geist stattfinden. Diese Mechanismen wiederum wurden durch den Evolutionsprozess gestaltet.“ (Cosmides/Tooby zit. in Etcoff, S. 30f.) Durch dieses Zitat wird klar, dass zur Entwicklung einer Kultur bestimmte Grundlagen nötig sind. Diese Grundlagen beziehen sich auf menschliche Instinkte und angeborene Präferenzen.[32]
Der Evolutionsforscher Geoffrey F. Miller schreibt in seinem Buch „Die sexuelle Evolution“ folgendes: „Wenn Anthropologen behaupten, die Schönheitsideale schwankten je nach Kulturkreis erheblich, befassen sie sich meist auf die falsche Weise mit den falschen Merkmalen. Vielleicht mögen die Individuen der verschiedenen Kulturen unterschiedliche Hautfarben, aber alle bevorzugen saubere, glatte, faltenlose Haut. Frauen mögen unterschiedlich große Männer, aber fast alle ziehen Männer vor, die größer sind als sie selbst. Verschiedene ethnische Gruppen mögen vielleicht unterschiedliche Gesichtsformen, aber alle bevorzugen Gesichter, die symmetrisch sind und dem Durchschnitt ihrer Population entsprechen. Sucht man nach dem allgemein Gültigen menschlicher Schönheitsideale nicht auf der richtigen Ebene, wird man es auch nicht finden.“ (Miller, S. 259 f.)
Wenn unterschiedliche Kulturen also unterschiedliche Schönheitsnormen haben, und Schönheitsideale einem ständigen Wandel unterworfen sind, wird deutlich, dass die menschlich angeborenen Fähigkeiten, welche Schönheit erkennen lassen, durch kulturelle Normen überlagert werden.[33] Der Dichter Baudelaire erkannte schon im 19. Jahrhundert, dass Schönheit aus einem „ewigen, unveränderlichen Element“ und einem „relativen, durch Umstände bedingten Element“ bestehe. Mit dem Letzteren meint er „das Zeitalter, seine Moden, seine Moral, seine Emotionen“. (Baudelaire zit. in Etcoff, S. 31). Der Einfluss, der dieser kulturelle Aspekt auf Schönheitsnormen ausübt, wird im Folgenden betrachtet.
5. Wandel der Ideale – von gestern bis heute
5.1. Bis ins 20. Jahrhundert
Die Brockhaus Enzyklopädie erklärt, dass „(...) etwas nicht von allen Menschen und zu jeder Zeit für >schön< angesehen (wird). Vielmehr erweist sich das S.[34] als abhängig von historisch-kulturellen Normen und den Bedingungen individueller Erfahrungen.“ (Brockhaus, S. 434)
Wenn also laut Wissenschaftlern allgemein gültige Schönheit an einigen Faktoren festzumachen ist, sind Schönheitsideale doch durch einen fortwährenden Wandel gekennzeichnet, welcher wohl die jeweiligen Interessen und Wertmaßstäbe einer Epoche widerspiegelt.
Diese kulturellen Einflüsse lassen sich mit der folgenden Reise durch die Kulturgeschichte, beginnend mit der prähistorischen Zeit bis zum heutigen Medienzeitalter, am Ehesten verdeutlichen.
Einer der wichtigsten Funde aus der Steinzeit ist die Figur der „Venus von Willendorf“. Möglicherweise galt sie als Inbegriff von Fruchtbarkeit und Ursprünglichkeit der Mutter Erde. Dementsprechend sind ihre sehr weiblichen Formen gekennzeichnet durch ein ausladendes Hinterteil, einem dicken runden Bauch und großen, üppigen Brüsten.
Wie vorher schon angesprochen, galt in der griechischen Klassik eine Form von ausgewogenen Proportionen als schön. Infolgedessen wurde auch für den menschlichen Körper ein Gardemaß errechnet. Der vollkommene weibliche Körper sollte gleichgroße Abstände aufweisen, und zwar zwischen den beiden Brustwarzen, vom unteren Ansatz der Brüste bis zum Nabel und vom Nabel zum Schritt.
Einige Jahrhunderte später, in der Zeit der Gotik, kleideten sich die Edelleute in weite Gewänder, die durch einen Gürtel gehalten wurden. Männer sowie Frauen bevorzugten zarte Haut, lockiges, seidiges Haar und rote Wangen. Der weibliche Körper wurde auf Bildern aus der gotischen Zeit mit schmalen Schultern, ovalen Brüsten und einem langen, eiförmigen Bauch dargestellt. Im Vergleich zu den klassischen Griechen stellt der Kunsthistoriker Clark Kenneth fest, dass der Nabel genau doppelt so weit von den Brüsten entfernt war.[35]
In der Renaissance galt der weiblichen Brust besonderes Interesse. Auf Gemälden dieser Zeit lässt sich erkennen, dass sie sehr hoch, fast unnatürlich am Körper angesetzt wurden.[36] Auch wenn sich das Schönheitsideal der klassischen Griechen von diesem nun sehr unterscheidet, sind Gemeinsamkeiten bei der Hervorhebung von starken, kräftigen Füßen und Zehen und die im Vergleich zu heute kurz geschnittenen Fingernägel, erkennbar.[37]
Seit dem 16. und 17. Jahrhundert (Barock) lag das Augenmerk bei Männern sowie bei Frauen auf extremen Rundungen. Die Körperfülle war Ausdruck von Lebensfreude und Wohlstand. Vor allem der Maler Paul Rubens setzte die Leibesfülle bei seinen Gemälden beträchtlich in Szene.[38] Trotz des Statussymbols der auffälligen Rundungen wurde in der Barockzeit/viktorianischen Zeit zum ersten mal dem Korsett Aufmerksamkeit geschenkt. Die ersten hohen Damen, welche die schlanke Taille durch diesen „einschnürenden Käfig“, der aus Stahlstäben oder Fischbein bestand, betonten, waren Katharina von Medici in Frankreich (1519-1589) und Elisabeth I von England 1533-1603. Susan Brownmiller hinterfragt in ihrem Buch „Weiblichkeit“, warum gerade diese Damen, welche als ehrgeizig und kühn galten, sich diese „Folter“ antaten. Nach ihrer Meinung könnte es sein, dass „(...) der einzige Zug, den ihre Feinde ihnen hinter vorgehaltener Hand absprachen – weibliche Schwäche, ein sanftes, nachgiebiges Wesen – sich am besten in dem exzessiv kleinen und im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubenden Mieder unter Beweis stellen und zeremoniell zur Schau tragen ließ.“ (Brownmiller, S. 29) Interessanterweise war dieses zur Schau tragen keineswegs nur Frauen vorbehalten. Sogar Heinrich der VIII., Elisabeths Vater, schnürte ebenfalls, um seinen Brustkorb zu betonen. Männer trugen Ende des 17. Jh. hohe Absätze, wattierte, schulterbetonte Jacken und Hosenbeutel.[39] Um die Körpergröße außergewöhnlich hervorzuheben, wurden große ausladende Perücken aufs Haupt gesetzt.[40]
Aus dem Barock wurde im 18. Jahrhundert Rokoko und damit die Zeit von Frankreich und Ludwig dem XIV.
Um aufzuzeigen, dass Gepflegtheit und Reinlichkeit nicht immer zur Schönheit gehörten, sollte man die Tore von Versailles öffnen. In diesem Schloss des Königs von Frankreich gab es keine Toilette. Die Aristokratie erleichterte sich auf Fluren, Teppichen, hinter Vorhängen oder über Blumenkübeln, dem zufolge stank das ganze Schloss, trotz Unmengen von versprühtem Parfüm, bestialisch.
Wasser wurde in Versailles so gut wie nie zum Reinigen gebraucht. Es reichte, wenn der Körpergeruch reichlich überpudert und parfümiert wurde. Die Kleidung der Oberschicht war schimmernd und pompös – mit Lausfallen unter dem Rock.[41]
Außerordentliche Aufmerksamkeit kam auch den Haaren zu. Im Jahre 1715 kam es sogar zu einer Lebensmittelknappheit beim gemeinen Volk, weil die Aristokratie das Mehl reichhaltig zum pudern der Frisur benötigte. 1780 musste selbst der Eingang der Londoner St. Paul`s Kathedrale erhöht werden, damit die Oberschichtsdamen mit ihren Turmfrisuren durchkamen. Schlafen oder gerades Sitzen in Kutschen wurde zur Tortur, weil die Frisur nicht zerstört werden durfte.[42]
In der darauf folgenden Romantik und dem Klassizismus kam eine gewisse Schlichtheit in Mode. Die Zerbrechlichkeit der Frauen wurde auf Gemälden hauptsächlich durch große, kindlich – träumerische Augen und sanft abfallenden Schultern betont. Trotzdem gab es schon die ersten „künstlichen Brüste“, die aus Wachs bestanden. Seit 1813/1814 kam das Korsett, aufgrund der Annahme, dass der weibliche Körper von Natur aus ungesund sei und Halt an entscheidenden Stellen benötigt, wieder in Mode. Das Tragen eines Korsetts wurde den Mädchen bereits in der Kindheit beigebracht. Es in der Öffentlichkeit zu lockern oder vielleicht sogar ohne es zu erscheinen, galt als unsittlich. Bis Ende des 19 Jh. bildeten sich Frauen ein, dass ihr Rückgrat und die Muskulatur unfähig sei, das Gewicht von Brüsten und Bauch zu tragen. Tatsächlich waren die Muskeln durch das Nichtbenutzen und Einschnüren verkümmert, und die Damen waren dankbar ein Korsett zu tragen.
Im Zuge der Frauenemanzipation, während des 1. Weltkriegs, wurde das Korsett – vielleicht als Ritual der Befreiung – aufgegeben, und durch weite und bequeme Kleidung ersetzt.[43]
Auffällig ist beim Rückblick in die vergangenen Jahrhunderte, dass sich fast ausschließlich Frauen der Aristokratie und Oberschicht mit geltenden Schönheitsnormen auseinander setzten. Der normalen bürgerlichen Frau wurden eher Werte wie Arbeitsfähigkeit, Kraft und Fruchtbarkeit abverlangt, um den wirtschaftlichen Familienerhalt zu sichern. Dies sollte sich im Zeitalter der Industrialisierung und Technologisierung ändern, da die Familie als Arbeitseinheit weitgehend zerstört wurde[44] und weitere Modernisierungsprozesse auf die Gesellschaft einwirkten.
5.2. Die Schönheitsideale im Zeitalter der Medien
Die „goldenen" 20`er Jahre waren anfangs gekennzeichnet durch die politisch und gesellschaftlich belastenden Folgen der Nachkriegszeit, aber auch durch einen extremen Fortschrittsglauben und Vertrauen in neue Technologien. Die emanzipierte Frau trug nun einen kurzgeschnittenen Bubikopf, Charleston-Kleider und präsentierte ihre neue Unabhängigkeit mit einer langen Zigarettenspitze in der Öffentlichkeit.
Der Körper sollte straff, geschmeidig und gesund sein. Dementsprechend gewann die erste Schlankheitswelle, welche aus den USA über den großen Teich kam, zahlreiche Anhänger. Während die Frau nun wählen durfte, Bein zeigte, Lippenstift und Wegwerf-Monatsbinden benützte, hatten Gymnastik, Sport, aber auch Schlankheitspillen Hochkonjunktur.
Da die ideale Figur knabenhaft und flachbrüstig sein sollte, wurden die Brüste in eine Art Stoffbinde eingeschnürt. Möglicherweise wurde somit die gewünschte Gleichstellung von Frauen und Männern verkörpert und präsentiert.[45]
Während Bräune in den vorherigen Jahrhunderten dem arbeitenden Volk vorbehalten war, und die Aristokratie Puder benützte, um eine vornehme Blässe zu repräsentieren, war seit den 20er Jahren das Gegenteil der Fall. Bräune wurde zum Ausdruck des Wohlstandes, denn nur wer Zeit und Geld hatte, konnte sich den Aufenthalt am Strand leisten. Ebenfalls entstanden in diesem Jahrzehnt die ersten weiblichen Hollywood – Filmstars, welche von nun an das jeweilig aktuelle Frauenideal verkörperten und „dank der Medien“ weltweit alle Gesellschaftsschichten erreichten.[46]
Zu Beginn der 30er Jahre verlor die Emanzipation im Zusammenhang mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten zunächst an Bedeutung. Das neue Idealbild der Frau sollte Mütterlichkeit und Weiblichkeit, und somit „nährende“ Brüste, eine schmale Taille und breite Hüften erkennen lassen. Demzufolge wurde das Korsett nun in einer neuen Form eines elastischen Gürtels für Bauch und Hüften, getragen.[47] Bis Ende des Nationalsozialismus 1945 – im Zusammenhang mit der Rassenpolitik – galt die Verkörperung des arischen Äußeren als attraktiv.
Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg bis Ende der 50er Jahre war vor allem in Deutschland durch Kontraste geprägt. Die Kriegsfolgen zogen den Wunsch nach Geborgenheit und somit die Tendenz zur traditionellen Familienbildung nach sich. Gedanken an die Emanzipationsbewegung der 20er Jahr gingen ganz verloren.[48] Auf der anderen Seite gewann eine Orientierung nach Amerika an Bedeutung. Hier bastelte Hollywood an den ersten weiblichen Sexsymbolen. Filmstars wie Marilyn Monroe, Sophia Loren, Jane Russel und Gina Lollobrigida betonten besonders Taille und Brust. Durch enge Pullover und den richtigen Büstenhalter versuchte die Normalfrau diesem Idol näher zu kommen. Ebenfalls wurde der Beruf des „Mannequin“ gesellschaftsfähig und zum nachzueifernden Vorbild.
Nur drei Jahre nach Monroes Tod änderte sich das Idealbild der Frau gewaltig. In den 60er Jahren, als der französische Triangelbikini das weibliche Badeverhalten revolutionierte und soviel Haut wie nie zuvor in der Öffentlichkeit gezeigt wurde, sollte kein Gramm Fett mehr am weiblichen Körper sein. Die britische Kindfrau „Twiggy“ wurde 1965 als Titelmädchen der Vouge als neues Vorbild vermarktet. Ihre Körperformen erinnern mit der Größe von 1,70 und 42 kg an Magersucht. Im selben Jahr wurde die Anti-Baby-Pille erstmals zum Kauf angeboten, welche der Frau zu enormen Freiheiten bezüglich Karriere und Familienplanung verhalf; gleichzeitig gewann der Wunsch nach Gleichberechtigung wieder an Bedeutung.[49] Ähnliche Zusammenhänge vom Ideal eines knabenhaften Körpers mit der feministischen Bewegung lassen sich, wie schon in den 20er Jahren, erkennen.[50]
Jegliche gesellschaftlichen Zwänge wurden in der 68er–Bewegung in Frage gestellt. Bei der Miss Amerika-Wahl in diesem Jahr stellten Feministinnen als Zeichen der Befreiung eine Mülltonne auf, in welche Frauen BHs, Lockenwickler und Hüfthalter hineinwerfen konnten. Dieses Ereignis wurde als “BH-Verbrennerinnen“ durch die Medien bekannt.[51]
Laut Naomi Wolf existiert ein Zusammenhang zwischen der Frauenbewegung und dem Interesse an vermarkteten Moden, vor allem in Frauenzeitschriften. Die Verkaufszahlen gingen tatsächlich in der Hochzeit der Emanzipationsbewegung zurück. Das Augenmerk von Vogue wurde 1969 auf den „Nackt-Look“ gelegt.[52] Roberta Pollack meint hierzu, dass Vogue begann sich jetzt „genausosehr auf den Körper zu konzentrieren wie auf die Kleidung, unter anderem wohl deshalb, weil es angesichts der anarchischen Modestile wenig zu diktieren gab.“ (Pollack zit. in Wolf, S. 91).
Diese Konzentration auf den Körper hatte zur Folge, dass die Anzeigen über Diäten von 1968 bis 1972 bereits um 70% anstiegen und stetig mehr wurden.
1973 wurde in diesem Zusammenhang für das „weibliche Fettgewebe“ erstmals die Krankheit „Cellulites“ erfunden.[53]
Die feministische Bewegung seit Mitte der 60er Jahre hatte zur Konsequenz, dass auch die herkömmliche Rolle der Männer sich veränderte. Bei ihnen entwickelte sich ebenfalls vermehrtes Interesse an der äußeren Erscheinung und der Markt entdeckte eine neue Käuferschicht.
Seit den 80er Jahren verbreitete sich eine extreme Fitnesswelle. Die weiblichen Körperformen sollten schlank, aber gleichzeitig durchtrainiert sein, die Haut braun gebrannt. Weibliche Hüften oder kleine Bäuchlein galten als „dick“.[54] Minker schreibt hierzu: “Je androgyner die Gesellschaft sich gab, desto V-förmiger wurde die modische Frauenfigur, aerobic-gestählt à la Jane Fonda. Millionen Frauen kauften Hanteln und übten sich die Bäuche muskulös.“
( Minker, S. 10f.)
Aufgrund dessen vermehrten sich Artikel für Diäten grenzenlos. Bis 1984 konnte man in Buchhandlungen bis zu 300 Diätbücher und in Drogerien bis zu 103 anderweitige Abnehmartikel kaufen.[55]
Die extreme Körperkultentwicklung seit den 80er Jahren zog einen Boom der Schönheitschirurgie nach sich. Zwar gab es die klassischen Schönheitsoperationen schon länger, die Methode des Fettabsaugens wurde aber erst Anfang der 80er entwickelt.[56] Operationen um der Schönheit Willen wurden somit in allen Schichten der Bevölkerung gesellschaftsfähig. In einem Buch von 1982 mit dem Titel „Mein Körper und ich – Teenager“ gibt es ein extra Kapitel zur Schönheitschirurgie. Hier heißt es nach Wortlaut der Autoren: „(...) aber selbst wenn kosmetische Chirurgie keine Wunder bewirken kann, zweifellos kann sie dazu beitragen, euer Aussehen zu verbessern, manchmal sogar auf spektakuläre Weise.“ (McCoy/Wibbelsman, S. 206) Dies hört sich wohl mehr an wie ein Werbeslogan eines Schönheitschirurgen, als eine Literatur für Teenager. Ähnliche Äußerungen finden sich auch zu Gewichtsproblemen. Es wird z.B. von „(...) Fett (...) aus eurem Körper zu verbannen (...)“ gesprochen. (ebd. S. 165) Damit war wohl der Weg zu Essstörungen und kosmetischer Chirurgie entgültig geebnet.
Zu Beginn der 90er Jahre gingen die Tendenzen vom stählernen Körper wieder in Richtung weibliche Kurven. Allerdings nur am Oberkörper, Taille und Hüften sollten weiterhin schmal gebaut sein.[57] Ebenfalls entwickelte sich seit den 90ern ein extremer Modelkult. Das Phänomen „Supermodel“, wie es Claudia Schiffer, Naomi Campbell und Cindy Crawford mit ihren einheitlichen Maßen 90-60-90 verkörperten, wurde durch die Medien zum perfekten Ideal erhoben. Einem ähnlichen Diktat waren auch die Männer ausgesetzt, während Topmodel Markus Schenkenberg mit seinem durchtrainierten Körper für enge Unterhosen warb.[58] Schon 1988 wurden bereits 20% der Schönheitsoperationen bei Männern durchgeführt.
Während Frauen meist durch kulturelle Einflüsse in „Formen gepresst“ wurden, sind seit dem Zeitalter der Medien auch Männer einem nachzueifernden Ideal ausgesetzt. Grund dafür ist die Entdeckung einer zusätzlichen Käuferschicht und somit wohl die wirtschaftlichen Interessen großer Konzerne.[59]
6. Ursächliche Mechanismen für das „Konzept der neuen Körper“
6.1. Konsum – und Überflussgesellschaft
Seit Jahrhunderten haben sich Philosophen, Anthropologen und andere Geisteswissenschaftler mit dem Verhältnis von Leib und Seele beschäftigt. Hierbei galt primär durch Lebenskunstlehre der Frage nachzugehen, wie der Mensch das „(...) richtige und wahre Maß finden könne, um nicht in ein selbst verschuldendes Elend zu geraten.“ (Bodamer, S. 12)
Durch die technisch-industrielle Revolution, die ökonomische Umwälzung und den Fortschrittsglauben verlor diese Lehre allerdings an Bedeutung und wurde durch einen Optimismus gegenüber dem Fortschritt ersetzt.
Die heutige Industriegesellschaft und der technische Fortschritt bringt dem modernen Menschen zwar materielle Vorteile und eine Verbesserung des Lebensstandards, aber gleichzeitig gibt es auch eine negative Seite. Besonders Umweltschäden, Bedrohung der Gesundheit und Massenvernichtungsmittel müssen hier als massive Nachteile genannt werden.
Gleichzeitig wirkt sich die Technisierung aber auch auf das Verhalten und das Gleichgewicht eines Menschen aus. Bodamer spricht hier von einer „Seelenverschmutzung und geistigen Verwahrlosung“ (Bodamer, S. 14), indem der moderne Mensch sich nicht mehr über sich selbst, sondern über materielle Dinge definiert. Dementsprechend versucht der Mensch in jeder neuen Mode, in Trends und in Werbeideologien sein Wesen zum Ausdruck zu bringen und fällt dieser Manipulation zum Opfer.[60]
Mode ist demnach paradox. Einerseits möchte man durch sie die Individualität zum Ausdruck bringen, andererseits werden die Ideen anderer übernommen. Sobald ein Trend zum Gruppenphänomen wird, muss sich die Mode erneuern.[61] Durch vorherrschende Besitzgier und Konsumneid, einem „Laster der Industriegesellschaft“ fällt es der Wirtschaft leicht, Bedürfnisse zu suggerieren und zu implantieren, die der Mensch in Wirklichkeit nicht hat.[62] Mode verbunden mit dem gängigen Schönheitsideal ist zwar in der Menschheitsgeschichte schon immer und überall zu finden gewesen, da sie Abbild von jeweiligen sozialen und kulturellen Mentalitäten und Stimmungen ist.[63] Sie hat sich aber nie mit solch einem Tempo geändert wie in der westlichen Industriegesellschaft. Mode und Schönheit ist der Wirtschaftsfaktor Nummer eins. Sie muss sich deshalb so schnell ändern, weil so der Verbrauch, die Warenproduktion und der Verschleiß immer mehr gesteigert werden kann.[64]
In einer Konsumgesellschaft wie der unseren wird der Körper selbst zum Kapital. Nach Posch u.a. liegt der Grund hierfür in der zunehmenden Bedeutungslosigkeit des Körpers in der Erwerbsarbeit. Weiter funktioniert dieser Mechanismus, weil die Schönheitsideale fast nie erreicht werden können und es sich noch schwieriger gestaltet, Schönheit zu erhalten. Posch, Wolf, Deuser u.a. sprechen sogar von einem Währungssystem der Schönheit, da Menschen – speziell Frauen – für Schönheit bezahlen, gleichzeitig den Körper vermarkten und dadurch die Bedeutung von Schönheit durch Konkurrenzverhalten vorangetrieben wird. So entsteht eine neue Kluft zwischen Schönen und Unschönen, die als soziale Differenzierung und Klassenmerkmal zur neuen Schicht wird. Die Schicht der Schönen gliedert sich demnach an die Schicht der Reichen an.
Im Gegensatz zu früheren Zeiten, in welchen Körperfülle als Ausdruck von Wohlstand galt, ist die Konsum- und Wohlstandsgesellschaft geprägt von einem Bild der schlanken Körper.[65]
Nach dem Soziologen Thorstein Veblen ist die Körperform Spiegel des Lebensstil. In armen Gesellschaften wird Üppigkeit zum Zeichen des Reichtums und der Schönheit. In Überflussgesellschaften dreht sich dieses „Gewichts-Kastensystem“ um. So heben sich die Reichen wieder von den „Ärmeren“ ab. Analysen belegen, dass Fettleibigkeit bei den amerikanischen Frauen siebenmal häufiger in unteren Schichen auftritt als in der Oberschicht. Die Anorexia nervosa (Magersucht) dagegen ist vorwiegend als Krankheit in Oberschichten zu finden.[66]
Da minderbemittelte Menschen meist mit anderen existentiellen Sorgen zu kämpfen haben, als dem schlanken Schönheitsideal näher zu kommen, wird diese Differenz verständlich. Gleichzeitig fördert der Nahrungsmittelsektor dieses Verhalten, indem fettarme Ernährung oft teuerer ist als fettreiche.[67]
Letztendlich verbessert sich zwar die äußere Lebensqualität durch die Konsumgesellschaft, aber der Mensch verkümmert dabei seelisch und geistig. Sein Selbstbewusstsein und sein Selbstwertgefühl ist abhängig von dem, was er an Äußerlichkeiten besitzt, und nicht mehr von seinem Wesen.[68]
6.2. Die Technisierung des Körpers
Im Zeitalter des technisch-industriellen Fortschritts gilt die Norm der Effektivität und Effizienz, um beste wirtschaftliche Erfolge erzielen zu können. Nur der neusten Erfindung, dem noch Effektiveren und Modernsten wird Aufmerksamkeit geschenkt, während das überholte und alte Produkt unbrauchbar wird.
Dieser immer schneller werdende, letztendlich sich selbstproduzierende Prozess beeinflusst aber auch das menschliche Selbstverständnis. Wie die neusten technischen Errungenschaften hat auch der Mensch nur noch eine Leistungsfunktion und lässt die Wichtigkeit menschlicher Werte verblassen. Wenn die Deutschen im Bezug auf ihren Körper unter gesellschaftlichen Ansprüchen leiden, dann geben sie bei der Kategorie „gesund und leistungsfähig zu sein“ mit 28% die höchste Wertung ab. Im Geschlechtervergleich wird diese Kategorie bei Frauen (31%) noch höher bewertet, als bei Männer (25%).[69]
Besonders deutlich wird dieser Anspruch bei Leistungssportlern, welche ihren Beruf nur in jungen Jahren mit voll funktionsfähigem Körper ausüben können. Jugendlichkeit und Gesundheit wird zu einem utopisch notwendigen Ziel erhoben, dem es gilt zu entsprechen, um als „Maschine Mensch“ in der Gesellschaft funktionieren zu können. Nach Bodamer bleibt dieser Zustand beständig, weil „(...) man sich in der technischen Welt, in dieser Welt der Mache und Machbarkeit, durchaus bewegen kann (...)“, weiter schreibt er: „Da nun Jugendlichkeit und Jugend schon an sich ein utopischer Zustand sind, kann es bei der Überbewertung dieses Zustandes nicht verwundern, dass wir von Utopien und Zukunftsvisionen geradezu heimgesucht werden (...).“ (Bodamer, S. 30)
Solchen Utopien begegnet man z.B. in der Mode oder Werbung, indem sie alleinst die Jugend bevorzugt und das Frische, Unbeschwerte und Anfängliche verherrlicht und alles erdenkliche angeboten wird, um diesen Zustand zu erhalten oder zu perfektionieren. Das Alter und das Unperfekte wird dagegen hinter Fassaden versteckt und kaschiert oder einfach operativ umgestaltet.[70]
Die dominierende naturwissenschaftliche Medizin, welche der technischen Perfektion verpflichtet ist, definiert den menschliche Körper ebenfalls als maschinelles „Wesen“. Indem Krankheit als Funktions– und Leistungsstörung gilt und Gesundheit durch Reproduktion, Austausch oder Implantation wieder herzustellen ist, damit der Mensch wieder volle Leistung erbringen kann. Bodamer behauptet sogar, dass der „Maschine Mensch“ ein „Recht auf Krankheit“ verwehrt bleibt.[71]
Ist der menschliche Körper voll funktionsfähig, lassen sich aber immer noch Verbesserungen am Design vornehmen, das Aufgabengebiet der plastischen Chirurgie.
Die Technisierung der Medizin greift gleichzeitig in die alltägliche Lebensführung des Einzelnen ein. Durch technische Normung von Körper– und Lebensrhythmuswerten wird die Kontrolle und die Steuerung des Körpers verschärft. Steuerungsinstrumente wie Schlafmittel, Mittel zur Regulierung des Stuhlgangs, Entspannungs– und Schmerzmittel finden Einzug im persönlichen Lebensprozess.[72]
Die weit verbreitesten Instrumente sind aber wohl die Diätmittel und die Körperwaage. Die Diätmittel verhelfen dabei möglichst schnell einen normierten Körper zu erreichen. Die Körperwaage wirkt als Instrument der Selbstkontrolle, um das eigene Gewicht zu kontrollieren, nachzuvollziehen und vor allem zu vergleichen.
Posch nennt neben der Personenwaage noch andere technische Errungenschaften wie großflächige Spiegel, Fotografie und Film als Kontrollinstanzen für den menschlichen Körper.[73] Auf diese Instrumente möchte ich allerdings erst im nächsten Abschnitt näher eingehen.
Die Normierung des Menschen und die Bedeutung der Leistungsfähigkeit in der technischen Gesellschaft führen jedoch nicht zu einer Harmonie zwischen Mensch und Umwelt und somit auch nicht zur wahren Gesundheit. Bodame r schreibt: „(...) wird aber die Leistungsfähigkeit zum Kriterium erhoben und nicht die wahre Gesundheit, dann verwischen sich die Grenzen zwischen gesund und krank, und es entsteht der Mensch der heutigen Zeit, der weder das eine noch das andere ist, zwar nicht krank, aber anfällig, wohl gesund, aber nicht in vollem Besitz seiner Lebendigkeit. Krankheitszustände also, die eigentlich keine sind und oberflächlich mit Tabletten scheinhaft kuriert werden, „uneigentliche Krankheiten“, massenhaft verbreitet, und mit der Struktur der Leistungs– und Überflussgesellschaft gleichsam epidemisch verbunden.“ (Bodamer, S. 42)
Die „uneigentlichen Krankheiten“ lassen sich beim Hinterherjagen nach dem Schönheitsideal wohl am häufigsten finden. Jede Falte, ein Haar zu viel oder zu wenig, zu dick zu dünn, zu groß zu klein, unreine oder schlaffe Haut, jeder äußere Makel wird als eine Art Krankheit bekämpft. Als Resultat entsteht ein mangelndes Selbstwertgefühl und andere psychische und soziale Probleme für die der Mensch anfällig wird und die ihn an seiner ursprünglichen Lebendigkeit hindern.
6.3. Die Medien und das Verschwinden der Wirklichkeit
Im vorherigen Abschnitt wurde von technischen Kontrollinstrumenten gesprochen. Neben der Erfindung des großflächigen Spiegels, welcher als Beobachtungsinstanz eine neue Art der Selbstwahrnehmung zur Folge hatte, stellten die ersten visuellen Medien wie Fotografie und Film ebenfalls ein Instrument der Selbstkontrolle dar.
Durch die Aufzeichnung und der Reproduzierbarkeit menschlicher Körper war es Menschen erstmals möglich, sich selbst so zu sehen, wie andere sie sehen. Dieser technische Fortschritt rückte den menschlichen Körper mehr ins „Rampenlicht“ als jemals zuvor. Durch die maximale Sicht auf den menschlichen Körper konnten Bewegungen und Veränderungen, aber auch Defekte und Mängel erstmals festgehalten, verglichen und kategorisiert werden. Penz/Pauser beschreiben diese Erscheinung als „(...) Demokratisierung des Mangels (...)“, (Penz/Pauser zit. in Posch, S. 27) welcher die Bedeutung von Körperlichkeit proportional zur Anhäufung und Verbesserung seiner Abbildungen zunehmen lässt. Folglich entsteht ein Streben nach Schönheit, welches durch die dauerhafte und grenzenlose Konfrontation mit Schönheit und die daraus resultierende Schönheitskonkurrenz zum Massenphänomen wird.[74]
In der heutigen Mediengesellschaft kann man sich einer ständigen Konfrontation kaum entziehen. In den USA verbringen Kinder jährlich 1170 Stunden vor dem Fernseher, in der Schule verbringen sie dagegen nur 900 Stunden.[75] Diese Bilderflut und das Reiz–Überangebot haben Auswirkungen auf die menschliche (Selbst–)Wahrnehmung und bestimmen so letztendlich unsere Umwelt. Klaus–Ove Kahrmann spricht hier von einem nicht–authentischen Erleben. Im Gegensatz zum authentischen Erleben bzw. Erfahren, welches original und auf alle Sinne bezogen ist, wird die nicht–authentische Erfahrung nur durch Medien vermittelt. Die Medien können die Wirklichkeit nie objektiv widerspiegeln. Auch wenn Beiträge wertfrei und realistisch wirken, muss man sich als Konsument auf die Denkwelt der Journalisten oder Autoren einlassen. Die „mediale“ Wahrnehmung ist somit sinn– und handlungsreduziert und eine Selbstorganisation nur eingeschränkt möglich. Durch fehlenden Mechanismus, welcher mediale und authentische Ereignisse trennt, wird die Fremdbestimmung durch Adaption in eine Pseudo–Selbstbestimmung umgewandelt, dabei findet meist keine Reflexion statt und: „Das Authentische wird nicht plötzlich, sondern allmählich durch das Nicht-Authentische ersetzt.“ (Kahrmann in Stock, S. 107).[76]
Die publizierte Perspektive, welche wir sehen, hören oder lesen und die immer durch Inszenierung gekennzeichnet ist, wird also als Wirklichkeit wahrgenommen und beeinflusst so unser Alltagsleben.[77] Besonders die Werbung nutzt diesen Wirkmechanismus um Zielgruppen zu manipulieren, Konditionierungsketten auszulösen und so besonders gute Absatzzahlen zu erreichen.[78] Bei einer täglichen Konfrontation von ca. 1000 Reklame-Impulsen, welche meist durch junge, schöne und reiche Menschen präsentiert werden, wird die körperliche Selbstwahrnehmung erheblich beeinflusst. Als Vorbild gelten „(...) die stereotypen Bilder dessen, was schön und begehrenswert ist, welche Menschen Erfolg haben, was ein Mann ist, was eine Frau ist (...).“(Drolshagen, S. 217)
Wahrgenommen wird nur das Endergebnis als „Kunstprodukt“ und nicht die Produktionsschritte und Werbeinszenierung, welche vollzogen werden mussten, um dem Konsument eine perfekte DIN–Attraktivität zu präsentieren und zu implantieren. Posch/Drolshagen merken hierzu an, dass Menschen zwar nicht unkritisch kopieren, was gesehen wird, aber durch bewusstes oder unbewusstes Vergleichen und durch den Wunsch nach Veränderung im Bezug auf die Moderne werden die Medien zu unserer Informationsquelle.
Sie machen uns darauf aufmerksam, was gerade als attraktiv gilt, pflanzen den Mangel in das Selbstwertgefühl ein und zeigen gleichzeitig auf, welche Praktiken es möglich machen, diesem Ideal näher zu kommen.[79] Posch hält fest, dass wir ohne die Medien wahrscheinlich glücklicher mit unserem Äußeren wären. Ohne die permanente Zur – Schau – Stellung perfekter Körper und Verbesserungstechniken würden die Menschen vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, einen solchen Mangel zu besitzen.[80] Durch die Medien wird das perfekte Aussehen als normal präsentiert, könne mit genügend Anstrengung von jedem erreicht werden. Das Schönheitsideal wird aber aus kommerziellen Gründen ständig höher gesteckt, so dass immer mehr Aufwand betrieben werden muss, um ihm ein Stück näher zu kommen.[81] Dass es in Wahrheit für den biologischen Körper normal ist, einen Alterungsprozess zu durchlaufen, Körperhaare zu haben, Cellulitis oder Schwangerschaftsstreifen zu bekommen, wird verschwiegen.[82] Als Ideal gilt der „genormte Mensch“.
6.4. Verlust von Religion und Tradition
Die bisher aufgeführten Mechanismen des technischen Zeitalters greifen noch auf eine weitere Weise in die Bedeutung des menschlichen Körpers ein. Nach Peter Gross, einem der wichtigsten Kritiker der Postmoderne, verlieren „göttliche Welten“, an welche Menschen seit Jahrhunderten geglaubt haben, an Bedeutung. Durch das Vorandringen und Eingreifen der Menschen in den „(...) letzten obskuren Winkel der Welt“ wird: „Der ehemals von Dämonen und Geistern, von Göttern und Teufeln beherrschte Zaubergarten (...) zu einem – wie es Max Weber formuliert – Feld immanenter Sachlichkeit, Unpersönlichkeit und Beliebigkeit.“
(Gross, S. 30f.)
Durch „Entzauberung der Welt“ (Max Weber) verliert die religiöse Welt des Jenseits an Verbindlichkeit und wird gleichzeitig in das Diesseits transformiert. Die Angebeteten der „realen Welt“ sind die Stars und Idole unserer Zeit. Der Körper gilt als letzte Eroberung des menschlichen Fortschritts. Während Asketen und Mystiker der Vormoderne, oder wie sie heute noch in anderen Kulturen zu finden sind, sich von weltlichem Dasein und vom „Fleisch“ befreien wollen, um Erlösung im Jenseits zu finden, versucht der Mensch heute seinen Körper unter Kontrolle zu bekommen, um sein Glück im Diesseits zu erreichen. Gross schreibt: „Die funktionale Bedeutung des Körpers als Plattform des Denkens und als Geh- und Werkzeug für die alltäglichen Bedürfnisse weicht der symbolischen.“ (ebd. S. 32) So werden die Anstrengungen, die zu einem gestylten und trainierten Körper führen, etwa durch Fitness, Diät usw. gesellschaftlich und sogar finanziell honoriert (vgl. Kapitel).[83]
Rodin erklärt zusätzlich, dass in unserer Gesellschaft tradierte Unterscheidungsmerkmale hinsichtlich einer Schichtzugehörigkeit oder Abstammung zunehmend verschwinden. Da es zur menschlichen Orientierung notwendig ist, „Vergleiche anzustellen“ und „sich von anderen unterscheiden zu wollen“ und dies durch Hierarchien und soziale Strukturen (Religion, Elternschaft, Geld, Erziehung) nicht mehr möglich ist, wird der Körper selbst zum Unterscheidungskriterium. Demnach wir der Körper zur Identität und zum sozialen Wert. Das attraktive Äußere und der Aufwand, der betrieben wird, um dem perfekten Körperideal näher zu kommen, gelten als Ausdruck für erfolgreiche Lebensweise. Auch Rodin erklärt wie Gross, dass durch zunehmende Säkularisierung „(...) Schönheitswerte und – ideale die traditionellen moralischen und religiösen Standards abgelöst“ haben. ( Rodin, S.23)
Durch den Verlust der Lebenskunstlehre (vgl. Bodamer, 6.1) und der Bedeutungslosigkeit des „Arbeitskörpers“ wird der materielle Körper zur persönlichen Identität. „So ist das Sich – in – Form – Bringen zum neuen moralischen Imperativ geworden – ein verlockender Ersatz für Altruismus und sinnvolle Arbeit. Der Wunsch, gut auszusehen, ersetzt den Wunsch, Gutes zu tun.“ (ebd., S. 22f.)[84]
6.5. Schönheit und die feministische Sichtweise
In der mir zugrunde liegenden Literatur wird der Schönheitskult meist ausschließlich mit Frauen in Verbindung gebracht. Gleichzeitig wird bei ursächlichen Mechanismen für ein neues Körperkonzept immer wieder auf eine mögliche Verknüpfung von Feminismus und Schönheit hingewiesen.
Nach der feministischen Sichtweise wird der Kult um die weibliche Schönheit als „letztes Mittel gegen die Emanzipation“ verstanden.
Nach Wolf und Schneider konnte die Bedeutung der weiblichen Schönheit erst solche Ausmaße annehmen, nachdem die westliche Mittelschichtsfrau die Möglichkeit hatte, ihre traditionelle Rolle in Abhängigkeit vom Mann weitgehend aufzugeben und materielle Unabhängigkeit erreichte.
Durch das Voranschreiten der Frauen in etablierte männliche Machtbereiche wird laut der Autorinnen die Stabilität männerbeherrschender Strukturen und Institutionen gestört und bedroht. Die Befreiung vom Kinder–Küche–Kirche–Zwang müsse demnach abgelöst werden von einem neuen Instrument der sozialen Kontrolle. Da die westliche Mittelschichtsfrau materiell nicht mehr geschwächt werden kann, muss sich das System psychologischer Mittel bedienen. Dies geschieht mit Hilfe von neuen Gesetzen und Aufgaben, welche Frauen auferlegt werden. Diese neue Norm ist der Schönheitsmythos. Wolf behauptet, der Schönheitsmythos sei Mittel und politische Waffe gegen den Feminismus, eine „(...) heftige reaktionäre Rückschlagsbewegung (...), um das gesellschaftliche Vordringen der Frau aufzuhalten (...).“ (Wolf, S. 13)
Eine Koppelung des Feminismus mit einem schlanken Schönheitsideal wird besonders in den Hochzeiten der Emanzipationsbewegung (vgl. 5.2) ersichtlich: „Es scheint, als sei jeder feministische Vorstoß dadurch zu entschärfen versucht worden, daß Frauen sich dünn machen sollen.“ ( Posch, S. 25)
Vor allem seit den 80er Jahren ist ein Vordringen der Frauen in etablierte männliche Machtbereiche zu beobachten. Frauen besitzen heute mehr finanzielle Mittel, Macht, Möglichkeiten und Rechte als je zuvor. Gleichzeitig wird aber der Kult um die weibliche Schönheit immer bedeutsamer, die Schönheitsideale werden verstärkt durch die schnell wechselnden Ideale immer subtiler mit der Folge, dass das körperliche Selbstwertgefühl immer geringer wird.
Dies lässt sich durch den unglaublichen Boom und die Umsatzzahlen der Kosmetikindustrie, der Schönheitschirurgie, den Verkaufszahlen von Diätmitteln und Büchern, dem Besuch von Fitnesscentern und Beauty-Farmen und nicht zuletzt an dem stetig wachsenden Anstieg von Essstörungen, belegen.[85]
Nach Wolf sind die Haupttriebfelder des Schönheitsmythos politische und finanzielle Interessen, die stark mit Institutionen von Macht verbunden sind.
Der Schönheitsmythos als Mittel gegen die „neugewonnene Freiheit“ gründet sich demnach auf der ökonomischen Notwendigkeit. John Kenneth Galbraith erklärt, dass die „(...) Konsumentenfunktion der Frau eine entscheidende Vorraussetzung für die Entwicklung unserer Industriegesellschaft war und ist. Verhaltensweisen, die aus ökonomischen Gründen unerlässlich sind, (...) werden zu gesellschaftlichen Tugenden erhoben.“ (Wolf nach Galbraith, S.22) Nachdem die „tugendhafte Häuslichkeit“ als Konsumfunktion ihren Wert verlor, wurde an diese Stelle der neue Konsum–Imperativ „Schönheitsmythos“ gerückt. Verschleiert aufgezwungen wird die wirtschaftliche Funktion der Frau durch die Populärsoziologie, die Frauenzeitschriften, welche einerseits ein Solidaritätsgefühl entstehen lassen, ein Forum für ernste Frauenbelange bieten, gleichzeitig aber gespickt sind von Werbung und Verschönerungsvorschlägen. Grund dafür ist die Finanzierung solcher Zeitschriften. Auch wenn sie von Frauen und für Frauen geschrieben sind, können sie nicht existieren, ohne das sie den Anzeigekunden gerecht werden.[86]
Bezogen auf das weibliche Selbstwertgefühl wird Frauen laut Schneider immer noch glaubhaft gemacht, dass „eine schöne Maske“ mehr Wert sei als ihr eigener Körper, ihr Gesicht und ihre Fähigkeiten. Demnach haben Frauen ihre Lebensziele an Äußerlichkeiten festgemacht. Ziele wie Vitalität, Frische, Kraft, Energie und gesicherte Zukunft werden auf die Hautoberfläche transformiert und von Kosmetikfirmen versprochen.[87]
Drolshagen geht noch einen Schritt weiter, indem sie einen Zugang zur „männerbeherrschenden Arbeitswelt“ mit einem männlich angepassten Frauenkörper in Verbindung bringt. Dies bedeutet, dass Frauen, die in männlich dominierende Bereiche eindringen wollen, sich an dem „Erfolgsmodell Mann“ auch in körperlicher Hinsicht orientieren. Eine Bändigung von weiblichen Formen und Zyklen geht hier einher[88] und die Bilder von solchen Körpern werden durch zahlreiche Models präsentiert und durch einen Anteil von 60% Frauen in deutschen Fitnessstudios bestätigt. In Amerika macht das Erfolgsrezept des perfekten Frauenkörpers als „ tubular body “ die Runde.[89]
Posch schreibt, dass es hierbei um Kontrolle geht: „Frau von heute hat sich im Griff, sie ist stark und lässt sich nicht gehen. Wenn sie sich auch im Alltag nicht durchsetzen kann, signalisiert wenigstens ihr Körper Kraft und Kontrolle.“ ( Posch, S. 71)
Letztendlich ist es aber laut der meisten Autorinnen nicht zulässig, allein das Patriarchat, den Kapitalismus oder die Medien/Werbung für den Kult um die Schönheit verantwortlich zu machen. Die Mechanismen funktionieren, obwohl niemand direkt die Fäden zieht, alles hängt ursächlich mit allem zusammen und letztendlich funktioniert deshalb alles, weil auch Frauen ihren Teil dazu beitragen.[90]
6.6. Die Sozialisation des schönen Körpers
Die bisher genannte Ursachen bezogen sich auf einen makrosystemalen Kontext, die durch den Fortschritt und die Technisierung gesamtgesellschaftlich eine Massenwirkung erzeugen.
Zusätzlich wirkt noch ein anderes System auf die Bedeutung der körperlichen Erscheinung, das weitgehend tradiert ist. Gemeint sind hier Mikro– und Mesosysteme, die besonders die Sozialisation und das damit verbundene geschlechtsspezifische Verhalten Heranwachsender bestimmen.
Nach der biologischen Forschung sind die typisch weiblichen oder typisch männlichen Verhaltensweisen teilweise an verschiedenen Gehirnstrukturen und den unterschiedlichen Hormonen festzumachen. Diese Mechanismen könnten aber auch durch langfristig einwirkende kulturelle und soziale Einflüsse entstanden sein. Letztendlich ist es so, dass Anlage und Umwelt immer noch zusammen wirken müssen.[91]
Mädchen und Jungen erfahren immer noch eine unterschiedliche, typisch männliche und typisch weibliche Erziehung, welche sich an kulturellen Vorgaben orientiert und fest verankert ist. Schon von der Geburt an werden Mädchen und Jungen, sobald ihr Geschlecht bekannt ist, unterschiedliche Attribute zugeschrieben. Bei einer Umfrage sollten Eltern 24 Stunden nach der Geburt ihres Kindes sie nach bestimmten Kriterien einstufen. Obwohl die Babys gleich groß und schwer waren, wurden die Töchter typisch weiblich als schön, zart, hübsch bezeichnet, die Söhne dagegen als stramm, stark, kräftig. In einer weiteren Untersuchung wurden blau gekleidete Säuglinge als lebhaft, stark und aktiv beschrieben, wenn dieselben Babys rosa gekleidet waren, galten sie als süß und niedlich.[92]
Die Zuschreibung von geschlechtstypischen Eigenschaften und Verhaltensweisen sind anscheinend tief in uns verankert und dienen zur Orientierung und Kategorisierung. Da die Erzieherpersonen, seien es die engsten Bezugspersonen, oder andere, welche auf die Sozialisation eines Kindes einwirken, selbst eine geschlechtstypische Erziehung erfahren haben, wird dies meist unbewusst weitergegeben.
Dieses Erzieherverhalten zieht sich durch die gesamte Sozialisation. Schon bei den Spielsachen „(...) werden sehr früh Weichen gestellt, wofür sich Mädchen und Buben zu interessieren haben und wozu sie angeblich fähig sind.“ (Posch, S. 85).
Die typischen Jungenspiele sind demnach auf Abenteuer und technisches know-how konzipiert, die Mädchenspiele sind meist einfacher und beziehen sich häufig auf „Äußerlichkeiten“ wie etwas schön, hübsch oder nett zu gestalten. Ein direkter Erfolg ist hier meistens nicht ersichtlich, ob die Handlung bei Mädchenspielsachen gelungen ist, ist meistens Ansichtssache und muss erfragt oder bestätigt werden, ist also abhängig von der Anerkennung anderer Menschen.[93]
Weiter werden Mädchen eher in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrängt, indem sie behüteter und vorsichtiger behandelt werden als Jungs. Wenn sie sich dann auch so verhalten, gilt dies nicht als Unselbstständigkeit, sondern als brav. Eine Unselbstständigkeit und ein Hilfebedürfnis bei Jungs dagegen wird als mädchenhaft deklariert und weniger geduldet. Nach Bardwick und Douvan erleben die Jungs demnach eine Art „positiven Stress“, der dazu führt, dass sie die Abhängigkeit von „äußerer“ Zustimmungen weitgehend aufgeben und so unabhängige Kriterien entwickeln, welche zu einer positiven Selbsteinstellung führen. Für die Entwicklung von gesundem Selbstvertrauen ist eine erfahrende Unabhängigkeit von entscheidender Bedeutung, die Mädchen aber weniger erfahren als die Jungs.[94]
Dieses mangelnde Selbstvertrauen wird im Schulalter weiter gefördert, indem Eltern die guten Noten der Söhne meist mit deren Talenten in Verbindung bringen, die Töchter dagegen sie mit Fleiß erreicht haben. Nach der Wissenschaftlerin Anita Heiliger vom Deutschen Jugendinstitut fördern auch gute Leistungen nicht das Selbstvertrauen der Mädchen, weil sie die Einstellung verinnerlicht haben, dass „(...) sie nur gut sind, wenn sie brav und fleißig waren, nicht weil sie intelligent sind. Ihre Leistungen werden negativ bewertet, die der Jungen positiv.“
(Nuber zit. nach Heiliger, S.68f)
Dieses geringe Selbstwertgefühl der Mädchen greift in alle Lebensbereiche ein. Ab dem zehnten. Lebensjahr, in den Anfängen der Adoleszenz, kommt der große Bruch. Die Mädchen haben nicht nur ein geringes Vertrauen in ihre Leistungen, sondern sind auch unzufrieden mit ihrem Äußeren.
Die körperlichen Veränderungen welche mit der Pubertät einhergehen, verunsichern zwar das Selbstbild beider Geschlechter und sind durch Scham, Angst und Unsicherheit gekennzeichnet. Während aber Jungs auf Stress eher aggressiv reagieren, erfahren Mädchen, dass sie den Erwartungen der Umwelt im Sinne einer „funktionalen Weiblichkeit“ immer mehr entsprechen müssen, um nicht als „unweiblich“ zu gelten.[95]
Durch gesellschaftlich auferlegte Schönheitsnormen, über die ihre Weiblichkeit definiert wird, wird der Körper zum Austragungsort dieses Konflikts und gleichzeitig zum „zentralen Ort des Selbsterlebens“. Die Identität, das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl hängt weniger von Fähigkeiten und Fertigkeiten ab, wie es bei den Jungs der Fall ist, sondern von der körperlichen Attraktivität. Durch die meist unerreichbaren Ideale sinkt dann das Selbstwertgefühl in der Adoleszenz weiter ab, während Jungen immer mehr Selbstbewusstsein dazugewinnen.[96]
Da kein Vertrauen in die persönlichen Fähigkeiten gelingt, versuchen junge Mädchen letztendlich ihren Körper zu kontrollieren, um so eine Art „Unabhängigkeit“ zu erreichen. Essstörungen und Diäten können daher die Folge sein.[97]
Laut Helfferich wird der Körper zum Kapital im Sinne eines Köders und seine Herrichtung zur Chance.[98]
Einerseits um Bestätigung beim anderen Geschlecht zu erlangen, Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl werden dadurch aufgewertet und hängen davon ab. Andererseits um Unsicherheiten bei persönlichen Fähigkeiten zu kompensieren.[99]
Nach ihrer Untersuchung wird das Kapital Körper besonders für junge Frauen mit geringerer Schulbildung und eingeschränkten beruflichen Perspektiven wichtig, weil: „Angesichts der wahrgenommenen Chancenstruktur scheint die Investition in den Körper vielversprechender als die in eine Ausbildung; Attraktivität ist identitätsstiftender als die Arbeitsplätze, die angeboten werden.“ (Helfferich. S. 129)
Trotzdem sind auch Mädchen mit besserer Ausbildung vor diesem Mechanismus nicht gewappnet, denn auch sie erfahren in der Puberät, dass „Weiblichkeit“ positiv bewertet wird im Zusammenhang mit Schönheit, Schlankheit und Erfolg beim anderen Geschlecht.[100]
Wenn es um die „Sozialisation des schönen Körpers“ geht, werden in der Literatur meist Mädchen mit ihren Körperproblemen genannt. Nach neusten Studien geraten aber auch die Jungs immer mehr in einen Strudel der schönen Körper. Auch wenn sie mehr Selbstsicherheit aufbauen können, werden auch sie vom gängigen Schönheitsideal beeinflusst. Sie wünschen sich größer und stärker zu sein und mehr Muskeln zu bekommen, einhergehend mit der verunsicherten Frage „ob sie das machen müssen“.[101] Diese Frage deutet vielleicht darauf hin, dass die Schönheitsnorm noch nicht so internalisiert ist wie bei Mädchen und für ihr Selbstwertgefühl nicht zwingend notwendig ist.
In diesen gesamten Entwicklungsprozess wirkt aber noch ein weiterer Faktor, welcher die Bedeutung der schönen Körper bei Jugendlichen und Kindern verstärkt. Das Verhalten der Eltern stellt für Kinder immer eine Vorbildfunktion dar, dient besonders bei der Entwicklung der Geschlechtsrollen als Orientierungsmuster und kann so die Wahrnehmung des Körpers direkt beeinflussen. Aktive „geschlechtstypische“ Verhaltensweisen der Mutter, wie z.B. Schminken, Diäten halten, entsprechende Kleidung, welche mit Weiblichkeit assoziiert werden, bemerken schon kleine Kinder. Während Jungen sich damit nicht identifizieren können, weil sie eher den Vater als Vorbild sehen, lernen Mädchen diese Verhaltensweisen auf ihr Geschlecht zu beziehen.[102] Nach einer Untersuchung von essgestörten Mädchen im Alter von neun bis zwölf fand die Psychologien Judith Rodin heraus, dass deren Mütter ebenfalls schon langjährige Diätgeschichten hinter sich hatten, gleichzeitig waren diese Mütter mit dem Körpergewicht der Mädchen nicht zufrieden und wünschten sich eine schlankere Tochter, auch wenn diese schon schlank war. Die Psychologen Susan und Wayne Wolly erklären die Zunahme von Essstörungen von Jugendlichen, weil „(...) dies die Kinder der „Weight Wacht Generation“ sind – es ist die erste Generation, die von sehr gewichtsbewußten Müttern aufgezogen wurde.“ (Rodin, S. 22)[103]
Die Mütter dienen also nicht nur als Vorbild, sondern auch als Vermittlerinnen von Schönheitsnormen, indem sie Wünsche im Bezug auf das Äußere an die Tochter herantragen und ihnen gleichzeitig Techniken und Geheimnisse verraten und beibringen.[104] Freedman schreibt hierzu: „Die meisten Mütter (...) erfüllen ganz einfach ihren Sozialisationsauftrag. Sie spüren nur allzu deutlich, daß gutes Aussehen vielleicht das wichtigste Vermächtnis ist, dass sie ihren Töchtern mitgeben können. Attraktivität ist der Zauberstab der Mutter und das Glücksversprechen für das Leben der Tochter.“ (Freedman, S. 97)
7. Schönheit als soziale Macht
7.1. Was schön ist, ist auch gut?
Das Aussehen einer Person ist für uns häufig die erste Informationsquelle, einen Menschen zu beurteilen und ihn einzuordnen. Der menschliche Geist kann Oberflächliches und Substanzielles nicht leicht trennen. Dass dem Äußeren viel Wert beigemessen wird hat eigentlich einen nützlichen, evolutionsbedingten Grund. Das Äußere ist meist der erste und einzige Hinweis, gut und schlecht zu trennen. So machen uns braune Flecken oder Schimmel bei Nahrungsmitteln darauf aufmerksam, dass sie verdorben sind. Tiere mit großen Reißzähnen suggerieren uns, dass wir uns in Acht nehmen müssen.[105]
Eine enge Verbindung von Schönsein und Gutsein lässt sich schon im sprachlichen Bereich wieder finden.
So leitet sich das Wort „hübsch“ laut Herkunftswörterlexikon aus dem altfranzösischen „corteis“ ab, was soviel wie hofgemäß, fein, gebildet oder gesittet bedeutet. Im 12. Jahrhundert wurde dieser Begriff zunächst als „kurteis“ ins Mittelhochdeutsche übernommen. Über das mittelfränkische „hövesch“, „hüvesch“, kam er dann als „hüb(e)sch“ ins Mittelhochdeutsch zurück.
Im 16. Jahrhundert wandelte der Begriff hübsch (abgeleitet von Hof) seine ursprüngliche Bedeutung zu schön, angenehm, nett. Der Wandel von einer ursprünglichen Beschreibung des „gesitteten Verhaltens“ in eine Beschreibung der äußeren Erscheinung wird offensichtlich.[106]
Ebenfalls finden sich solche Verknüpfungen in zahlreichen anderen Sprachen wie z.B. im spanischen bonito = schön und bueno = gut, welche aus der gleichen lateinischen Wortfamilie stammen.
Sogar im hebräischen kann im Bezug auf die Schöpfungsgeschichte das Wort „tob“ als gut und schön übersetzt werden.
Übersetzungen wie „er sah, dass es gut war“ sind nach vielen Auslegern genauso zulässig, wie „er sah, dass es schön war“. Nach Haag u. a. soll damit nicht ausgedrückt werden, „(...) daß das Gute immer auch schön ist, sondern wohl eher, daß das Schöne gut ist oder doch sein sollte.“ (in Henss 1992, S. 90)[107]
Weitere Verbindungen von ästhetischen und moralischen Qualitäten lassen sich auch immer wieder in der Geschichte finden. So schrieb der Humanist Marsilio Fincino in der Zeit der Renaissance: „Wir können niemals die im inneren Wesen der Dinge verborgene Güte erkennen noch ersehnen, würden wir nicht durch äußere Anzeichen darauf hingeführt.” (zit. in Etcoff, S. 50)
Dass Hässlichkeit, Krankheit oder Missbildungen als Zeichen galten, die dem menschlichen Körper durch Gottes Zorn auferlegt wurden, wird auch bei Baldassare Castigliano im 16. Jahrhundert deutlich. So schrieb er: „Schönheit ist etwas Heiliges (...) nur selten wohnt eine böse Seele in einem schönen Körper, und so ist die äußere Schönheit ein wahres Zeichen innerer Güte (...) man kann sagen, dass das Gute und das Schöne in gewisser Weise identisch sind, vor allem im menschlichen Körper. Und die unmittelbare Ursache physischer Schönheit ist meiner Meinung nach die Schönheit der Seele.“ Weiter schrieb er: „Meistens sind die Hässlichen auch von Übel.“ (zit. in Etcoff, S.50).[108]
Weitere Kombinationen von äußerer Erscheinung und innerer Werte finden sich auch in nahezu allen literarischen Werken. Helden, Prinzen und Prinzessinnen sind meist schön und gütig zugleich. Hexen, Schurken und Bösewichte dagegen werden als klein, alt und hässlich dargestellt.
Der Psychologe Ronald Henss stellt zu diesen Belegen fest, dass eine Tendenz, ästhetische und moralische Urteile miteinander zu verknüpfen, wohl sehr tief in emotionalen und kognitiven Mechanismen des Menschen verankert ist und nicht allein auf die moderne und westliche Welt zurückgeführt werden kann. Die Medien als Haupt-Sündenbock verantwortlich zu machen ist nach ihm deshalb zu kurzsichtig. Eine Entwicklung, welche, wenn auch mit Schwierigkeiten verbunden, versucht das Aussehen von den inneren Werten abzugrenzen, sei eher in jüngerer Zeit zu beobachten.[109] Aber auch wenn uns heute eine Differenzierung von gut und schön bewusst ist, man physische Schönheit als Oberfläche sieht und demjenigen Schönheit zuspricht, der Schönes tut, ist das menschliche Verhalten trotzdem meist ambivalent und von unbewussten Vorgängen geleitet.[110] Ob und inwieweit Schönheit Vorteile bringt und ob schöne Menschen es leichter haben, möchte ich nun näher beleuchten.
7.2.Charakterbeurteilung aufgrund äußerer Merkmale
Versuche, den menschlichen Charakter über sein Äußeres zu definieren, gehen bis zu den alten Griechen zurück. Während einige immer wieder probiert haben mit Körpervermessungen auf den Charakter und Intelligenz zu schließen, haben andere, wie der Naturalist und Philosoph Giovanni Della Porta, (1540-1615, De humana phyiognoma) versucht, Gemeinsamkeiten zwischen dem Verhalten von Tieren und dem menschlichen Äußeren herzustellen. Sogar noch in jüngerer Zeit haben die Nationalsozialisten eine vermeintliche rassische und kulturelle Überlegenheit des Ariers über solche Analogien erklärt.[111] Das solche Annahmen Trugschlüsse sind, ist uns bewusst.
Trotzdem werden klare Kenntnisse über Persönlichkeit oder Charakter einer Person nur allmählich aufgrund ihres Verhaltens erworben.[112]
Das Aussehen stellt aber durch die unmittelbare visuelle Zugänglichkeit die erste Informationsquelle dar, welche wir über eine Person besitzen. Damit ist eine weitere Exploration erst mal unnötig.[113]
Die Attraktivitätsforschung setzt sich seit längerem mit der Erforschung eines Attraktivitätsstereotyps auseinander. Von einem Attraktivitätsstereotyp soll nach Henss dann die Rede sein, wenn Personen aufgrund der Attraktivität ihres Aussehens klassifiziert werden. Jedoch ist eine Annahme, dass eine solche Klassifikation bewusst erfolgt, falsch. Es handelt sich viel mehr um eine implizite Kategorisierung, welche über Effekte erschlossen werden kann.[114]
Ein Effekt, der im Zusammenhang mit der physischen Attraktivität und der Personenwahrnehmung bzw. Personenbeurteilung genannt werden kann, ist der Halo–Effekt (oder Hof–Effekt). Hierbei handelt es sich um ein Wahrnehmungsmechanismus bzw. Fehler. Durch subjektive und differenzierte Wertvorstellungen werden von Menschen ganz bestimmte Attribute bevorzugt. Wenn ausschließlich nur dieses einzelne Attribut zur Personenbewertung herangezogen wird, weil dies für den Beobachter eine dermaßen starke Gewichtung darstellt, können alle anderen Eigenschaften der beobachteten Person unwichtig werden. Hierbei handelt es sich dann um eine reduktionistische Beurteilung und somit um einen Halo–Effekt.
Die physische Attraktivität stellt ein Attribut dar, dass offenbar von vielen Menschen bevorzugt wird und somit sehr leicht einen Halo–Effekt erzeugen kann.
Zusätzlich ist noch anzumerken, dass dieser Effekt meist auftritt, wenn zu wenig Zeit ist oder wenn sich der Beurteiler nicht die nötige Zeit nimmt, die beobachtete Person differenziert zu betrachten.[115]
Weiter kann der Stereotypie–Fehler im Zusammenhang von Attraktivität und der Assoziation von positiven Eigenschaften erwähnt werden.
Aufgrund von Erfahrungen und Meinungen entwickeln Menschen eine Art Raster, das sich in Einstellungen und auch Vorurteilen widerspiegelt. Es werden also Stereotype entwickelt, welche die Personenwahrnehmung beeinflussen. Nach Wellhöfer beziehen sich diese Stereotypien auf konstitutionelle Besonderheiten wie z.B. Körperbau und Physiognomie, auf physiognomische Rahmenbedingungen wie Kleidung, Haarschnitt, Bart oder Brille, aber auch auf soziale und nationale Zugehörigkeiten. Einzelne Aspekte einer Person genügen dann, um auf ein bestimmtes Verhalten oder bestimmte Persönlichkeitseigenschaften zu schließen. In unserem Zusammenhang könnte z.B. besonders gutes Aussehen verbunden mit gepflegter Kleidung auf Erfolg im Beruf schließen lassen. Eine Person, die dick ist, könnte als träge, faul und willensschwach gehalten werde, vielleicht aber auch als gutmütig und warmherzig.[116]
Um den Einfluss der physischen Attraktivität auf zugeschriebenen Persönlichkeitsmerkmalen aufzudecken, gibt es zahlreiche Experimente und Untersuchungen. Sie im einzelnen zu beschreiben, wäre zu umfangreich (nachzulesen bei Henss 1992, S. 59 – 91). Deshalb werden im folgenden nur die Ergebnisse dargestellt.
Nach Untersuchungen von Miller (1970) werden attraktive Personen für aktiver, glücklicher, selbstsicherer und liebenswürdiger gehalten als Unattraktive. Ebenfalls ergaben sich bei dieser Studie geschlechtstypische Attributionen. Frauen werden demnach für kooperativer gehalten als Männer, aber unattraktive Frauen werden insgesamt schlechter beurteilt als unattraktive Männer.
Dermer und Thiel (1975) führten ihre Untersuchung nur bei Frauen durch, um auch zu prüfen, ob sehr attraktive Frauen bei anderen, evtl. eher unattraktiven Frauen, Neid wecken.
Attraktiven Frauen wurden in höherem Maße sozial erwünschte Persönlichkeitsmerkmale zugeschrieben. Sie wurden demnach als bessere Ehepartnerinnen eingestuft, von ihnen wurde angenommen, dass sie einen Mann mit höherem Berufsstatus heiraten und im privaten und beruflichen Leben wurde von ihnen mehr Erfolg erwartet als bei Unattraktiven.
Aber schöne Frauen wurden auch als eingebildeter und egoistischer gehalten als unattraktive und ihnen wurde eine stärkere bourgeoise Orientierung unterstellt.
Trotzdem lag bei dieser Studie die mittlere Bewertung der Unattraktiven immer noch auf allen Skalen im positiven Bereich.
In einer weiteren Studie (Feingold, 1992) wurden attraktive Menschen eher als intelligent, sozial kompetenter, anpassungsfähiger, dominanter und psychisch gesünder eingeschätzt als Unattraktivere. Besonders hoch bewertet wurden die Kategorien „sexuelle Aufgeschlossenheit“ und „soziale Geschicklichkeit“.
Nur bei einer Kategorie schnitten die unattraktiven Personen besser ab als die Attraktiven. Sie wurden als bescheidener eingestuft.[117]
Die betrachteten Studien zeigen auf, dass attraktive Personen überwiegend positiver eingeschätzt werden als Unattraktive. Allerdings beziehen sich die Forschungen nur auf den ersten Eindruck einer Person, und zwar nur visuell. Die Probanden haben also die zu beurteilenden Personen nicht kennen gelernt, sondern nur aufgrund von Bildern bzw. Fotos bewertet. Nun stellt sich die Frage, inwieweit das Verhalten von Personen beeinflusst wird, wenn sie mit einer attraktiven bzw. unattraktiven Person in Kontakt treten.
7.3. Physische Attraktivität und das Verhalten anderer
Wie folgend dargestellt, übt die physische Attraktivität nicht nur Einfluss auf die Bewertung einer Person aus, sondern zeigt sich auch im Verhalten anderer.
Dieses Phänomen lässt sich schon bei Reaktionen und Verhalten gegenüber Kleinkindern beobachten. Psychologen fanden heraus, dass Mütter mit hübschen Babys sehr viel Zeit damit verbringen, ihre Kinder im Arm zu halten, ihnen in die Augen schauen und stimmlich mit ihnen kommunizieren. Ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken schien ebenfalls sehr schwierig. Die Mütter mit weniger attraktiven Babys waren dagegen mehr damit beschäftigt, sich um die Bedürfnisse ihrer Schützlinge zu kümmern (Sauberkeit überprüfen, Bäuerchen machen usw.). Ebenfalls ließen sich diese Mütter leichter ablenken.
Weiter wird schlechtes Benehmen hübschen Kindern eher verziehen als weniger Hübschen.
Die Unattraktiveren werden sogar strenger bestraft. Studien in Kalifornien und Massachusetts stellten sogar fest, dass viele Kinder, welche unter gerichtlichem Schutz bezüglich (elterlichen) Missbrauchs standen, unattraktiv waren.[118]
Im Vorschulalter sind hübsche Kinder bei ihren Spielkameraden beliebter und sie werden für selbstständiger, furchtloser und unabhängiger gehalten. Ablehnungen finden sich dagegen häufiger gegenüber molligen Spielkameraden.
Nach Untersuchungen von Niketta sind attraktive Personen auch bei Beurteilungssituationen im Vorteil. Beispielsweise wurden erfahrenen Lehrern zwei Aufsätze, einer von einem hübscheren, der andere von einem weniger hübschen Kind, zur Beurteilung vorgelegt. Obwohl der Aufsatz des hübschen Kindes objektiv gesehen schlecht war, wurde er als „wesentlich gelungen“ bewertet.[119]
Ein ähnliches Experiment wurde im Rahmen eines Bewerbungsgespräches durchgeführt. Einem Proband wurde glaubend gemacht, dass ein zu bewertender Text von einer attraktiven Person verfasst worden sein. Dieser Text wurde besser eingeschätzt als der selbe Text, der bei einer Kontrolluntersuchung angeblich von einer unattraktiven Person verfasst wurde.
Ebenfalls ist beobachtet worden, dass schönen Menschen bei Gesetzesübertretungen mildere Urteile ausgesprochen werden oder sie sogar ungestraft bleiben. Auch das Anzeigeverhalten mindert sich bei höherer Attraktivität. In einer simulierten Gerichtsverhandlung wurde beobachtet, dass unattraktiven Personen eine größere Schuldhaftigkeit und Verantwortung zugeschrieben wurde. Ihnen wurde auch eher eine Beteiligung an schweren Delikten zugetraut, als den attraktiven Tatverdächtigen. Bei sexueller Belästigung wurde dem Angeklagten am häufigsten Schuld zugesprochen, wenn er selbst unattraktiv war, dass Opfer aber attraktiv.
Allerdings werden schöne Menschen bei Betrugsdelikten eher und auch härter bestraft wenn sie ihre Attraktivität als Mittel einsetzten.[120]
Auch wurde die einwirkende Bedeutung der Attraktivität reduziert, wenn die Probanden auf einen möglichen Einfluss der Schönheit aufmerksam gemacht wurden oder wenn viele andere Informationen über die zu verurteilende Person verfügbar waren. Somit reduzierte sich auch der Halo-Effekt.[121]
Das Verhalten gegenüber schönen Menschen zeigt sich auch in einer erhöhten Hilfsbereitschaft. In einem Experiment wurde eine vergessene Münze in einer besetzten Telefonzelle simuliert. Eine attraktive und eine unattraktive Frau gingen auf die Zelle zu und machten auf die vergessene Münze aufmerksam. Der attraktiven Testperson gaben 87% ihre Münze zurück, der unattraktiveren nur 64%.
In einem weiteren Versuch wurde eine Reifenpanne vorgetäuscht. Der hübscheren Testperson wurde zuerst geholfen.
Zusätzlich zeigt sich, dass Menschen eher bereit sind einer attraktiven Person zu helfen, selbst wenn sie ihnen unsympathisch ist. Bei einem Arbeitsverhältnis wurden Männer von Frauen gefragt, ob sie bereit wären, mehr Zeit zu opfern. Auch wenn die Männer vorher angegeben hatten die attraktive Frau eher weniger zu mögen, waren sie eher bereit, ihr zu helfen.[122]
Beobachtet wurde auch, dass attraktive Personen bei gegengeschlechtlichen Partnern leichter eine Meinungsänderung erzeugen können. Männer erwiesen sich hierbei als leichter beeinflussbar wie Frauen.
Für die sozialpädagogische Arbeit ist besonders erwähnenswert, dass auch bei Therapeuten-Klienten Verhältnissen die Attraktivität eine Rolle spielt. So werden attraktive Klienten von ihren Therapeuten positiver beurteilt als Unattraktive und umgekehrt.[123]
Hierbei ist es außerordentlich wichtig, sich der Rolle der Attraktivität bewusst zu werden und mögliche Gegenmaßnahmen zu treffen.
Zunächst stellt sich die Frage, welchen Einfluss die doch überwiegend bevorzugte Behandlung von attraktiven Personen sich in deren Persönlichkeitsentwicklung, im Selbstbild und in den Aspekten deren sozialen und privaten Lebens niederschlägt.
7.4. Schönheit und soziale Realität
Bisher wurde dargestellt, dass schöne Menschen in überwiegend positiver Weise von ihren Mitmenschen wahrgenommen werden. Ihnen werden eher sozial erwünschte Eigenschaften zugeschrieben als unattraktiven Personen. Dementsprechend wird auch das Verhalten gegenüber attraktiven Personen in positiver Weise beeinflusst.
Anzunehmen ist nun, dass bei einer eintretenden Interaktion bestimmte Erwartungen an eine Person ihre eigenen Realität erzeugen.
Gewisse Erwartungen gegenüber einer Person können sich also selbst erfüllen. Dieser Erwartungseffekt ist als „ self fulfilling prophecy “ oder „sich selbst erfüllende Prophezeiung“ schon aus anderen Forschungsgebieten der Psychologie bekannt.[124]
Merton (1968) erklärte die „sich selbst erfüllende Prophezeiung“ als soziale Definition einer Situation, welche Rückwirkungen auf die soziale Interaktion einer Situation zur Folge hat.
Differenziert betrachtet bedeutet dies folgendes:
Ein Beobachter bildet also bestimmte Erwartungen über das Verhalten der Zielperson. Wenn eine Interaktion stattfindet, verhält sich der Beobachter entsprechend seiner Erwartungen gegenüber der Zielperson. Die Erwartungen werden also in der sozialen Realität wirksam. Der Beobachter sieht so meist seine Interpretation als bestätigt. Die Zielperson erschließt bezüglich der Selbstwahrnehmung ein Selbstkonzept, dass sich der angenommenen Erwartung des Beobachters annähert. Letztendlich verhält sich die Zielperson so, wie die Anderen sie sehen.[125]
Um diesen Erwartungseffekt auf die Bedeutung der Attraktivität einer Person zu transformieren, ist folgender Versuch von Synder, Tanke und Berscheid (1977) sehr aufschlussreich.
Die Psychologen ließen Männer und Frauen, welche sich nicht kannten, ein zehn-minütiges Telefongespräch führen, in welchem sie glaubten, es handle sich um den „Prozess des Kennenlernens“.
Jeder der Männer hatte vorher ein Foto seiner angeblichen Gesprächspartnerin erhalten, das aber nicht mit dem Aussehen der wirklichen Gesprächspartnerin übereinstimmte. Auf den Fotos war entweder eine unattraktive oder eine attraktive Frau abgebildet. Durch die unterschiedlichen Fotos sollten die Erwartungen der Männer bezüglich der Gesprächspartnerin manipuliert werden.
Kurz vor Beginn des Gesprächs sollten die Männer bezüglich der Fotos einen ersten Eindruck über die Gesprächspartnerin abgeben.
Die Männer, welche dachten, sie werden es mit einer attraktiven Gesprächspartnerin telefonieren, hielten erwartungsgemäß die Frau für geselliger, ausgeglichener, humorvoller, sozial geschickter als diejenigen Männer, die dachten, ihre zukünftige Gesprächspartnerin wäre eher unattraktiv.
Nach anschließendem Telefongespräch wurde das Verhalten der Gesprächspartner durch neutrale Beurteiler anhand einer Tonbandaufnahme ausgewertet.
Unabhängig von ihrem Äußeren wurden diejenigen Frauen, die von ihren Gesprächspartnern als attraktiv gehalten wurden auch von den Beurteilern als selbstbewusster, gewandter, lebhafter, freundlicher, gesprächiger und sympathischer bewertet als diejenigen, die von den Männern als unattraktiv gehalten wurden.
Die Erwartungen der Männer zeigte sich also beim Telefongespräch in deren Verhalten. Sie zeigten mehr Einsatz, waren selbst mutiger und unterhaltsamer, wenn sie dachten, ihre Gesprächspartnerin sei attraktiv. Dieses Verhalten wurde auf die Frauen projiziert, die sich bezüglich des Verhaltens der Männer, egal ob sie in Wirklichkeit attraktiv oder unattraktiv waren, entsprechend verhielten.[126]
Dieses Experiment zeigt deutlich, dass die Erwartungshaltung anderer Menschen das Verhalten attraktiver und auch unattraktiver Menschen beeinflussen.
Dieses Phänomen kann schon von frühester Kindheit an als Einflussfaktor wirksam werden. Hübsche Kinder, die auch im zunehmenden Alter immer noch als attraktiv und schön gelten, erleben meist eine andere Sozialisation als Unattraktivere. Die erfahrene, meist bevorzugte Behandlung und positive Bewertung, welche gleichzeitig einen motivationalen Charakter aufweist, kann in das Selbstkonzept übernommen werden und so Wirksamkeit in der sozialen Realität erlangen.
Durch dieses Verhalten der sozialen Umwelt, welches schönen Menschen einen besonderen Status einräumt, ist es einleuchtend, dass es attraktiven Menschen leichter fällt, ein gesundes Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen aufzubauen, das sich dann in deren Auftreten widerspiegelt, auch wenn sie sich ursprünglich in ihren Persönlichkeitsmerkmalen und Fähigkeiten nicht von anderen unterscheiden.[127]
7.5. Zwischenmenschliche Beziehungen
Das Schönheit ein Status ist, welcher im Bereich der zwischenmenschlichen Anziehung eine große Rolle spielt, konnte schon im vierten Kapitel betrachtet werden. Natürlich sind letztendlich die „inneren Werte“ ausschlaggebend, ob eine Beziehung funktioniert oder nicht. Wenn es aber um die erste Begegnung oder die Ausschau nach einem Partner geht, spielen zuerst diejenigen Faktoren eine Rolle, die mit einem guten Aussehen assoziiert werden. Dies liegt häufig auch daran, dass schöne Menschen als sexuell aufgeschlossener, aufregender, erfahrener und abenteuerlustiger gehalten werden. Wie am Beispiel des Telefongesprächs dargestellt, handelt es sich auch hier um Erwartungseffekte, die ihre eigene Realität erzeugen.[128]
Um diesen Status der Attraktivität in der Partnerwahl darzustellen, möchte ich noch folgendes Experiment skizzieren:
Männern wurden Fotos von unterschiedlich attraktiven Frauen vorgelegt. Sie sollten sich eine Frau auswählen, mit der sie gern ausgehen würden. Der Versuchsleiter sicherte ihnen vorher zu, dass jede dieser Frauen bereit wäre sich mit ihnen zu treffen. Die Probanden konnten sich also sicher sein, dass sie nicht von den Frauen zurückgewiesen werden und wählten deshalb die attraktivste Dame aus.
Wenn der Versuchsleiter den Männern allerdings keine sichere Zusage der Frauen erteilte, wurden die Männer bei ihrer Wahl vorsichtiger. Sie wählten eher eine Frau, die etwa ein ähnliches Attraktivitätsniveau aufwies wie sie selbst.
Bei keiner möglichen Zurückweisung zeigten die Männer also ein idealistisches Wahlverhalten und entschieden sich so für ihren Wunschpartner, bei einer Wahrscheinlichkeit der Zurückweisung wurde die Wahl nochmals überprüft und daher eher eine realistische Zielsetzung verfolgt.[129]
Hierzu lässt sich festhalten, dass wenn es um einen Wunsch- bzw. Traumpartner geht, die Attraktivität eine sehr hohe Bedeutung hat, was die Studie von Kluge belegt. So wünschen sich 83% aller Deutschen einen hübschen Partner, und 72% legen Wert darauf, dass der Partner schlank ist.
Besonders hohe Wertungen geben hierbei die 14–29 jährigen ab.[130]
Allerdings finden sich bei festen Beziehungen eher Paare, die eine ähnliches Attraktivitätsniveau aufweisen. Nach einer Längsschnittstudie ist eine Beziehung mit einem ähnlich attraktiven Partner sogar glücklicher und langlebiger. Auch werden geliebte und ähnliche Personen attraktiver eingeschätzt als sie eigentlich sind.[131]
Weitere Studien belegen, dass die Rolle der Attraktivität bei zwischenmenschlichen Beziehungen Geschlechtsunterschiede aufweist. Männer ließen sich beispielsweise bei einer Untersuchung von Reis und Wheeler u.a. (1982), welche über mehrere Tage dauerte und sich auf Alltagssituationen bezog, von der Schönheit einer Frau stärker beeinflussen als umgekehrt. Sieverding (1993) belegt sogar, dass dieses Phänomen in unterschiedlichsten Kulturen zu finden ist und seit Jahrzehnten konstant bleibt.
Attraktive Männer nahmen bei diesem Experiment viel mehr Kontakt zu Frauen auf, als unattraktivere Männer und waren auch im Umgang mit dem anderen Geschlecht offensiver.
Im Gegensatz dazu zeigt sich bei attraktiven Frauen kein Einfluss der eigenen Attraktivität auf vermehrten Kontakt zu Männern. Eher bei den Unattraktiveren konnte ein offensiver Umgang mit Männern festgestellt werden. Die attraktiveren Frauen traten den Männern sogar eher mit Misstrauen gegenüber als die weniger attraktiven Frauen. Vielleicht deshalb, weil sie vermuteten, vor allem wegen ihrem Äußeren das Interesse der männlichen Interaktionspartner zu wecken.
Bierhoff und Grau (1993) berichteten ähnliche Ergebnisse, wobei bei diesem Experiment nur die ersten Minuten des Kennenlernens untersucht wurden. Zusätzlich ließ sich hier feststellen, dass sich die Attraktivität eines Interaktionspartners förderlich auf die Intensität und Länge des Gesprächs auswirkte. Ebenfalls wurde dies bei der Häufigkeit des Blickkontakts und der Dauer des gegenseitigen Anlächelns beobachtet.[132]
Die Schönheit, die man als erste Informationsquelle erkennt, kann aber bei zwischenmenschlichen Beziehungen auch Nachteile bringen. Beispielsweise sind Männer an einer platonischen Freundschaft mit einer attraktiven Frau weniger interessiert. Eine schöne Frau hat zwar keine Probleme auf Männer eine Anziehung auszuüben, aber sie wird auch dann „angemacht“ wenn es gar nicht gefragt ist. Weil schöne Menschen eher als arrogant, eingebildet, egoistisch und oberflächlich eingestuft werden, kann es auch für sie schwieriger sein, Freunde zu finden. Besonders Gleichgeschlechtliche empfinden die Freundschaft mit einem sehr attraktiven Menschen als bedrohlich. Ebenfalls verliert auch hier die Macht des ersten Eindrucks von Bedeutung, wenn über die jeweiligen Personen mehr Informationen zugrunde liegen.[133]
7.6. Berufseignungskriterium Schönheit?
Dass schöne Menschen schon beim Bewerbungssituationen bevorzugt behandelt werden, wurde bereits dargestellt. Tatsächlich ist es auch so, dass 57% der Deutschen für ihr berufliches Umfeld schön sein wollen. Besonders für Personen in gehobenen Positionen oder mit höheren Bildungsabschlüssen, Personen zwischen 20 und 49 und Untergewichtigen scheint dies sehr wichtig zu sein.
Sehr auffällig ist, dass vermehrt Frauen für ihr berufliches Umfeld attraktiv aussehen wollen.
Besonders weit gehen die Werte hier bei den 14–19jährigen auseinander. Hier wollen 70% der Mädchen für das berufliche Umfeld schön sein, aber nur 40% der Jungen.[134]
Tatsache ist, dass es Berufe gibt, in denen gutes Aussehen als Voraussetzung gilt, wie z.B. bei einem Fotomodel, Kosmetiker(innen) oder vielleicht bei Verkäufer(innen) in bestimmten Branchen. Hier gelten die attraktiven Personen als Repräsentanten für ein Produkt. Dem Käufer soll so suggeriert werden „wenn ihr so aussehen wollt wie wir, dann kauft das Produkt, dass ich benütze“. Das Äußere gehört hier zu den Eigenschaften oder Fähigkeiten, die für solche Berufe oder zumindest für die Wirtschaftlichkeit vielleicht notwendig sind.
Für andere Berufe sollte aber das Äußere weitgehend nebensächlich sein. Trotzdem ist es so, dass die meisten Personalchefs sich bei ähnlicher Fähigkeiten der Bewerber für den Attraktiveren entscheiden.
Bei Männern wird eine „nötige Berufsattraktivität“ häufig mit der Körpergröße in Verbindung gebracht. Untersuchungen ergaben, dass große Männer bevorzugt eingestellt werden, meist mehr verdienen und Berufe haben, welche mit mehr Prestige verbunden sind.
Interessant ist auch, dass erfolgreiche Männer größer eingeschätzt werden als sie eigentlich sind. So wurde bei einem Experiment ein Mann ca. 13 cm größer eingeschätzt, wenn er mit einem akademischen Grad in Verbindung gebracht werden konnte. Auch bei der Körperfülle werden bevorzugt schlanke Männer eingestellt. Ein größerer Zusammenhang lässt sich jedoch bei der Körpergröße festmachen.
Frauen mit Körperfülle haben es im Berufsleben eindeutig schwerer. Insbesondere in Berufen, welche durch häufigen Personenkontakt gekennzeichnet sind, haben dickere Frauen geringere Einstellungschancen. In den USA werden dickere Mädchen sogar seltener zum College zugelassen als ihre schlanken Kolleginnen. Nach einer Studie der Columbia University Business School ist Attraktivität bei Frauen von entscheidendem Vorteil, wenn es sich um einen Arbeitsplatz im Angestelltenverhältnis handelt. Auch ist das Gehalt bei attraktiven Frauen manchmal höher. Wenn es allerdings um die Bewerbung bei leitenden Positionen geht, gilt dieser Vorteil meist nur noch für Männer. Attraktiven Frauen wird dann häufig unterstellt, dass sie ihre bisherige Karriere hauptsächlich ihrem Aussehen zu verdanken haben.[135]
Spätere Studien zeigten jedoch, dass weibliche Schönheiten in gehobenen Positionen eher eingestellt werden, aber nur, wenn ihre visuelle Erscheinung gefragt ist und Geschick im zwischenmenschlichen Umgang erforderlich ist.
Wenn dagegen effektives Arbeiten unter Druck, rasche Entscheidungen und die Motivierung anderer verlangt wird, ist gutes Aussehen lange kein Vorteil mehr.
Ebenfalls ist die Gefahr größer, dass schöne Frauen im Berufsleben eher mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz konfrontiert werden. Gleichzeitig birgt Schönheit am Arbeitsplatz vielleicht die Gefahr, von beneidenden Kolleginnen gemobbt zu werden.[136]
Jüngere Umfragen der Zeitschrift Brigitte belegen, dass 67% der Frauen die Meinung vertreten, gutes Aussehen bringe mehr Chancen im Beruf. Dies sind immerhin 25% mehr als 1978. Mit steigendem Alter nimmt dieser Standpunkt sogar zu. Anzunehmen ist, dass die Frauen hier wohl auf persönliche Erfahrungswerte und Erlebnisse zurückgreifen, welche ihnen den positiven Einfluss eines attraktiven Äußeren demonstrierten. Trotzdem sagen nur 1% der Frauen, dass ihr Beruf von ihnen verlangt, sich schön zu machen. Jedoch 72% der berufstätigen Frauen geben an, dass ihr Beruf sie zwingt, sich zu pflegen. Wobei die Frage ist, was „Pflege“ für die jeweiligen Frauen bedeutet. Immerhin ist für über 40% schminken so selbstverständlich wie Zähneputzen.[137]
Schöne Menschen haben es in einem gewissen Rahmen also auch im Berufsleben leichter. Vor allem Frauen betrachten Schönheit weitgehend als Rezept für beruflichen Erfolg, obwohl sich bei ihnen Attraktivität bezüglich des beruflichen Erfolgs eher nachteilig auswirken kann als bei Männern. Trotzdem haben sie es immer noch leichter als unattraktivere Frauen, die „(...) erst recht wirtschaftlich benachteiligt (werden) – für sie ist schon die Wahrscheinlichkeit, angestellt und leistungsgerecht bezahlt zu werden, geringer.“ (Etcoff, S. 98)
Bisher wurde betrachtet, dass Schönheit eine Reihe von Vorteilen bringt. Die Nachteile verschwinden dabei hinter dem Glanz der Fassade. Vielleicht weil die „negative Seite“ der Schönheit von vielen Menschen gar nicht als Nachteil wahrgenommen wird.
Schöne Menschen werden besser beurteilt, haben mehr Erfolg beim anderen Geschlecht, erfahren mehr Anerkennung und bekommen besser bezahlte Berufe. Dies sind Faktoren, die in unserer Gesellschaft mit Macht und Prestige verbunden sind und somit als nachzueifernde Werte gelten. Es ist also kein Wunder, warum die meisten Menschen alles erdenkliche tun, um gut auszusehen.
8. Schönheitskult – der machbare Körper
8.1. Schlankheitswahn und Muskelmasse
Schlankheit ist zum Synonym für Schönheit und Gesundheit geworden. In unserer Gesellschaft wird ein schlanker, trainierter Körper mit positiven Eigenschaften wie attraktiv, dynamisch, erfolgreich und leistungsfähig assoziiert. Mit Werten also, die in unserer Konsum– und Leistungsgesellschaft als erstrebenswert gelten. Menschen, die dicker sind als der Durchschnitt, werden gesellschaftlich weniger akzeptiert, haben weniger Vorteile und werden medizinisch als „krank“ bezeichnet. Fett wird gleichgesetzt mit hässlich, ungesund, und undiszipliniert.
Dieses Bild eines extrem schlanken Frauenkörpers und eines durchtrainierten Männerkörpers verbunden mit Erfolg, sei es im beruflichen oder im privaten Bereich, halten uns die Medien, die Werbung und die Mode täglich vor Augen.[138]
Frauen lassen sich vom Leitbild eines schlanken Ideals jedoch mehr beeinflussen als Männer. Dies lässt sich schon bei Mädchen zwischen 13–14 Jahren feststellen. Demnach wollen 56% gegenüber 37% der Jungs lieber etwas dünner sein.[139]
Bei einem Blick in die Mode(l)branche zeigt sich ein Ideal der zierlichen und schmalen Gestalt. Körperrundungen (außer der Brust) sind out. Der typisch weibliche Körper verschwindet. „In“ ist eine weitgehend androgyne Körperform mit schmalen Hüften, festen und straffen Schenkeln, schmaler Taille und knackigem Po. Dem weiblichen, eigentlich natürlichem Fettgewebe wird als Krankheit „Cellulitis“ der Kampf angesagt. Das einzige Körperteil, das weibliches Fettgewebe enthalten darf, ist die Brust, trotzdem soll sie fest sein.[140]
Die Mode ist demnach ähnlich konzipiert. Nach dem Motto „weniger ist mehr“ zeigt die Werbung Frauen mit wenig, engem oder durchsichtigem Stoff, der eine Verhüllung nicht mehr zulässt. Zwar gilt heute „erlaubt ist was gefällt“, doch nach Drolshagen betrifft dies nur die Kleidung. „Das heutige Modediktat betrifft (allerdings) den Körper.“ (Drolshagen, S. 116)
Die schlanken, erfolgreichen Menschen, die Musikstars, die Models und Schauspieler, welche durch die Medien und Werbung als solches Diktat präsentiert werden, suggerieren täglich eine Verknüpfung von Schlankheit, Erfolg und Glück.
Nach Wolfrum/Papenfuss entsprechen nur 15% der Frauen dem gängigen Schönheits– bzw. Schlankheitsideal. Allerdings ist diese Angabe von 1992, heute dürften es, nach dem das Schönheitsideal noch schlanker geworden ist, noch weniger sein. Unklar ist auch, ob und inwieweit diese 15% schon an „sich gearbeitet“ haben um diesem Ideal zu entsprechen. Immerhin ist nahezu jede zweite Frau mit ihrem Gewicht unzufrieden und bereit dazu, ihre Figur zu ändern.[141]
„An sich arbeiten“ und „seine Figur zu ändern“ bedeutet demnach Gewichtsreduktion durch Diäten, Appetitzügler und Sport.
Die Informationen, wie dies am Besten gelingt, werden ebenfalls durch die Medien vermittelt. Eine besondere Rolle kommt hier den Frauenzeitschriften zu. Während superschlanke Models die gängige Mode präsentieren und so ein „zu dicker Körper“ bewusst vor Augen geführt wird, finden sich gleichzeitig Anzeigen für gewichtsreduzierende Mittel und Tipps für Diäten in diesen Zeitschriften.[142] Der Anzeigenteil für Diät– und Schlankheitstipps hat sich seit ca. 1990 um 70% erhöht und sich mittlerweile auch schon in Männerzeitschriften etabliert.[143] 1999 war in der Men`s Health ein Artikel über die „12 Geheimnisse schlanker Männer“ zu finden.
Nach einer Umfrage von Psychology today geben 84% der Frauen an, regelmäßig Diät zu halten,[144] 90% aller weiblichen Teenager aus Europa, USA und Australien wollen abnehmen.[145]
Die Reduzierung des Körpergewichts zur Erreichung des schlanken Ideals ist zum Kollektiv geworden. 1990 wurden in den alten Bundesländern 270 Millionen Mark für Abführmittel ausgegeben und 1987 wurde mit Appetitzüglern ein Umsatz von 70 Millionen Mark erzielt.[146] Nach Schätzungen des deutschen Diätverbandes wurden 1996 ca. 3,6 Milliarden Mark für Diätprodukte erwirtschaftet. In den USA wurden bereits 1990 für Diäten und damit verbundene Dienstleistungen Absatzzahlen von 33 Milliarden Dollar erreicht und von 1985 bis 1991 sind allein 666 Bücher zum Thema Schlankheit und Gewichtsabnahme auf den deutschen Markt gekommen.[147]
Alle möglichen Wirtschaftszweige wie Lebensmittel–, Sport–, Kosmetik–, Pharmaindustrie, aber auch Verlage, Schlankheitsinstitute, Ärzte, Ernährungsberater usw. profitieren davon und kurbeln gleichzeitig durch neue Methoden, Mittel und Tipps das kollektive Abnehmverhalten an.
In den letzten Jahren hat sich eine enorme Diskussion über die negativen Folgen von strengen Diäten, Laxantien und Appetitzüglern verbreitet. Fachleute warnen immer mehr vor gesundheitsgefährdenden Folgen oder falschen Versprechungen der Anbieter. Jedoch wurde dadurch der gesellschaftliche Schlankheitsfanatismus nicht eingedämmt. Lediglich hat eine Verschiebung bzw. Kaschierung des Problems statt gefunden. Indem heute nicht mehr Diät gehalten, sondern der Körper einer Entschlackungskur unterzogen wird und die Gewichtsabnahme als positiver Nebeneffekt erfolgt, werden diese Maßnahmen in unserer „gesundheitsbewussten“ Gesellschaft eher akzeptiert. Parallel dazu finden sich auf dem Markt zahlreiche Light–Produkte, Öko– und Wohlfühldiäten, welche den vermeintlichen gesundheitsfördernden Aspekt vermarkten.
Hinzu kommt die Sport- und Fitnesswelle, welche weitgehend an die Stelle des „Diäthaltens“ rückt oder damit verknüpft wird.
Nach einer Umfrage der Zeitschrift Stern betrachteten schon 1986 77% der deutschen Frauen Sport als gewichtsreduzierendes Mittel,[148] in einer anderen Umfrage geben von allen Sportreibenden 40% an, Sport als Mittel zur Gewichtsreduktion einzusetzen.[149] Neuere Umfragen belegen, dass vor allem die 16–29 jährigen Bundesbürger mit 42% es für wichtig halten, „dass man etwas für seinen Körper tut, damit man gut aussieht und fit bleibt. Wer nicht an sich arbeitet, um eine gute Figur zu haben und leistungsfähig zu bleiben, ist selbst schuld, wenn er z.B. berufliche Nachteile davon hat oder nicht so leicht einen Partner findet." 40% halten zwar den „Körperkult“ für übertrieben, aber 18% können sich bei ihrer Meinung nicht entscheiden.[150]
Hiervon sind nun auch die Männer mehr betroffen. Weil für sie ein muskulöser, fettfreier Körper mehr im Vordergrund steht, als nur schlank zu sein, werden sie zunehmend von werbenden Waschbrettbäuchen beeinflusst. Men`s Health und Co. haben dann auch für sie Anleitungen für “perfekte Muskeln”, „Wie man aus `nem Po einen Knackarsch und Frauen willenlos macht“ oder „Ab heute ein Siegertyp“, parat. (Men`s Health, Mai 1999 in Posch S. 199)
8.2. Jugendlichkeit
Wie bereits in 6.2 aufgezeigt, gehört Jugendlichkeit im technisch-industriellen Zeitalter zum erstrebenswerten Ziel.
So werden auch die Aspekte Gesundheit und Ästhetik in unserer Gesellschaft mit jugendlichem Aussehen assoziiert. Im reiferen Alter noch gut auszusehen, wird gelobt und als disziplinierte Lebensweise verstanden. Paradoxerweise gelten Persönlichkeit und Selbstverwirklichung als erstrebenswerte Ziele, die damit verbundenen Lebenserfahrungen sollten allerdings im Inneren verborgen bleiben.[151]
Chapkis schreibt hierzu: „In unserem Kulturkreis, der nicht imstande ist, den Tod zu akzeptieren, nimmt es nicht wunder, daß die Schönheit abseits von den Veränderungen des Lebens wahrgenommen wird.“ (Chapkis, S. 20)
Das gelebte Alter wird an der Hautoberfläche am deutlichsten sichtbar. Jugendlichkeit ist aber gekennzeichnet durch glatte, straffe, faltenfreie Haut mit wenig Körperhaaren.
Da selbst jugendliche Körper nicht mehr diese Kennzeichen aufweisen, weil durch die Veränderungen in der Pubertät das Bindegewebe beansprucht wird und Körperhaare gebildet werden, handelt es sich nach Freedman um „neotenische Züge“, d.h. die Ausdehnung des kindlichen Aussehens bis ins Erwachsenenalter.[152]
Um einen gesunden und ästhetischen Körper zu konservieren bzw. darauf hinzuarbeiten sind besonders zwei Dinge notwenig: disziplinierte Körperpflege und Kaufkraft. Wenn Umweltbelastungen und Sonneneinstrahlung massiv auf die Hautoberfläche einwirken oder der alltägliche Hautalterungsprozess einsetzt, braucht die Hornzelle Hilfe: „Ihr sollen jetzt „Mikro-Hydratoren“, diverse „High-Tech-Reparaturkonzentrate“ und „Aktivstoffe“ wieder auf die Beine helfen. „Konzentrierte Energiezufuhr“, so die verführerischen Versprechen der Schönheitsbranche, erhöhe die Zellaktivität, verstärke die Zellmembranen, rege die Zellerneuerung und den Zellstoffwechsel an, damit alles mikrozirkuliert.“ (Gosmann, S. 64)
Die neuesten Erfindungen für ein sichtbar glattes, ebenmäßiges Hautbild sind hautstraffende Lotionen mit Coenzym Q10 sowie Skin Refinisher oder Produkte mit der Aufschrift „Visibly Refined“, die alle versprechen, glättend, belebend und hautbildverfeinernd zu sein.
Damit steht nicht mehr im Vordergrund die Haut zu schützen oder zu pflegen. Hauptbestandteil der neuen Hautcrems sind (Frucht-) Säuren, mit der Funktion, die obere Schicht der Haut zu entfernen, um die neue, jüngere Hautschicht zum Vorschein zu bringen. Diese Produkte sind als komplette Pflegeserie auch für Männer erhältlich. Die Umsatzzahlen der Kosmetikindustrie belegen den Boom der Hautpflegeprodukte. Schon 1988 wurden in den USA bereits 3 Milliarden Dollar und in Großbritannien 337 Millionen Pfund umgesetzt.[153] Dabei handeln die Käufer meist nach der Devise: Je teuerer umso besser. Wolf schreibt hierzu: „Der hohe Preis des heiligen Öls befriedigt das Bedürfnis, Schuldgefühle durch Opfergaben zu besänftigen. Das mittelalterliche Geschäft mit Ablassbriefen erscheint heute als Geschäft mit den Salbungsmitteln wieder.“ (Wolf, S. 166)
Nach Umfragen der Zeitschrift Brigitte glauben nur 1% der Befragten, dass die Industrie im punkto Pflege „nur schöne Träume verkauft“, 95% halten Körperpflege bzw. Kosmetik für eine Basis des guten Aussehens. Nur 4% glauben, dass Wasser, Seife und genügend Schlaf ausreichend ist.[154]
Dass die Werbung hier aber falsche Träume verspricht, kann belegt werden. Laut einem Arzt der Karlsruher Hautklinik dürfen kosmetische Wirkstoffe gar nicht in tiefere Hautschichten, wo die Faltenbildung eigentlich entsteht, vordringen, weil sie sonst definitionsgemäß als Arzneimittel gelten.[155] Nach Öko-Test 1997 erhielten die meisten Anti-Falten-Cremes das Ergebnis „nicht empfehlenswert“. Als Empfehlung wurden herkömmliche Produkte mit natürlichen Zutaten und genügend Fett vorgeschlagen.[156]
Warum steigt der Kauf von verjüngenden Pflegeprodukten trotzdem stetig an? Nach Posch/Drolshagen liegt es an den seit Anfang der 90er präsentierten „ No-Age-Frauen “. Demnach werben die Medien mit ältern Frauen, die immer 15–20 Jahre jünger aussehen. Besonders wird die disziplinierte Lebensweise, welche durch Training, gesunde Ernährung und besonders geeigneter Kosmetik gekennzeichnet ist, hervorgehoben. Dass die Werbefotos aber zum Großteil retuschiert oder die Personen selbst geliftet sind, wird verschwiegen.[157]
Zuletzt ist noch anzumerken, dass Hautkosmetik, sei sie verjüngend oder „für bessere Hautstruktur“ nicht für die Frau/Mann ab 30 oder 40 beginnt. Nach Drolshagen suggeriert die Werbung, dass man mit dem Vorbeugen gegen das Altern nicht früh genug anfangen könne. So gibt es schon Kosmetikserien für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren. Jugendliche gehören damit schon zur Zielgruppe des Erwachsenenmarkts.[158]
8.3. Natürlich künstlich
Nach bisherigen Aufführungen liegt gutes Aussehen anscheinend in der eigenen Verantwortung. Bereits Helena Rubinstein meinte „(...) es gebe keine häßlichen Frauen, nur faule.“ (Drolshagen, S. 35)
Die Aussage einer Befragung einer Frauenzeitschrift „Wer nicht gut aussieht, kann dagegen nichts tun“ bestätigen 0%. Alle Befragten Frauen waren also der Meinung, das gutes Aussehen weitgehend machbar ist.
Sich zu pflegen und zurechtzumachen mit Schminke oder Styling sind bei der „machbaren Schönheit“ wichtige Voraussetzungen. Von den Befragten Frauen gefallen sich insgesamt nur 7% ohne Make–up besser. Bei den 14–19jährigen Teenagern sind es nur 5%, dabei schminken sich in dieser Altersklasse 25% ständig, dieser Prozentanteil nimmt mit steigendem Alter zu. Insgesamt benutzen 45% täglich dekorative Kosmetik, wobei Artikel wie Rouge, Lidschatten, Grundierung oder Wimperntusche nicht unter dekorativer Kosmetik, sondern extra aufgeführt sind. Trotzdem mögen sich die meisten Frauen bei der selben Umfrage am liebsten natürlich.[159]
Nach einer weiteren Umfragen von Piel geben 40% der deutschen Gesamtbevölkerung an, dass das Schönheitsideal der heutigen Frau „natürlich und ungekünstelt“ ist. Nur 20% halten das Bild von einer „kosmetisch stark zurechtgemachten“ Frau für „in“.[160]
Die Umfrageergebnisse wirken auf den ersten Blick paradox. Einerseits gilt Natürlichkeit als Ideal, andererseits schminkt sich der überwiegende Teil der Befragten. Die Antwort darauf ist der seit Mitte der 90er Jahre geltende „ natural look “. Hier geht es nicht mehr darum, sich auffällig zu schminken, sondern spontan und natürlich zu wirken. „Doch was natürlich aussieht, (…) darf gar nicht natürlich sein. Es muss eine bestimmte Art von Natürlichkeit sein, die keineswegs mit Naturwüchsigkeit verwechselt werden sollte.“ (ebd., S. 34) Es geht also nicht um naturbelassende Schönheit, sondern um: „Durchgestylt sein - aber so wirken, als sei alles dem Zufall überlassen.“ (ebd., S. 34)
Dem aktuellen Schönheitsideal zu entsprechen, bedeutet demnach mehr Planung, Disziplin, Zeit und Übung als je zuvor. Es geht wieder um den „machbaren“ und nicht um den natürlichen Körper, nur soll dies hinter dem Schein einer vermeintlich natürlichen Perfektion verborgen bleiben. Mit „Tricks“ wie kaschieren, betonen oder hervorheben werben zahlreiche Printmedien und zählen dadurch gleichzeitig die Mängel auf, die beseitigt werden müssen.[161]
Nach Posch/Drolshagen beinhaltet der Anspruch nach „Natürlichkeit“ eine Widerspruch in sich. Weil Verschönerung verlangt wird, aber nicht als solches erkannt werden darf und die Produkte dementsprechend nichts „abdecken“ sondern nur verschönern dürfen, „(...) muß (man) mehr am Ausgangsmaterial – d.h. Haut, Haaren, Muskeln, usw. - verändern.“ (ebd., S. 44)
Der Weg zur Schönheitschirurgie ist dann manchmal der letzte Weg um (künstlich) natürlich zu wirken, ohne dass gleich offensichtlich wird, dass etwas gemacht wurde.[162] Dass die neuen, besonders unsichtbaren Verschönerungsprodukte einen erheblichen Kostenfaktor darstellen, belegt die Aussage: „Je weniger ein Kosmetikartikel in Ihrem Gesicht auffällt, um so mehr haben Sie dafür hingeblättert.“ (ebd., S. 43) Dabei macht allein die Verpackung der Kosmetik 60% des Preises aus.[163] Allein in Deutschland wurde 1997 ein Umsatz von 16,4 Milliarden Mark mit Kosmetikprodukten erzielt, mit einer jährlichen Wachstumsrate von ca. 15%.[164]
8.4. Schönheitschirurgie
Der Nutzen der plastischen Chirurgie besteht grundsätzlich darin, eine körperliche Entstellung, welche durch Unfälle, Geburtsfehler, Verbrennungen oder Verletzungen entstanden ist, zu beheben, um damit verbundenen psychischen Beschwerden, Stigmatisierungen, Diskriminierungen oder sozialem Rückzugsverhalten, entgegenzuwirken.[165] Heute ist sie allerdings zu einem verlängerten Arm der Mode geworden und stellt somit den wohl verwerflichsten und erschreckendsten Faktor des Schönheitskults dar. Patienten der Schönheitschirurgie sind keine hässlichen oder unansehnlichen Menschen, sondern meist durchschnittlich aussehende, wenn nicht sogar hübsche. In den USA sind einschneidende Verschönerungstechniken nichts außergewöhnliches mehr und gehören zur Tagesordnung.[166] Zu der Zielgruppe zählen aber nicht ausschließlich Menschen, die durch Lifting oder Hautstraffungen den Alterungsprozess hinauszögern wollen. Häufig wünschen sich Teenager zum Highschool Abschluss eine Veränderung bzw. Erneuerung von Körperteilen. Der Trend, dass bereits 14-jährige sich Fett absaugen lassen, sich eine Brustvergrößerung wünschen oder die Nase korrigieren lassen, wird auch in Deutschland zur aufsteigenden Normalität. Derzeit werden bei uns schon 300 000 schönheitschirurgische Eingriffe pro Jahr vorgenommen (1992 waren es 100 000) mit einem Umsatzergebnis von 1,8 Milliarden Mark.[167]
Gleichzeitig haben auch Männer die Schönheitschirurgie für sich entdeckt. Bereits 1992 war jeder dritte Patient männlich. Die Palette reicht von Haartransplantationen über Hodenimplantationen bis hin zu Silikonschilden, welche einen muskulösen Oberkörper simulieren. Paradox ist, dass die Kunstmuskeln keinen heftigen Bewegungen ausgesetzt sein dürfen, da sie sonst verrutschen könnten. Körpertraining und Fitnessstudio sind somit tabu.[168]
Während jede Schönheitsoperation fatale Komplikationen und gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann, ist bei heranwachsenden Körpern das Risiko besonders groß, da Operationsnarben mitwachsen können und der Körper so nachhaltig entstellt wird.
Dr. Richard Hartmann vom Ministerium für Jugend, Kultur, Frauen und Familie betont besonders den Verlust von persönlicher und individueller Identität der Jugendlichen durch chirurgische Eingriffe.[169]
Tatsache ist, dass die vorhandenen individuellen Makel, die entfernt oder verändert werden sollen, objektiv gesehen meist nicht auffällig sind oder von anderen als hässlich wahrgenommen werden. Dieses Phänomen nennen Psychologen „eingebildete Hässlichkeit“. Nach Studien von Psychotherapeutin R. Ann Kearny-Cook sind besonders Menschen, die sich innerlich ablehnen und sich selbst nicht als liebenswert empfinden, davon betroffen. Dieses Gefühl wird auf Körperteile projiziert, welche dann als hässlich empfunden werden. Sozialer Rückzug und andere psychische Problem können die Folge sein. Über eine Korrektur eines äußeren Mangels wird so erhofft, diese Lebenskrise zu bewältigen, der Chirurg erscheint häufig als einzige Person, welche die (äußerlichen) Probleme nicht missversteht: „Vom Arzt erhoffen sie die Rettung ihres Selbst und, vor allem, über die Reparatur des Äußeren auch die Zufriedenheit und Ruhe für die geplagte Seele.“ (Scholz, S. 23) Die äußere Korrektur führt dann vielleicht oberflächlich zu einer Heilung. Letztendlich kann aber eine Leidensbefreiung und Heilung nur durch geeignete Therapie erfolgen, indem die Patienten lernen ein positives Selbstbild aufzubauen und sich realistisch akzeptieren.[170]
Die Psychologin Aniko Toth-Sagi des Institus für Jugendforschung in München sieht die Ursache für ein Verlangen nach dem, durch Schönheitschirurgie erreichbaren, perfekten Körper in der stetigen Präsenz von „perfekten“ Menschen in Werbung, Sport und Showgeschäft.[171]
Der „perfekte“ Körper wird so als Einrittskarte in die Welt der Schönen und Reichen gesehen und soll zu mehr gesellschaftlicher Anerkennung führen. So gibt es in Venezuela eine Schule für die „Herstellung“ von Schönheitsköniginnen. Die jungen Mädchen träumen meist von einer Karriere als Model oder Schauspielerin. Nach dem Präsident der Schule „(...) kommen die Mädchen mit gutem Rohstoff an (...). In unserer Schule werden Ecken und Kanten abgeschliffen, um größtmögliche Perfektion zu erreichen.“ (zit. in Damkowski, S. 27) Unebenheiten gebe es bei allen Mädchen, weil: „Die absolute Schönheit gibt es in der Natur nicht.“ (ebd. S. 27) Durch Nasenkorrekturen und Brustimplantate wird in dieser „Schönheitsfabrik“ versucht, die „unnatürliche“ Schönheit herzustellen, trotzdem soll alles „natürlich“ wirken.[172]
In China und Japan wird vor allem versucht, durch Chirurgie ethnische Merkmale zu beseitigen. Techniken, welche zu längeren Beinen und mehr Körpergröße verhelfen sollen, sind keine Seltenheit mehr. Das westliche Schönheitsideal veranlasst junge Mädchen dazu, ihre Beine brechen zu lassen, wobei dann in monatelangen schmerzhaften Prozeduren durch das Anziehen von Schrauben 5 bis 10 cm mehr Körpergröße erreicht werden kann. Die Mädchen sind meist zwischen 18 und 25 Jahren und erhoffen sich durch mehr Größe gesellschaftliche und berufliche Anerkennung, oder wollen ebenfalls als Model oder Schauspielerin arbeiten.[173]
Solche dubiosen Techniken sind zwar in Deutschland nicht bekannt und wahrscheinlich auch nicht zugelassen. Trotzdem wird auch hierzulande angehenden Models oder Schönheitsköniginnen zugetragen, Korrekturen vornehmen zu lassen, um mehr „Chancen“ auf dem Markt zu haben. Der Wunsch „Model“ zu sein, ist für die meisten Mädchen ein Traumberuf. Models werden zu Leitbildern und Idolen, den geforderten Standards entsprechen allerdings nur wenige.[174] Die Medien suggerieren Jugendlichen ständig, dass mit gutem Aussehen alles zu erreichen ist. So ist es kein Wunder, dass die Schönheitschirurgie häufig als geeignetes und einziges Mittel genutzt und gesehen wird, einem Idol näher zu kommen oder selbst zu einem zu werden. Der Verlust von jeglicher individueller Identität ist so vorprogrammiert und geht sogar über ethnische Grenzen hinaus. Dem „machbaren Körper“ werden keine Grenzen mehr gesetzt, um als genormte „Maschine Mensch“ zu funktionieren.
9. Folgen und psychosoziale Probleme des Schönheitskults
Um im folgenden Kapitel darzustellen, wie die Einflüsse des Schönheitskults psychosoziale Probleme und Folgen hervorrufen können, ist vorab zu erklären, in welcher Beziehung Körper, Selbstbild und soziale Umwelt miteinander stehen. Allerdings ließen sich beim Literaturstudium unterschiedliche Strukturierungen mit gleichzeitiger Knappheit und Mangel an Bezügen unter den Begrifflichkeiten feststellen.
Nach Tiemersma können bei der Körperwahrnehmung zwei unterschiedliche Faktoren genannt werden. Zum einen das Körperschema, welches Informationen über Motorik, Haltung und Oberfläche gibt, und zum anderen das Körperbild, dass die Einstellung zum und die Vorstellung vom Körper zusammenfasst.[175]
Nach Shonfeld dagegen, setzt sich das Körperbild aus der Körperwahrnehmung und der Körpervorstellung zusammen. Die Entwicklung der Körperwahrnehmung geschieht aufgrund einer Integration von vielfältigen Einzelwahrnehmungen. Die Bildung der Körpervorstellung hängt dagegen von psychischen Prozessen ab, welche durch Interaktion erlebt bzw. erfahren wurden und so internalisiert sind. Das Körperbild beinhaltet gleichzeitig physiologische, soziale und psychische Teilaspekte[176] und entwickelt sich schon früh in der Kindheit. Es entsteht durch Lernprozesse und soziale Normen; Sozialisation durch Eltern, Schule, Peers und Medien spielen als Vermittlungs– und Modellinstanzen eine große Rolle.
Das Körperbild eines Menschen beeinflusst das Denken, das psychische Wohlbefinden und damit auch das Verhalten anderer gegenüber. Es ist demnach ein psychologisches Gebilde, dass sich den äußerlichen Veränderungen des Körpers anpasst.[177] Laut Helfferich wird der Körper damit zum sozialen Konstrukt, welches die Wahrnehmung des physischen Körpers steuert, wie der physische Körper erlebt wird; gleichzeitig verfestigt sich in der physischen Wahrnehmung des Körpers eine bestimmte Gesellschaftsauffassung. Das bedeutet, dass der Körper nie objektiv wahrgenommen werden kann, denn das Körperbild ist geprägt von den gesellschaftlichen Ansprüchen, Vorstellungen und Erwartungen.[178]
Das Körperbild gehört zum Selbstkonzept eines jeden Menschen, ist damit Teil der Identität und übt gleichzeitig Einfluss auf die Selbstwahrnehmung aus. Es ist aber kein statisches Konstrukt, sondern verändert sich mit modifizierten Situationen, welche auf Personen einwirken.[179] Nach Freedman ist das Körperbild „(...) ständig im Fluß, es wird größer, wenn wir uns vor Stolz aufblähen; es wird kleiner, wenn wir durch Mißerfolge zusammenschrumpfen. Es wird auch stark dadurch beeinflußt, wie nahe unser realer Körper der gerade vorherrschenden Schönheitsnorm kommt.“ (Freedman, S. 52).
Da vorwiegend die Adoleszenz von körperlichen und sozialen Veränderungen geprägt ist, und gleichzeitig das Körperbild in der Pubertät gelockert wird, damit eine Lösung vom kindlichen Körperbild möglich ist[180] und somit das Selbstbild von jungen Menschen im Zusammenhang gesellschaftlich auferlegter Schönheitsnormen ins wanken geraten kann, möchte ich die Folgeerscheinungen und Auswirkungen von Schönheitsidealen hauptsächlich auf das Jugendalter beziehen.
9.1. Körperentwicklung, Schönheitsnorm und Selbstwert
In der Pubertät gehören das „Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung“ und die „effektive Nutzung des Körpers“ zu den Entwicklungsaufgaben, die bewältigt werden müssen.[181]
Der körperlichen Erscheinung wird in der Adoleszenz von beiden Geschlechtern eine wichtige Rolle zugesprochen. Gleichzeitig übt die Reifeentwicklung des Körpers einen wichtigen Einfluss auf die Körperzufriedenheit aus, weil sich das Körperbild den körperlichen Veränderungen anpassen, und deshalb reorganisiert werden muss.
Männliche Jugendliche legen in der Adoleszenz mehr Wert auf Stärke und einen damit verbundenen, leistungsstarken Körper, während Mädchen den Focus auf die äußere Erscheinung und Attraktivität legen. Nach diesen Aspekten wollen sich Jugendliche darstellen und wollen auch von anderen so wahrgenommen werden. Eine Auseinandersetzung mit männlichen und weiblichen Idealbildern, damit verbundenen Gesellschaftsansprüchen und individueller Ausstattung dient hierbei zur Orientierung.
Nach gängigen Schönheitsnormen und gesellschaftlichen Anforderungen wird ein attraktiver, schlanker, jugendlicher Frauenkörper und ein trainierter, leistungsstarker Männerkörper zum erstrebenswerten Ideal, welches gleichzeitig mit hohem Selbstwert und Erfolg assoziiert wird. Während bei der Entwicklung des männlichen Körpers vermehrt Muskelgewebe gebildet wird, ist der weibliche Körper durch einen Zuwachs von Körperfett und Gewichtszunahme gekennzeichnet. Männliche Jugendliche kommen daher ihrem erstrebenswerten Ideal eines leistungsstarken Körpers näher, während Mädchen sich vom weiblich schlanken „kindlichen“ Schönheitsideal entfernen. Da Mädchen schon früh gelernt haben, ihren Körper funktional zu gebrauchen, um Aufmerksamkeit und Anerkennung zu erlangen und ihnen das körperbezogene Ideal von Schönheit als weibliche Tugend vermittelt wurde, kann dies dazu führen, dass Mädchen ihr Selbstwertgefühl mehr von der äußerlichen Attraktivität abhängig machen, als Jungen.
Die körperlichen Veränderungen werden zusätzlich von der Umwelt bemerkt und bewertet. Besonders frühreife Mädchen werden von Altersgenossen eher gemieden, als Außenseiterinnen behandelt, von den Eltern in ihrer Selbstständigkeit und Freiheit eingeschränkt und erfahren deshalb wenig Wertschätzung in ihrer körperlichen Entwicklung. Frühreife Jungen dagegen bekommen Anerkennung durch die Peers und ihnen werden durch Erwachsene mehr Rechte und Freiheiten zugesprochen. Daher sind frühreife Mädchen eher unzufrieden mit ihrem Körper und haben auch eine negativere Einstellung zu ihm.
Infolgedessen können Versagensängste entstehen, den gesellschaftlichen Ansprüchen und Bildern nicht gerecht zu werden. Misserfolgs– und Minderwertigkeitsgefühle lähmen somit den Aufbau eines gesunden Selbstwertgefühls.[182]
Die mangelnde Selbstwertproblematik lässt sich auch in allen anderen Folgeerscheinungen erkennen und kann auch nach unterschiedlichen Gesichtspunkten erklärt werden, die letztendlich aber alle auch gemeinsam wirken können.
9.2. Verzerrte Selbstwahrnehmung und negatives Körperbild
Nach Studien der amerikanischen Psychologen Feingold/Mazzela hat sich seit den letzten 50 Jahren das Körperselbstbild von Frauen kontinuierlich verschlechtert. In insgesamt 222 Einzelstudien wurde festgestellt, dass sich Frauen vermehrt unattraktiv einschätzen und unzufrieden mit ihrem Körper sind. Bei Männern konnte eine derartige Unzufriedenheit (noch) nicht festgestellt werden. Allerdings reichte die Studie nur bis zur Mitte der 90er Jahre.[183]
Auch andere Forschungen belegen, dass Frauen häufig unter einem negativen Körperbild und einer verzerrten Selbstwahrnehmung leiden. Bei einer Untersuchung wurde im Vorfeld darauf geachtet, dass die Probandinnen ein normales Gewicht und keine Essstörungen oder psychische Erkrankungen hatten. Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass alle Probandinnen, mit einer Ausnahme, Diäten hielten, ihren Körper ablehnten und unter einem gestörten Selbstbild litten. Weitere Studien zeigen, dass Frauen den Umfang ihres gesamten Körpers oder auch den einzelner Körperteile, um mindestens 25% überschätzen. Allerdings betrifft dies nur den eigenen Körper, denn der Körperumfang von anderen Leuten wird richtig eingeschätzt.[184] Berufliche Leistungen werden dagegen häufig unterschätzt.[185]
Boeger belegt im Zusammenhang der unterschiedlichen Bedeutung von Attraktivität für Jungen und Mädchen, dass doppelt so viel weibliche wie männliche Jugendliche ihr Aussehen ändern wollen.
Mädchen unterschätzen demnach ihre eigene Attraktivität im Vergleich zu anderen Mädchen. Männliche Jugendliche dagegen schätzten sich häufig attraktiver ein, als ihre Geschlechtsgenossen. Bei der Beurteilung der eigenen Figur im Hinblick auf die tatsächliche, die gewünschte und die vom anderen Geschlecht bevorzugte, decken sich bei Jungen alle drei Faktoren. Das bedeutet, die tatsächliche, die gewünschte und die vom anderen Geschlecht bevorzugte, sind eher gleich. Bei Mädchen lassen sich dagegen keine Überschneidungen feststellen. Sie schätzen sich dicker ein als sie sind, wünschen sich schlanker zu sein und möchten im Hinblick auf die Präferenz des anderen Geschlechts noch schlanker sein.[186]
Ebenfalls konnte festgestellt werden, dass es für männliche Jugendliche wichtigere Dinge gibt, als ihr Äußeres. Während Mädchen sich dem sozialen Druck ausgesetzt fühlen, schlank und schön sein zu müssen und dadurch ihre eigene Attraktivität abwerten.[187]
Deuser nennt die verzerrte und falsche Selbstwahrnehmung von Frauen „(...) ein Produkt ihrer sozialen Konditionierung, der kulturellen Normen, die ihnen vermitteln, dass sie schön sein müssen, um menschlich wertvoll zu sein.“ (Deuser, S. 105) Parallel dazu ist das aus ökonomischen Gründen hochgesteckte Schönheitsideal meist unerreichbar. Auch Boeger nennt als Ursache für das negative Körperbild bzw. die verzerrte Selbstwahrnehmung das vorherrschende Schönheits– bzw. Schlankheitsideal.[188] Der Kult um einen schlanken Körper lässt demnach viele Frauen im Glauben, dass sie zu dick sind, weil die Diskrepanz zwischen dem wirklichen und dem Idealkörper zu groß wird.[189] Gleichzeitig haben Mädchen sozialisationsbedingt gelernt, ihren Körper differenzierter wahrzunehmen, ihn auch so zu beurteilen und ihn funktional einzusetzen.
Mädchen entwickeln demnach eine größere Körperaufmerksamkeit als Jungen. Männliche Jugendliche betrachten ihren Körper dagegen oft als Werkzeug, reduzieren ihn eher auf physiologische Vorgänge und gestalten mit ihm die Umwelt. Sie beziehen ihr Selbstwertgefühl vielmehr aus ihren Fähigkeiten und ihrem Charakter und neigen dazu, ihren natürlichen Körper so schön zu finden, wie er ist.[190] Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit der Kult um muskulöse Männerkörper das Körperbild von Jungen verzerrt. Nach neueren Quellen aus dem Jahre 2000 wollen immerhin 48% der 13–14jährigen männlichen Jugendlichen stärker sein und 52% würden gerne besser aussehen; auch sie messen sich an idealen Vorbildern.[191] Nach Umfragen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist das „Leitbild Sportlichkeit“ im Sinne eines schlanken muskulösen Körpers normativ wirksam. Dicke Körper führen auch bei Jungs zur Unzufriedenheit und können das Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Allerdings sind extreme „fatalistische“ Grundhaltungen bzw. Ablehnung gegenüber dem Körper nicht festzustellen. Jungen betrachten demnach ihren Körper realistischer, sehen ihn als Schicksal und sind mit einem „normalen“ Körper eher zufrieden.[192] Ein negatives Körperbild bzw. eine verzerrte Selbstwahrnehmung ist grundsätzlich weniger feststellbar.
Die erhöhte Körperaufmerksamkeit und Körperwahrnehmung, die besonders bei Mädchen bzw. Frauen festzustellen ist, kann sich nach psychologischen Forschungen auf das Selbstwertgefühl auswirken.
Eine übersteigerte Konzentration auf den Körper zieht daher mehr Selbstkritik nach sich.[193] Freedman schreibt dass „(...) die Verzerrung des einen notwendigerweise die Deformation des anderen nach sich zieht.“ (Freedman, S. 54) So kann das negative Körperbild zu Inkompetenz- und Minderwertigkeitsgefühlen führen, während auch ein mangelndes Selbstwertgefühl zu einem verzerrten Körperbild führen kann. Da Frauen stärker ihr Selbstbild bzw. ihre Identität mit Aussehen gleichsetzen und es wenig Zusammenhänge zwischen der tatsächlichen körperlichen Attraktivität und der Körperzufriedenheit gibt, kann der ständige Druck den (unerreichbaren) Maßstäben der gesellschaftlichen und kulturellen Schönheitsnorm nicht zu entsprechen, sogar zu Depressionen führen. Weiterhin hemmt das negative Körperbild die Entfaltung einer eigenen Sexualität, führt zu psychosomatischen Symptombildungen, Stress, Scham– und Schuldgefühlen.[194]
9.3. Rollenkonfusion
Die männliche bzw. weibliche Geschlechtsrolle zu übernehmen und sich auf Ehe und Familienleben und eine berufliche Karriere vorzubereiten sind weitere Aufgaben, welche im Jugendalter bewältigt werden müssen.[195]
Im Rahmen des Modernisierungsprozesses und der Emanzipation werden an die Rolle der Frau heute ambivalente Ansprüche gestellt. Die vermittelten, idealen Weiblichkeitsbilder verbinden das traditionelle und emanzipierte Frauenbild. Faktoren wie Familienplanung und berufliche Karriere bei gleichzeitiger Attraktivität, sollen miteinander vereint werden. Die medial vermittelten „Superfrauen“ suggerieren die Möglichkeit des Machbaren, ein Scheitern wird mit „zuwenig Anstrengung“ in Verbindung gebracht und als persönliches Versagen gewertet. Die widersprüchlichen Bilder und Rollenerwartungen zu vereinen, überfordert junge Frauen. Sich für Karriere oder Familie entscheiden zu müssen oder bestenfalls beides zu erreichen, führt zu Rollenkonflikten. Die oben genannten Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, gestaltet sich demnach als schwierig und führt zu einem Problem in der zukünftigen Lebensplanung.
Durch Schönheit kann versucht werden, beiden Rollenanforderungen zu entsprechen. Ein attraktives Äußeres symbolisiert sowohl das traditionelle Frauenbild als auch das der Karrierefrau.
Dem Weiblichkeitsideal nicht im funktionalistischen sondern im äußeren Erscheinungsbild zu entsprechen, gestaltet sich als machbarer. Die Industrie hält hierfür zahlreiche Produkte bereit und die Werbung und Medien zeigen auf, was benützt und gemacht werden muss, um dem Schönheitsideal annähernd zu entsprechen. Das Problem des Rollenkonfliktes verlagert sich demnach nur, denn auch hier ist wieder persönliche Anstrengung gefragt, um dem perfekten Körper näher zu kommen. Ein Scheitern und Versagen führt zu vermindertem Selbstbewusstsein und mangelnder Akzeptanz der Körperlichkeit.[196]
9.4. Narzisstische Störungen
Narzissmus ist grundsätzlich ein wichtiger und normaler Bestandteil jeder kindlichen Entwicklung. Die Welt nach eigenen Bedürfnissen zu erleben und die eigene Person als Liebesobjekt zu empfinden, sind wichtige Bedingungen der Entwicklungsphasen und damit Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung. Ein gesunder Narzissmus ist förderlich für eine bejahende Selbstwahrnehmung und ein positives Selbstwertgefühl und wirkt daher unterstützend bei der Identitätsfindung.[197] Für die Ursachen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gibt es differenzierte Erklärungsversuche. Grundlage dieser Störung sind mangelnde Selbstwertgefühle, die durch Schönheit, Attraktivität oder eine besondere Begabung kompensiert werden müssen. Anzunehmen ist, dass die Weichen für solch eine Störung schon in der Kindheit gelegt werden.[198]
Nach Freud ist die narzisstische Störung vorwiegend eine Erkrankung von Frauen. Sie entstünde aufgrund von erfahrenen Minderwertigkeits– und Schamgefühlen des weiblichen Geschlechts und des weiblichen Körpers.
Im Rahmen seiner Phallus–Theorie könne der Penisneid und somit die Mangelhaftigkeit der Frauen durch die Beschäftigung mit Attraktivität und Schönheit partiell ausgeglichen werden. Gleichzeitig verwies Freud aber auch auf soziale und kulturelle Faktoren, welche eine narzisstische Störung fördern. So könne die Idealisierung weiblicher Reize für Frauen eine enorme Verführung darstellen, sich in exzessiv narzisstischer Weise mit ihren Körpern zu beschäftigen. Ebenfalls erhielte Schönheit durch eine Idealisierung eine übertriebene Bedeutung und würde benützt, um unterschwellige Ängste zu bekämpfen.[199] „Zu viel Kultivierung von Schönheit (...) lasse einen pathologischen Narzissmus erkennen. Wie Masochismus und Passivität sei auch der Narzissmus hauptsächlich ein Problem der Frauen, ein Schutzmantel für Scham und Wertlosigkeit; Gefühle, für die Frauen anfällig seien.“ (Etcoff, S. 27).
Bei moderneren psychoanalytischen Konzepten wird mehr die Bedeutung eines „defekten“ oder „besetzten“ Selbst bei einer narzisstischen Störung hervorgehoben. Wardetzki erklärt, dass eine narzisstische Störung entsteht, wenn Kinder nach einem bestimmten elterlichen Wunschbild geformt werden und somit die Individualität nicht berücksichtigt wird. Eine Spieglung der persönlichen Identität und des wahren Selbst durch die Umwelt wird so in der Kindheit nicht erfahren. Die wünschenswerten Eigenschaften, Verhaltensweisen und Fähigkeiten, mit denen die Eltern häufig ihr eigenes Selbstwertgefühl kompensieren wollen, führen beim Kind zum Aufbau eines „falschen“ Selbst, hinter welchem das „wahre“ verborgen bleibt.
Wie schon in 6.6 angesprochen, kann eine Kompensation durch Äußerlichkeiten als Lösungsversuch gesehen werden, um ein geringes Selbstwertgefühl auszugleichen. Dies zeigt sich schon bei kleinen Mädchen, welche hübsch sein wollen, um dafür gemocht zu werden und um Anerkennung zu erlangen. Später, in der Adoleszenz, wird die körperliche Attraktivität zum essentiellen Element des Selbstbewusstseins und der Identität. Vor allem Mädchen erfahren ihren Körper als wichtigste Eigenschaft und bedeutungsvollen Wert für ihre Zukunftsgestaltung und somit die Macht, die Attraktivität besitzt. Der Konflikt einer narzisstischen Störung, den menschlichen Wert an Attraktivität und Schönheit festzumachen und so die fehlende Selbstannahme und geringe Selbstliebe auszugleichen, ist sehr störanfällig und fragil. Gleichzeitig kann diese Kompensation aus folgenden Gründen nicht gelingen:
Die Erwartungen und Anforderungen an sich selbst sind durch ein überhöhtes Ideal gekennzeichnet. In ihrem Äußeren wollen narzisstisch gestörte Personen makellos und besonders sein. Das Sein und das Handeln zielen darauf ab, korrekt zu sein. Im ständigen Streben nach Perfektion liegt zugleich die Unerfüllbarkeit, denn niemand kann in seinem Tun, Handeln und Äußeren perfekt und fehlerfrei sein. Die unerreichbaren Ansprüche an sich selbst führen demnach immer zu Gefühlen des Versagens und der Minderwertigkeit.
Ebenfalls ist das mangelnde Selbstwertgefühl abhängig von ständiger Bewunderung und Anerkennung durch andere Personen. Allerdings glauben narzisstisch gestörte Personen, diese Bewunderung und Anerkennung nicht für ihr Selbst als Person zu erhalten, sondern aufgrund ihrer Schönheit, Leistung oder Fähigkeiten. Deshalb wird alles mögliche getan, um die Perfektion zu erreichen. Der Hunger nach Anerkennung ist Ausdruck der geringen Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Demnach ist das Gefühl etwas wert und liebenswert zu sein, abhängig von Bewunderung und dient als Ersatzbefriedigung und Kompensation für einen unerfüllten Wunsch nach Achtung, Annahme und Liebe. Die Annahme nur geliebt und liebenswert zu sein aufgrund bestimmter Merkmale und nicht als die wahre Person, ist bei Frauen besonders durch eine Gewichtszunahme sehr störanfällig. „Gemäß ihrem Selbstbild fühlen sie sich nur liebenswert, wenn sie schlank (= schön) sind.“ (Wardetzki, S.44)
An Gewicht zuzunehmen und damit das Gefühl zu haben, unattraktiv zu sein, führt zur Selbstablehnung und zu einem Gefühl von Wertlosigkeit.
Die narzisstische Störung ist gekennzeichnet durch einen ständigen Konflikt von Gefühlen der Grandiosität – welche durch Bewunderung erreicht werden – und Minderwertigkeit und Wertlosigkeit, welche bei Kränkung, Kritik und Zurückweisung entstehen. Kritik und Bewunderung wirken sich zwar auf den Selbstwert aller Menschen aus, allerdings stellen Menschen mit einem gesunden Narzissmuss und einem positiven Selbstwertgefühl dadurch nicht ihre Existenzberechtigung und ihren Selbstwert derart in Frage. Durch die Perfektionierung von Schönheit und Attraktivität oder Leistung wird versucht, das Gefühl der Grandiosität aufrecht zu erhalten, um sich selbst vor dem Erleben von Minderwertigkeit zu schützen.
Hier kommt der sogenannten Maske eine besondere Bedeutung zu. Das Verbergen des wahren Selbst hinter einer Maske von Schminke und Kleidung wird scheinbar zur Ressource von Bewunderung, Ankerkennung und Zuwendung. Die Unsicherheit ohne „Maske“ keine Anerkennung zu erfahren, äußert sich darin, dass sich viele Frauen nicht ungeschminkt zeigen möchten. Das überhöhte Ideal und zugleich das negative bzw. verzerrte Selbstbild ist Ursache dafür, dass sich im narzisstischen Denken gestörte Frauen immer für fehlerhaft halten und dies durch Kosmetik oder Diäten versteckt bzw. behoben werden soll. Das Verbergen und die fehlende Spiegelung des eigenen Selbst durch die Umwelt verhindern die Wahrnehmung eigener Bedürfnisse und Wünsche. Dies führt zu einer Überanpassung im Sinne einer Orientierung und Definition über andere Menschen, Regeln und Vorschriften, ohne dass diese reflektiert und hinterfragt werden. Individualität, Autonomie und Selbstwahrnehmung gehen damit zunehmend verloren und führen zu einem Gefühl der inneren Leere. Diese kann sowohl zu einer narzisstischen Besetzung anderer Menschen, sowie zu Essstörungen und Suchtmittelmissbrauch führen, um die innere Leere zu füllen.[200]
Der Schönheitskult wirkt bei einer narzisstischen Störung, wie auch Freud betont hat, als Verstärker oder vielleicht auch als Ursache. Wenn Jugend, Schönheit, Fitness und Schlankheit als gesellschaftlich erstrebenswert gelten, „(...) verwundert es nicht, wenn Frauen mit einem geschwächten Selbstwert sich diese Werte zu eigen machen, um „mithalten“ zu können.“ (Wardetzki, S. 45)
Gleichzeitig wirbt die Diät–, Kosmetik–, und Modeindustrie mit dem Erlangen eines neuen Selbstwertgefühls durch ihre Produkte, welches vorher durch das Aufzeigen vermeintlicher Mängel genommen wurde. Wie in 6.1 dargestellt, betont Bodamer, dass das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl des heutigen Konsummenschen nicht mehr von seinem Wesen abhängt, sondern von dem, was er an Äußerlichkeiten besitzt. Auch Gottschalch nennt als Grund für den Anstieg von narzisstischen Störungen die Konsum– und Leistungsgesellschaft. Nach dem Motto „ich verbrauche, also bin ich“ werden die eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahrgenommen, statt dessen beginnt die Jagd nach dem versprochenen Glück, welches erreicht wird durch den „(...) Besitz von modischen Dingen, die, kaum verfügt man über sie, von den Manipulatoren des Marktes bereits wieder entfernt werden.“ (Gottschalch, S. 51)[201] In einer Gesellschaft, in der scheinbar nur viel erreicht wird, man wertvoll ist, Erfolg hat, bevorzugt behandelt wird und Aufmerksamkeit und Anerkennung erreicht, indem man attraktiv ist und es mehr um den schönen Schein als um das Schön sein geht, verwundert es nicht, dass das Selbstbewusstsein von der Oberfläche abhängig gemacht wird. Somit fordert der Schönheitskult der westlichen Industrie– und Konsumgesellschaft seine narzisstischen Opfer.
9.5. Sexualitäts– und Partnerschaftsprobleme
Der Prozess der körperlichen Reifeentwicklung in der Adoleszenz ist Grundlage und Vorrausetzung für das Erfahren, Erleben und die Aufnahme von sexuellen Beziehungen mit dem anderen Geschlecht. Dabei gehört Sexualität und die Erotik, wie auch der Körper, zum Kernbereich der Identitätsentwicklung in der Jugendphase.[202] Für die Entwicklung eines Begehrens und einer damit verbundenen autonomen Sexualität ist die Akzeptanz des eigenen Körpers und ein positives Körperbild grundlegend. Bancoft nennt als eine Ursache für sexuelle Probleme die „negativen Gefühle gegenüber der eigenen Person“, welche dazu führen können, sich in einer sexuellen Beziehung ängstlich, angespannt und ärgerlich zu fühlen. Seinen Körper nicht zu mögen und sich als unattraktiv zu fühlen, beeinflussen demnach die grundlegenden Bedürfnisse nach (Selbst–)Sicherheit und Geborgenheit während einer sexuellen Interaktion.[203]
Die Aspekte des Begehrens und Genießens werden also durch verzerrte Selbstwahrnehmung bzw. einem negativem Körperbild und einem daraus resultierenden mangelndem Selbstwert– und Schamgefühl negativ beeinflusst. Nachdem das körperliche Erscheinungsbild für Mädchen in der Pubertät bzw. für Frauen für das Selbstbewusstsein bedeutsamer ist als für Jungen bzw. Männer, ist auch dieser Aspekt beim weiblichen Geschlecht störanfälliger.
Dass dem Schönheitskult im Hinblick auf die Akzeptanz des eigenen Körpers eine wichtige Rolle zukommt und für ein negatives Körpergefühl verantwortlich sein kann, wurde schon aufgezeigt. Gleichzeitig ist die heutige Bedeutung des Körpers mit Sexualität untrennbar verbunden. Die Wichtigkeit von Schlankheit, Fitness, Jugendlichkeit und die Techniken der Schönheitschirurgie zielen alle darauf ab, begehrenswert und sexuell attraktiv zu werden bzw. zu bleiben. Der Bereich der Erotik und Sexualität gilt als allumfassende Lebenskraft und ist eng mit menschlichen Wünschen, Hoffnungen und Sehnsüchten nach Vollkommenheit und Ganzheit verbunden. Besonders die Medien und die Werbung haben daher diesen Bereich nach dem Motto „Sex Sells“ für sich entdeckt und koppeln ihre Produkte mit Erotik bzw. Sexualität.[204] Nach Valverde ist daher festzuhalten, dass „(...) Sex zu einem wesentlichen Schmiermittel für das reibungslose Funktionieren des Konsum–Kapitalismus geworden ist, sowohl als vermarktete Ware als auch in seiner Funktion als attraktive Beigabe zu anderen Produkten.“ (Valverde zit. in Luca, S. 97)
Dem jugendlichen attraktiven Frauenkörper als fungierender Schlüsselreiz bzw. Zuschauerköder kommt hier eine größere Bedeutung wie dem Männerkörper zu. Luca nennt als Grund dafür, dass der weibliche Körper auch in nicht–sexuellen Bedeutungszusammenhängen erotisch in Szene gesetzt wird. Die sexualisierte Zur–Schau–Stellung des Körpers durch die Medien unterstreicht die Bedeutung der körperlichen Attraktivität als „Warenwert“ für sexuelles Begehren. Gleichzeitig greifen die Aspekte der körperlichen Reifeentwicklung, deren Bewertung durch die Umwelt und die dazugehörige Problematik der Geschlechtsrollenidentität hier mit ein und signalisieren, dass der Körper als wichtigstes Kapital gilt, um beim anderen Geschlecht Erfolg zu haben.
Besonders kritikwürdig ist die technische Vermittlung von Sexualität durch die Massenmedien,[205] welche wie in 6.3 aufgezeigt, sinn– und handlungsreduziert sind und somit eine Reflexion meist nicht stattfindet. Eine reduziert erfahrene Vermittlung von Sexualität und die Reduzierung des Körpers auf ein Schönheitsideal, bzw. auf ein Sexualobjekt führt einerseits zu einer „(...) Annullierung einer selbstbestimmten weiblichen Sexualität (...)“( Luca, S. 123), da eigene Bedürfnisse nicht mehr wahrgenommen werden (im Sinne der Umwandlung von Fremdbestimmung in Pseudo – Selbstbestimmung). Andererseits kann die Orientierung an medialen „sexy“ Vorbildern zu Selbstzweifeln, zur Abwertung des eigenen Körpers und zu Schamgefühlen führen. Seinen Körper nicht zu mögen so wie er ist und die Angst, den Wünschen des Partners nicht zu entsprechen, können daher, wie oben genannt, zu Problemen in sexuellen Beziehungen führen. Nach Posch verkompliziert der Schönheitskult zwischenmenschliche Beziehungen: „Er funkt permanent in einem Bereich dazwischen, in den er nicht hingehört: in die Liebe und in die Sexualität.“ (Posch, S. 132)
Mädchen haben häufig das Problem, dass sie Schönheit als Mittel ansehen, um mehr Liebe zu erfahren bzw. um die Chance auf Liebe zu erhöhen. Dass sich Attraktivität tatsächlich positiv auf den Erstkontakt beim Kennenlernen auswirken kann, wurde in 7.5 belegt. Trotzdem reicht Schönheit nicht aus, damit eine Partnerschaft funktioniert. Letztendlich findet man doch denjenigen schön, den man liebt und liebt nicht jemanden aufgrund seiner Schönheit.
Der Kult um die Schönheit unterstreicht allerdings Schönheit als Vorraussetzung für Liebe, weil Schönheit, auch für Partnerschaften, zum Imperativ von Glück geworden ist. Die Liebe wird damit reduziert auf die passive Wirkung des Schönseins und um anderen zu gefallen. Wenn der Kult um die Schönheit zur Vorraussetzung einer glücklichen Partnerschaft und eines gesunden Sexuallebens wird, hindert dies den Aufbau eines grundlegenden Vertrauens in einer zwischenmenschlichen Beziehung und führt so zu Kommunikationsproblemen. Dies kann sich darin äußern, dass vor allem junge Frauen glauben, dass ihr Partner sie nicht so lieben könne wie sie ist und so alles erdenkliche tun, dass die „Mängel“ nicht erkannt werden, obwohl diese Annahme gleichzeitig verletzt.
Für Männer führt diese Situation häufig zu einer Konfliktlage, der ausweglos gegenüber gestanden wird. So wird alles, was er zu ihr sagt, falsch interpretiert und wirkt sich kränkend auf die Frau aus.[206] „Der Mythos bringt es fertig, daß Frauen Männer kränken, indem sie aufrichtige Wertschätzung, wenn sie ihnen entgegengebracht wird, zurückweisen; und er erreicht, daß Männer Frauen allein durch die Tatsache verletzen, daß sie sie aufrichtig schätzen. Er erreicht, dass der Satz „Du bist schön“, der dem „Ich liebe dich“ sehr nahe steht, weil er Mann und Frau in gegenseitiger Achtung verbindet, vergiftet ist. Ein Mann kann einer Frau nicht sagen, daß er sie gern ansieht , ohne sie unglücklich zu machen. Wenn er es aber nicht sagt, ist sie auch unglücklich. Und die „glücklichste“ unter den Frauen, die, der gesagt wird, dass man sie liebe, eben weil sie „schön“ sei, plagt sich mit der Unsicherheit herum, ob sie nur deswegen geliebt wird, weil sie ist, wie sie ist: liebenswert schön.“ (Wolf, S. 240f.)
9.6. Konkurrenzverhalten
Der Kult um die Schönheit ist geprägt von der Auseinandersetzung mit Idealbildern, um die persönlichen „körperlichen Mängel“ zu erkennen. Das diese aufgezwungenen Vergleichsbilder zu geringem Selbstwertgefühl und zu einem verzerrten Körperbild führen können, wurde bisher ausführlich dargestellt. Durch die negativ entstehenden Gefühle führt das Betrachten von Schönheiten daher weniger zu Bewunderung als eher zu Neid und Rivalität.
Nach einer Studie gaben 91% der befragten Frauen an, manchmal bzw. oft Neid zu empfinden, bezüglich des Äußeren von anderen Frauen. Weil durch den Schönheitskult das Aussehen zum Kapital und zur sozialen Macht geworden ist, liegt es deshalb nahe, dass Neid und Konkurrenzverhalten dadurch angetrieben werden. Ebenfalls ließ sich feststellen, dass besonders junge Frauen sehr anfällig für Neid sind.[207] Weil Attraktivität für weibliche Jugendliche häufig als wichtigstes Mittel gilt, um die Umwelt zu gestalten, und diejenigen als erfolgreich gelten, die von Jungen am meisten begehrt werden, erscheint diese Feststellung einleuchtend. Ebenfalls werden attraktive Frauen häufig für eingebildeter und egoistischer gehalten, wie die Studie von Dermer und Thiel belegt (vlg. 7.2). Auch Wilse r und Preiß konnten feststellen, dass Mädchen, die mit sich selbst zufrieden sind, als eingebildet und arrogant gelten.[208]
Ein mangelndes Selbstwertgefühl ist eine bedeutsame Bedingung für die Entstehung von Konkurrenzverhalten und Neid. Im Rahmen des narzisstischen Denkens dient Bestätigung und Anerkennung von Schönheit dazu, den Selbstwert zu heben. Gleichzeitig ist diese Kompensationsmöglichkeit aber gekennzeichnet von der Furcht, jemand anders könne besser aussehen oder begehrenswerter sein. Die empfundene Bedrohung des Selbstwertes führt somit nicht nur zu erhöhter Selbstkritik, sondern steigert auch die kritische Betrachtung anderer. Sich mit dem Aussehen anderer zu vergleichen ist ein Mechanismus, um eine Bilanz für den persönlichen Wert zu ziehen. Die Bedeutung von Schönheit in unserer Gesellschaft (besonders im Bezug auf Mann–Frau–Beziehung) verbunden mit der Suggerierung des persönlichen Einsatzes, provoziert das Konkurrenzverhalten in erheblichem Maße. Die gegenseitige Bewertung nach der Schönheitsnorm „(...) läßt Frauen einander misstrauisch begegnen, einander belauern und bewerten, wer es besser oder schlechter schafft, sich dem Ideal zu nähern.“ (Posch, S. 126) Infolgedessen entstehen Ungleichheitsverhältnisse und soziale Differenzierungen, die Frauen bzw. Mädchen voneinander isolieren können.[209] Besonders problematisch kann sich dieses Konkurrenzverhältnis bei Mädchen im Hinblick auf die Entwicklungsaufgaben auswirken. Für die allmähliche Ablösung vom Elternhaus, der Akzeptanz des eigenen Körpers und der Rollenfindung kommt der Peer-group eine bedeutsame Rolle zu. Durch Identifikation mit Gleichgesinnten bieten Freundschaften Raum von Sicherheit, stärken das Selbstbewusstsein und gelten daher als wichtiges Potential um die Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Helena Deutsch schreibt hierzu: „(...) durch die Identifizierung mit der Freundin erweitert das schwache „Ich“ des Mädchens seine eigenen Grenzen und gewinnt im Kampf gegen Minderwertigkeitsgefühle mehr Selbstvertrauen“. (Deutsch zit. in Flaake, S. 206)[210]
Der Kult um die Schönheit wirkt sich auf das bedeutsame Potential von Freundschaften allerdings destruktiv aus. Der Neid, die kritische Betrachtung und die meist dadurch entstehende Abwertung anderer als Mittel der Kompensation „(...) veranlasst Frauen dazu, sich solange als Feindinnen einzuschätzen, bis sie sicher sein können, Freundinnen zu sein.“ (Posch, S. 126) Im Gegensatz zu Jungen kann deshalb bei Mädchen ein unterstützendes Netzwerk von Gleichgesinnten, welche solidarisch zueinander stehen, aber nicht zwingend befreundet sein müssen aufgrund der Schönheitskonkurrenz nur schwer entstehen.[211]
9.7. Essstörungen
Für Entstehung und Entwicklung von Essstörungen wie Magersucht, Bulimie und Adipositas gibt es keine schlüssigen, theoretischen Modelle, es wird vielmehr eine multifaktorielle Kausalität angenommen. Ebenfalls können Essstörungen in verschiedenen Abwandlungen und Kombinationen auftauchen.[212] In der folgenden Darstellung ist es nicht zwingend notwendig, die Krankheitsbilder im einzelnen aufzuzeigen und zu definieren, weil es eher darum geht, welche gesellschaftlichen Faktoren ein gestörtes Verhältnis zum Essen bzw. Essstörungen hervorrufen können.
Faktum ist, dass Essstörungen hauptsächlich in westlichen Industriestaaten zu finden sind, welche durch Nahrungsüberfluss, starke Konsumorientierung und ein funktionalistisches Körperbild, im Sinne von Körperformung und Reparatur durch Fitness, Schönheitschirurgie und Medizin, gekennzeichnet sind.
Dies sind Bedingungen, welche mit den ursächlichen Mechanismen für ein „neues Körperkonzept“ und den Schönheitskult einher gehen (vlg. Kapitel 6).
In den letzten Jahren haben Essstörungen extrem zugenommen haben. Nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hat schon 1984 jedes zweite 18–jährige Mädchen Erfahrungen mit Diäten gemacht. Heute sind die Diäterfahrenen noch um einiges jünger geworden. Bereits jede dritte der sieben bis zehn–jährigen macht Diäten und jede zweite zwölf–jährige zählt regelmäßig die Kalorien, obwohl die Mädchen meist normal–, wenn nicht sogar untergewichtig sind.[213]
Sabine Timme von Amanda e.V. nennt neben systemischen und psychologischen Ansätzen und Theorien noch weitere auslösende und begünstigende Faktoren für Essstörungen, die mit dem Schönheitskult in Verbindung gebracht werden können. Diese werden im folgenden erläutert.
Den Medien kommt nach Timme eine besondere Bedeutung bei der Entstehung von Essstörungen zu. Durch die stetige Präsenz von schönen, schlanken, erfolgreichen und selbstbewussten jungen Menschen in Werbung und Fernsehen wird Jugendlichen vermittelt, wie Mann bzw. Frau aussehen soll. Auch Timme betont hier besonders die Rolle der Frauen– und zunehmend auch Männerzeitschriften (vgl. 8.1), in welchen das Körperideal präsentiert wird, einhergehend mit Schlankheits– und Diättipps. Demnach ist auch die Zahl der männlichen Essgestörten von 5% (1990) auf 10% gestiegen. Essgestörte männliche Models sind auf den Modeschauen keine Seltenheit mehr. Hier ist anzumerken, dass für füllige Menschen das Dicksein durch gesellschaftliche Reaktionen erst zu einem seelischen Problem wird. Indem Kontrolle, Disziplin und Askese gesellschaftlich erstrebenswerte Ziele sind und dies durch die ständige Medienpräsenz vor Augen geführt wird, kann häufig erst eine Esssucht entstehen. Sie ist durch unkontrollierbare, schuld– und schambegleitete Essanfälle ohne Hungergefühl gekennzeichnet.[214]
Im Zuge des vermittelten Schönheitsideals durch die Medien werden Diäten häufig als Mittel gesehen, um dem schlanken = schönen Ideal näher zu kommen. Wie in 8.1 bereits aufgezeigt wurde, ist das Abnehm– und Diätverhalten bei Frauen und besonders bei jungen Mädchen zum Kollektiv geworden. Nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (1992) ist dieses Verhalten für die Entstehung von Essproblemen und –störungen sehr risikoreich und gilt als eindeutige „Einstiegsdroge für süchtiges Essverhalten“.[215]
Auch Körpertraining wird als Mittel benützt, um den Körper schlank zu halten bzw. schlank werden zu lassen. Sport ist in unserer Gesellschaft wichtig, um den Körper gesund und fit zu halten, vor allem weil er nicht mehr als Arbeitskörper fungiert und so mangelnde Bewegung ebenfalls zu Krankheiten führen kann. Bei Leistungssport geht es allerdings um die Disziplinierung und Kontrolle des Körpers im funktionalistischen Sinne. Eine Verweigerung des weiblichen und reifenden Körpers kann die Folge sein, um weiterhin den Leistungssport ausüben zu können.[216] Parallel dazu können bei besonders ehrgeizigen und wenig selbstbewussten Mädchen Bemerkungen von Trainern oder Sportlehrern über zu viel Körpergewicht ausreichen, um Essstörungen hervorzurufen.
Auch Ernährungsinformationen können sich problematisch auf das Essverhalten auswirken. Die Aufklärung über das richtige Essverhalten führt bei Mädchen hauptsächlich dazu, zu verinnerlichen was sie „nicht essen dürfen“. Diese Gedanken können sich so intensivieren, bis sie sich letztendlich nur noch um Essen kreisen, bzw. das was man nicht essen darf. Ebenfalls führen angebotene Light–Produkte oder fettreduzierte bzw. zuckerreduzierte Lebensmittel zu mehr Hungergefühl und nicht zur Gewichtsreduktion. Als Nahrungsimitate regen sie den Appetit eher an und melden dem Körper Energiezufuhr, die er aber nicht bekommt.
Wie eben schon genannt, gibt es für die Entstehung von Essstörungen zahlreiche Bedingungen und Begründungen, welche meist zusammenwirken müssen, um die entsprechenden Krankheitsbilder hervorzurufen. Eine Identitäts– und Selbstwertproblematik wird allerdings bei den meisten Erklärungsansätzen als Kern für Essstörungen gesehen und zwar im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Strukturbedingungen.[217]
Entstehende Versagensängste und Minderwertigkeitsgefühle in der Pubertät, den gesellschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht zu werden und eine damit einhergehende Unsicherheit über Selbstbestimmung und der weiblichen Identität, sind tiefgreifende emotionale Konflikte. Ehrgeiz, Ausdauer und Perfektionsdrang können zum Lösungsversuch werden, um die Versagensängste zu kompensieren. Eine Kontrolle über den eigenen Körper durch Abnehmen bzw. Nahrungsverweigerung wird als Beweis für Autonomie und Selbstbeherrschung erfahren. Weiterhin ruft die sexuelle Reifeentwicklung des Körpers Unsicherheit hervor. Das störanfällige Köper– bzw. Selbstbild und die Angst, nicht mehr zu gefallen, können im Extremfall dazu führen, den weiblich werdenden Körper abzulehnen. Durch Hungern wird deshalb versucht den Körper kindlich bleiben zu lassen.
Ebenfalls können Essstörungen den Versuch darstellen, den gesellschaftlich ambivalenten Rollenanforderungen zu entsprechen. Dem internalisierten, traditionell weiblichen Verhaltensmuster soll genauso entsprochen werden, wie dem emanzipierten, selbstbewussten Bild der Karrierefrau. Weil Schlankheit ein Synonym für beide Rollenanforderungen darstellt, wird durch einen schlanken Körper versucht, diese ambivalenten Anforderungen in sich zu vereinen (vlg. 9.3).[218]
Hier greift auch die feministische Theorie ein, indem Frauen mit einem weitgehend androgynen Körper ihre Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit symbolisieren wollen. Das typisch „mütterliche“ Bild verbunden mit Körperrundungen wird abgelehnt. Ebenfalls kann auch ein traditionell weibliches Selbstbild zu Essstörungen führen. Geprägt durch ein Abhängigkeitsverhältnis und Unselbstständigkeit stellt Attraktivität eine wichtige Lebenschance dar. Dementsprechend wird viel Motivation und Energie aufgewendet, um dem weiblichen, schlanken Schönheitsideal zu entsprechen.[219]
Magersüchtige Personen nennt Deuser „(...) die zynische Karikatur des Schlankheitsideals.“ (Deuser, S. 179) In einer Gesellschaft, in der einem schlanken Körper eine derart große Bedeutung zukommt und er gelobt wird, in welcher Diäten sozial akzeptiert und erwünscht sind und zum Alltag vieler Frauen gehören, fällt dieses Krankheitsbild nicht unbedingt als „unnormal“ auf. Tatsächlich werden Magersüchtige in dem Zeitraum, indem sie noch nicht extrem dünn sind, eher aufgrund ihrer Traumfigur bewundert. Gleichzeitig gelten die Charaktereigenschaften der Magersüchtigen wie Disziplin, Selbstbeherrschung, Aktivität und Leistungsvermögen in unserer Gesellschaft als erstrebenswert und genießen hohes Ansehen.[220]
10. Konsequenz für die soziale Arbeit
Wie in den vorherigen Kapiteln dargestellt, ist Schönheitspflege und die Bedeutung des Körpers heute zu etwas anderem geworden, als die Lust an der Verschönerung oder die Freude an der Schönheit. Der exzessive Kult um den Körper birgt Gefahren in sich, sei es durch die Schönheitschirurgie, den extremen Schlankheitswahn oder andere kosmetische Rituale. Verschönerung im heutigen Sinne hat nicht selten etwas mit einer gewaltsamen Zurichtung des Körpers zu tun. Zudem hemmt der Schönheitskult besonders bei jungen Menschen den Aufbau eines positiven Körperbildes und untergräbt so eine bejahende Selbstakzeptanz. Psychische, soziale und damit einhergehende körperliche Probleme sind die Folge.
10.1. Schönheitskult – ein Thema für die Gesundheitsförderung
Nach der Definition von WHO beinhaltet die Gesundheit eines Menschen ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden und nicht nur die bloße Abwesenheit von Krankheit.[221] In einem neueren Dokument wurde diese Definition konkretisiert. So heißt es: „(...) Gesundheit (ist) als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel.“ (WHO, Ottawa Charta, 1986 zit. in Redler 2001, S. 5) Weiter heißt es: „Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben.“ (ebd., S. 5) Dies bedeutet, dass zur Gesundheit eines Menschen seine gesamten Lebensverhältnisse gehören. Geprägt durch das Konzept der Salutogenese wird dem Alltagshandeln hierbei eine große Bedeutung zugesprochen. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Faktoren sich günstig auf die Gesundheit auswirken oder ganz banal ausgedrückt: „Was tut gut?“.
Die Faktoren „Wohlbefinden“ und „Lebensfreude“ gehören demnach zum Verständnis von Gesundheit.[222] Und zu Wohlbefinden und Lebensfreude gehört Schönheit. Nach der Lebenskunstlehre von Wilhelm Schmid sei ein schönes Leben der ultimative Sinn der Existenz.[223]
Welche Faktoren nun zu „Wohlbefinden“ und „Lebensfreude“ führen, beantwortet das Konzept der „positiven Triade“ :
- eine positive Einstellung zur eigenen Person, d.h. Selbstachtung und ein hohes Selbstwertgefühl
- eine positive Einstellung zur Umwelt, d.h. Bejahung der Umwelt und Liebesfähigkeit
- eine positive Einstellung zur Zukunft, d.h. Optimismus ( nach Becker, 1991)
Diese Triade kann als Voraussetzung für ein schönes Leben gelten, denn: „Schön ist das, was als bejahenswert erscheint.“ ( Schmid, Wilhelm zit. in Redler 2001, S.1)
Wichtig ist hierbei, die „positive Triade“ hierarchisch zu betrachten. So ist nach Schipperges
(1990) die Voraussetzung für Gesundheit eine Zustimmung zur Welt, die aber nur erreicht werden kann, wenn eine Zustimmung zur eigenen Person und somit zum eigenen Körper vorausgeht.
Das bedeutet, dass ein negatives Körperbild und eine Ablehnung des eigenen Körpers verbunden mit geringem Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein nicht zu einem ganzheitlichen Wohlbefinden und infolgedessen nicht zur Gesundheit führt. Sich selbst anzunehmen und somit eine gesunde Persönlichkeit aufzubauen, führt dagegen zu einer positiveren Einstellung gegenüber der Umwelt, zu einer optimistischen Zukunftssicht und daher zu Lebensfreude.[224]
Das bedeutet: „Gesundheit ist das beiläufige Ergebnis von Freundschaft mit dem eigenen Körper“ und die „Freundschaft mit dem eigenen Körper stärkt die Gesundheit“. (Redler, 2001, S. 7f.)
Ein weiterer Faktor, welcher Lebensfreude und Wohlbefinden beeinflussen kann und hier mit eingreift, ist Stress. Waller/Shuval erklären: „Ein Individuum befindet sich unter Stress, wenn seine Möglichkeiten der Bewältigung der von ihm als störend, alarmierend oder bedrohlich erlebten Situation versagen und die Konsequenzen dieses Versagens schwerwiegend sind.“ (Nach Shuval, zit. nach Waller 1982 in Gerhardinger, o. S.)
Die ständige Konfrontation mit den Ansprüchen des Schönheitskult, das Hinterherjagen nach Schönheitsidealen, der Kampf gegen sich selbst und den eigenen Körper durch übertriebene Fitness und Diäten verhindern Lebensfreude und Lebensgenuss. Die einhergehenden Versagensgefühle gegenüber einem unerreichbaren Ideal, welche häufig als schwerwiegend erlebt werden und die induzierte Wer – will – der – kann – Ideologie, d.h. mit genügend Anstrengung kann jeder das Ideal erreichen, führen somit zu krankmachendem Stress. Verbunden mit der Selbstwertproblematik können damit gesundheitliche Schäden entstehen, physisch, psychisch oder psychosomatisch.[225]
Grundsätzlich kann aber die Ausprägung gesundheitsschützender Faktoren dafür verantwortlich sein, ob belastende Situationen zu Krankheiten führen können. Hierzu gehören die personalen und sozialen Ressourcen eines Einzelnen. Die personalen Ressourcen sind demnach die Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Individuums, sich mit belastenden Situationen auseinander zu setzen. Die sozialen Ressourcen sind im Wesentlichen geprägt durch soziale und emotionale Unterstützung durch die Umwelt und die soziale Integration. Weiterhin auch durch materielle, informationelle, instrumentelle und kulturelle Unterstützung, welche einem Individuum in seiner spezifischen Lebenslage, die durch sozialstrukturelle und sozialökonomische Gegebenheiten bestimmt ist, zur Verfügung stehen. Die Ausprägung sozialer und personaler Ressourcen übt letztendlich Einfluss auf das Selbstwertgefühl und die Selbststeuerungsfähigkeit aus, ist somit in das Selbstkonzept integriert, welches letztendlich bestimmt, ob belastende Situation bewältigt werden können oder nicht. Anzumerken ist, dass ein Gesundheits– bzw. Krankheitszustand auch rückwirkend auf die personalen und sozialen Ressourcen Einfluss nehmen kann.
Im Rahmen der Gesundheitsförderung sollten deshalb stabilisierende und aufklärende Maßnahmen angeboten werden, wobei die Zielsetzung aller gesundheitsfördernden Maßnahmen darin besteht „(...) sowohl die individuellen als auch die sozialen Ressourcen zu fördern und zu stärken.“ (Hurrelmann 1991 zit. in Gerhardinger, o.S.) und zwar im Rahmen von Kompetenz- und Netzwerkförderung.[226] Differenziert betrachtet können sich für die soziale Arbeit folgende Aufgaben und daraus resultierende Handlungsmöglichkeiten ergeben um präventiv gegen einen „krankmachenden“ Kult zu wirken.
10.2. Aufgaben der sozialen Arbeit
Wie bereits dargestellt ist die Zustimmung zur eigenen Person und damit verbunden ein hohes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein Grundvoraussetzung, um im Sinne der „Wohlbefindenstheorie“ und der Gesundheitsdefinition von WHO als gesund zu gelten. Um den im Kapitel 9 genannten Negativeinflüssen des Schönheitskults entgegenzuwirken, müssen die gesundheitsschützenden personalen und sozialen Ressourcen des Einzelnen gefördert und gestärkt werden, damit ein selbstbestimmtes Handeln möglich wird.
Freilich ist es schwer vorstellbar, sich von gesellschaftlich auferlegten und vermittelten Idealen zu lösen, weil sie Teil des Alltagserlebens sind. Es soll auch keinesfalls erreicht werden, sich mit seinem Äußeren nicht mehr zu beschäftigen.
Sich „schön“ zu machen beinhaltet ebenfalls positive Ressourcen wie z.B. Kreativität und Phantasie, und macht Spaß. Beim vorherrschenden Schönheitskult ist es allerdings wichtig zu lernen, die vermittelten Maßstäbe kritisch und reflexiv zu hinterfragen, vor allem da, wo sie mehr Schaden als Nutzen anrichten können. Sich „schön machen“ und auch Schönheit genießen sind Faktoren, die zur Lebensfreude führen und sollten aus diesem Grund nicht durch einen krankmachenden Kult überlagert werden. Deshalb besteht die Aufgabe der sozialen Arbeit darin, einen kompetenten Umgang mit aktuellen Schönheitsidealen und Werbebildern zu fördern, sowie die Stärkung von individuellen und sozialen Ressourcen, damit der Kult um die Schönheit nicht zum Lebensinhalt wird. Um die eben genannten Ziele zu erreichen, können die Methoden und Aufgaben der Medienpädagogik, der Sexualpädagogik und der Gesundheitsaufklärung einen geeigneten Rahmen bieten, um präventiv und somit gesundheitsfördernd zu wirken. Die Gesundheitsförderung sollte in diesem Sinne schon im Kindes– und Jugendalter beginnen, weil frühe positive Selbsterfahrungen grundlegend sind, um Koppelung von Schönheitsidealen und Lebenszufriedenheit aufzuheben.[227]
Da besonders adoleszente Mädchen für ein negatives Körperbild anfällig sind, ergibt sich hier die Hauptzielgruppe. Geeignete, präventive Maßnahmen der Mädchenarbeit können so in das Erwachsenenalter übernommen werden. So stellt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) fest, dass Frauen mit hohem Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und positiven Umgang mit ihrem Körper eher dazu fähig sind, Handlungskompetenzen zu entwickeln z.B. bei der Früherkennung von Brustkrebs, weniger suchtgefährdet sind und im Krankheitsfall eher auf eigenen Ressourcen der Bewältigung zurückgreifen.[228] Kooperationsbereitschaft verschiedener Einrichtungen, geeignete Schulung von PägagogInnen und MultiplikatorInnen, Elternarbeit und die Ausstattung mit finanziellen Mitteln sind natürlich grundlegend, damit die Ziele erreicht werden können und Präventionsmöglichkeiten gelingen. Im Folgenden werde ich allerdings auf diese strukturellen Faktoren nicht mehr eingehen, da sie Voraussetzung aller pädagogischen Maßnahmen sind. Insgesamt gibt es zahlreiche Methoden, präventiv zu wirken. Anschließend möchte ich einen kurzen Ausschnitt von Präventionsmöglichkeiten darstellen, welche sich beim Literaturstudium als besonders bedeutsam herauskristallisiert haben.
10.3. Präventionsmöglichkeiten
10.3.1 Medienpädagogische Methoden
Die Aufgabe und Zielsetzung der Medienpädagogik besteht grundsätzlich darin, einen kompetenten Umgang mit den Medien zu gestalten und zu vermitteln.
Wie in den vorherigen Kapiteln betrachtet, kommt den Medien bei der Vermittlung von Geschlechterrollen, Schönheitsidealen verbunden mit „Wer–will–der–kann–Ideologien“ und der Verknüpfung von Schlankheit und Schönheit mit sozial erwünschten Werten wie Erfolg, Ansehen und soziale Einbindung, eine große Bedeutung zu.
Damit die von außen bestimmten Ideale nicht durch bloße Fremdbestimmung in das Selbstkonzept integriert werden, müssen Jugendlichen, vor allem jungen Mädchen Kompetenzen vermittelt werden, die Wirkung von medialen Bildern zu hinterfragen und zu durchschauen. Dies fordert auch die BZgA im Rahmen einer Primärprävention in der Mädchenarbeit.[229] Es sollten Möglichkeiten geboten werden, die das Medienerleben aufarbeiten und die Wahrnehmung medialer Inhalte schärfen. Kritikfähigkeit und Reflexionsfähigkeit sind hierbei entscheidende Faktoren, welche gefördert werden sollten, damit ein selbstbestimmtes Handeln ermöglicht wird. Methodisch gibt es vielfältige Möglichkeiten, um das Medienerleben Jugendlicher aufzuarbeiten.[230] Wichtig ist, dass sie an die Lebenswelt der Jungendlichen anknüpfen, um deren Interessen direkt zu erreichen.
Im folgenden möchte ich zwei Methoden kurz vorstellen:
Analyse von Frauen und Mädchenzeitschriften:
Printmedien für Mädchen und Frauen werden weit verbreitet gelesen. Nach Untersuchungen sind sie für Mädchen eine bedeutungsvolle Informationsquelle und tragen zur Meinungsbildung und auch Identifikationsbildung junger Mädchen bei; anzunehmen ist, dass sie einen bedeutsamen Faktor bei der weiblichen Sozialisation darstellen. Gerade deshalb ergibt sich die Notwendigkeit, die Inhalte in Mädchen– und Frauenzeitschriften kritisch und reflexiv betrachten zu lernen. Besonders im schulischen Bereich kann die Analyse von Frauen– und Mädchenzeitschriften als fächerübergreifendes Projekt genutzt werden. Durch eine praktische Bearbeitung verschiedener Themen in unterschiedlichen Fächern kann ein Forum geboten werden, die Inhalte in Mädchen– und Frauenzeitschriften kritisch und reflexiv zu hinterfragen und zu beleuchten.[231]
So kann z.B. in den Fächern Sozialkunde, Erdkunde und Geschichte die Wandlung des Frauenbildes, besonders seit der Nachkriegszeit, das Vergleichen von Schönheitsidealen in unterschiedlichen Kulturen, die zunehmende Verwestlichung der Welt am Beispiel wandelnder Schönheitsideale in anderen Ländern oder das Vergleichen von Werbung in früherer und heutiger Zeit, bearbeitet werden.
Naturwissenschaftliche und technische Fächer können hingegen Raum bieten, um die Techniken und Bearbeitungsmöglichkeiten von Film oder Fotografie wie Belichtung oder Retuschierungsmöglichkeiten zu hinterblicken. Die Wirkweise von Diäten und plastischer Chirurgie, die chemische Zusammensetzung von Kosmetik, Cremes, Silikon usw. und deren Darstellung in der Printwerbung könnte in Fächern wie Biologie oder Chemie durchgenommen werden.
Weiter kann der Sportunterricht genutzt werden, um die unterschiedlichen bewegungsorientierten Angebote in den Frauenzeitschriften zu vergleichen, im Religions– oder Ethikunterricht hingegen können Gespräche und Diskussionen im Hinblick auf die moralische und ethische Vertretbarkeit des Schönheitskults und des Eingreifens in den Körper (z.B. durch plastische Chirurgie) stattfinden; weiter können Beratungsrubriken und Erlebnisberichte von Frauen und Mädchen und die Darstellung von „normalen“ Menschen in der Mädchen– und Frauenpresse und deren Werbewirkung analysiert werden.
Durch Bildbeschreibungen und Kurzgeschichten anhand der dargestellten und beschriebenen Frauen und Mädchen und durch Analyse von unterschiedlichen Frauenbildern und deren Darstellung in den Mädchen– und Frauenzeitschriften kann auch der Deutschunterricht Raum bieten. Insgesamt bietet jedes Schulfach mögliche Themengebiete, um eine Reflexions– und Kritikfähigkeit der Jugendlichen gegenüber medialen Inhalten zu fördern.
- Produktorientierte Medienpädagogik:
Hierbei sollen Jugendliche in Gruppenarbeit selbst angeregt werden, ein mediales Produkt herzustellen. Dies könnte das eigene Erstellen einer Mädchen– oder auch Jungenzeitschrift sein oder ein Kurzfilm. Geschlechtsspezifische Arbeit ist notwendig, weil in gemischtgeschlechtlichen Gruppen häufig die Interessen der Mädchen durch vorwiegend technische und inhaltliche Bestimmung der Jungen überlagert werden. Da das Spiel mit eigenen Bildern, Wünschen und Bedürfnissen im Vordergrund stehen sollte, um sich damit auseinander zu setzen, ist es wichtig, dem Prozess der Herstellung im Sinne von Selbstgestaltung Raum zu bieten und nicht nur das fertige Produkt anzustreben. Phantasievolles und kreatives Potential kann bei der Eigenproduktion ausgelebt und entdeckt werden und somit mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten geben. Durch die Spiegelung mit dem Selbstbild während der eigenen Produktion kann das Medium Forum für persönliche Ängste und Wünsche werden, die hierbei einen Ausdruck finden. Ebenfalls kann eine Eigenproduktion eine Kompensationsmöglichkeit für mangelnde positive weibliche Vorbilder in den Medien darstellen.[232] Zuletzt bekommen die Jugendlichen ebenfalls Einblick, mit welchen technischen und gestalterischen Möglichkeiten ein Produkt bearbeitet und in Szene gesetzt werden kann.
10.3.2 Gesundheitsaufklärende Maßnahmen
Wie in den Kapiteln 8.1 und 9.7 angesprochen, ist der Wunsch schlank zu sein und ein daraus resultierendes Abnehmverhalten durch Diäten schon bei ganz jungen Mädchen weit verbreitet. Die Gesundheitsaufklärung sollte deshalb Maßnahmen ergreifen, welche in erster Linie über den Unsinn und die Gefahr von Diäten aufklären. Die Versprechen der Diätindustrien, die schnellen Erfolg garantieren, sollten von den Jugendlichen durch geeignete Informationen hinterblickt und durchsichtig gemacht werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erfahren, wie der Körper funktioniert, damit deutlich wird, dass Diäten süchtig und krank machen und häufig erst der Grund für „Dickwerden“ sind. Aufklärende und informative Maßnahmen sollten Jugendlichen klar machen, dass
- der anfängliche Gewichtsverlust bei Reduktions– und Crashdiäten nur Scheinerfolge sind, weil nicht die Fettdepots angegriffen werden. Ein auf Diät gesetzter Körper verbrennt zuerst den Zuckergehalt im Blut und in der Leber und greift danach auf Muskeleiweiß zurück. Die abgebauten Proteine werden mit viel Flüssigkeit ausgeschieden, was zunächst den Gewichtsverlust vorgaukelt.[233]
- der Körper nicht zwischen einer Diät und einer Hungersnot unterscheiden kann. Deshalb senkt er den Grundumsatz des Kalorienverbrauchs. So wird schon der Ruheumsatz um 40% reduziert. Durch das Umstellen aller Stoffwechselvorgänge auf „Sparflamme“ werden mit jedem Diättag weniger Kalorien verbraucht, somit wird das Abnehmen mit jeden Tag schwieriger und das allgemeine Aktivitätsniveau sinkt erheblich.
- der Körper sich vor einer erneuten „Hungersnot“ schützt.
Deshalb legt er nach jeder Diät jegliche, ihm zur Verfügung stehende Energiezufuhr an, um Vorsorge für eine erneute „Hungersnot“ zu treffen. Die darauf folgende vermehrte Gewichtszunahme ist als Jo-Jo-Effekt bekannt. Bei jeder weiteren Diät verteidigt der Körper vermehrt seinen Fettvorrat, deshalb können Diäten dick machen.[234]
- Diäten und gezügeltes Essverhalten zu körperlichen, kognitiven, emotionalen und sozialen Störungen führen können. Nebenwirkungen sind so z.B. Störungen des Magen-Darm–Trakts und erhöhtes Risiko von Gallenstein– und Nierensteinbildung. Störung des Vitamin– und Mineralstoffhaushaltes und Kaliumverlust können sogar zu lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen führen. Weitere Folgen von Diäten und gezügeltem Essverhalten können u.a. Nervosität, Konzentrationsstörungen, Verlust des sexuellen Interesses, Schlaflosigkeit, Depressionen, Ermüdung, sozialer Rückzug, Stimmungsschwankungen und der Einstieg in manifeste Essstörungen sein.[235]
- Abführmittel, Appetitzügler, Entwässerungstabletten und andere Schlankheitspillen ebenfalls zu massiven körperlichen und psychischen Problemen führen können und süchtig machen.[236]
- angebotene zucker– bzw. fettreduzierte Lebensmittel kontraproduktiv sind, weil sich nur eine Kurzeitsättigung einstellt, mit einem kurz darauf folgenden Hungergefühl. Leichtesser können deshalb schnell zu Mehressern werden.
- die Bezeichnungen „leicht“, „light“, „Bio“ oder „Slim“ nicht gesetzlich geregelt oder geschützt und meist nur sehr teuer sind, und welche Einnahmequellen die Industrie mit dem Konsum von Diätprodukten hat.[237]
- die einzige Möglichkeit längerfristig abzunehmen eine vollwertige Ernährung verbunden mit ausreichender Bewegung ist.[238]
Neben der Aufklärung über die Gefahren und Unsinn von Diäten sollten auch Perspektiven aufgezeigt werden, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Wie in 8.7 erwähnt, kann sich die klassische Ernährungsinformation allerdings auch problematisch auf das Essverhalten auswirken. Deshalb ist es wichtig, Jugendlichen zu vermitteln, was gut tut und gesund ist und nicht, welche Lebensmittel wie viel Kalorien enthalten oder Dickmacher sind. Weil ein gesundes Ernährungsverhalten meist nicht durch bloße Information angeeignet wird, könnten regelmäßige Aktionen in Schulen oder Jugendeinrichtungen wie z.B. „Gemeinsames Schmausen“ dazu beitragen, ein gesundes Ernährungsverhalten zu verinnerlichen.[239] Da Eltern im Hinblick auf Ernährungsverhalten und Diät–halten häufig Vorbilder für Jugendliche sind (vgl. 6.6), ergibt sich auch hier eine Notwendigkeit von aufklärenden und informativen Maßnahmen.
10.3.3 Sexualpädagogische Mädchenarbeit
Grundsätzlich kann die klassische Mädchenarbeit nicht mit sexualpädagogischer Mädchenarbeit gleichgesetzt werden, trotzdem gehören Fragen zur Sexualität, Körper, Liebe und Partnerschaft, Rollen etc. auch zum Inhalt von Mädchenarbeit. Sexualpädagogische Arbeit gehört somit zum Alltag einer pädagogischen Einrichtung und wird nicht mehr ausschließlich durch klassische Gruppenarbeit praktiziert.[240]
Sexualpädagogische Arbeit und Aufklärung als integrativer Bestandteil der Gesundheitsförderung arbeitet somit stärke– und ressourcenorientiert, um gesundheitsschützende Aspekte wie Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und ein damit verbundenes positives Körper– bzw. Selbstbild zu fördern.[241] Die Aufgabe der sexualpädagogischen Mädchenarbeit besteht im Wesentlichen darin, Mädchen schon früh positive Erfahrungen im Hinblick auf ihr Selbstwertgefühl zu ermöglichen, damit sie nicht von gängigen Schönheitsnormen abhängig werden.
Nach der Fachtagung zur sexualpädagogischen Mädchenarbeit der BZgA gilt es deshalb, soziale und personale Faktoren wie die Beziehung zu sich selbst, soziale Einbindung (beste Freundin, Clique), persönliche Leistungen und Fähigkeiten (auch in schulischer oder beruflicher Hinsicht) und Freude an Bewegung, zu fördern.[242] Geeignete Bewegungsformen und Sportarten sind hierbei günstig, um sowohl soziale Beziehungen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, als auch einen positiven Zugang zum eigenen Körper zu erlangen. Wichtig ist, die Bewegungsaktivitäten nicht leistungsorientiert zu gestalten, sondern Spaß und Geselligkeit in den Vordergrund zu stellen. Gleichzeitig sollten Mädchen die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen Bewegungsfeldern zu wechseln und frei auszuwählen. Besonders wichtig ist bei adoleszenten Mädchen, dass sie sich in einem ungestörten Raum bewegen können, um vor Blicken und Kommentaren geschützt zu sein. Neben Bewegungsangeboten wie Massagen, Entspannungsübungen etc. sollten auch selbstwertsteigernde Erfahrungen in Bereichen Abenteuer, Mut und Risiko ermöglicht werden. Erlebnispädagogische Maßnahmen und Selbstverteidigungskurse können einen geeigneten Rahmen bieten, um mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und eine positive Körpererfahrung zu fördern, sowie ein gemeinschaftliches Handeln und Umgang mit Konfliktsituationen zu erlernen.[243]
Die Sexualpädagogik im aufklärerischen Sinne bietet insgesamt ein breites Spektrum an Methoden, um personale und soziale Kompetenzen zu stärken, einen positiven Zugang zu sich selbst zu finden und vermittelte Werte, Normen und Rollenbilder kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren. Auch die Wirkung von „Äußerlichkeiten und Bildern“ wird mittlerweile in der Sexualpädagogik durch geeignete Methoden angesprochen. Jugendliche können sich hier über bestimmte Vorlieben und Faszinationen an Äußerlichkeiten austauschen und reflektieren, inwieweit das Aussehen beim Kennenlernen oder in einer Partnerschaft wichtig ist. Sich mit Klischees, unterschiedlichen Haltungen und Ansichten bezüglich des Äußeren auseinander zu setzen und die Wirkung von Werbebildern zu hinterfragen, gehört hier ebenso dazu, wie das Erkennen von Industrienormen und –interessen.[244] In diesem Zusammenhang können die eben genannten Methoden der Medienpädagogik auch gleichzeitig die Methoden der Sexualpädagogik sein.
Nach Ergebnissen der Fachtagung zur sexualpädagogischen Mädchenarbeit der BZgA sollten bei der Körper– und Sexualaufklärung allerdings folgende Inhalte besonders thematisiert werden, um die Erreichung eines positiven Körperbildes zu fördern:
Wie bereits betrachtet, rufen die körperlichen Veränderungen in der Pubertät meist ein Gefühl von Unsicherheit, Scham und Angst hervor und müssen erst in ein neues Körperbild integriert werden. Während sich das Heranwachsen der Körperformen kontinuierlich und über einen längeren Zeitraum erstreckt, kommt der ersten Regelblutung eine besondere Bedeutung zu. Als schlagartig und unübersehbar eintretendes Ereignis signalisiert sie die Geschlechtsreife und das Verschwinden des kindlichen Körpers eindeutig und wird deshalb häufig als einschneidendes Erlebnis, begleitet von starken Gefühlen der Unsicherheit und Erschütterung wahrgenommen. Da die erste Regelblutung der Töchter häufig auch bei den Müttern ambivalente und verunsichernde Gefühle hervorruft, wird eine sensible Aufklärung über die Regelblutung und die damit verbundenen Empfindungen häufig ignoriert und auf das Hygieneproblem reduziert. Tabuisierung und damit verbundene Unwissenheit führt deshalb häufig dazu, dass die Menstruation als etwas „schmutziges“ und als „Schwachstelle“ des weiblichen Körpers wahrgenommen und auch so in das Körpererleben integriert wird. Eine lustvolle Aneignung und Akzeptanz des eigenen Körpers wird somit verhindert. Durch sexualpädagogische Methoden sollte Mädchen deshalb Raum geboten werden, um sich mit den einerseits als „bedrohlich“ als auch „lustvoll“ erlebten körperlichen Veränderungen auseinander zusetzen und auszutauschen. Damit das „Zur –Frau – Werden“ zum freudigen Anlass und nicht als erschreckend erlebt wird und somit die erste Regelblutung als eine positive Besetzung von Weiblichkeit und als Quelle von Potenz und Kraft der eigenen Körperlichkeit und Sexualität wahrgenommen wird, müssen Menstruationsmythen aufgedeckt, körperliche Vorgänge erklärt und vor allem damit einhergehende Lustgefühle thematisiert werden.[245]
Gleichzeitig müssen die mit der körperlichen Reife einhergehenden Verunsicherungen und Selbstzweifel im Hinblick auf Beziehungen und Sexualität zum anderen Geschlecht ernst genommen werden. Um den heranwachsenden Körper nicht als „fehlerhaft“ zu erleben, sollte in diesem Zusammenhang vermittelt werden, dass sexuelle Körperlust erst durch probieren und üben entdeckt werden kann. Weil die Ursache der geringen Masturbationsrate von Mädchen in einer Abwertung von Weiblichkeit zu suchen ist, sollte auch die sexuelle Beziehung zu sich selbst bzw. Entdeckung des eigenen Körpers zur Sprache kommen.[246]
Sexualpädagogische Mädchenarbeit kann sich in diesem Sinne unterstützend und förderlich auf die Beziehung zum weiblichen Körper auswirken. Wenn Mädchen wissen, dass sie richtig sind so wie sie sind, genügend emotionale Unterstützung als auch Bestätigung ihres Selbst bekommen, sie sozial eingebunden sind und ihnen Raum gegeben wird, ihren Körper kennen zu lernen, sind die grundlegenden Aspekte für ein positives Selbst– und Körperbild erfüllt. Nach dem Motto „Wissen ist Macht“ sind Aufklärungsmaßnahmen und Förderung der Reflexions– und Kritikfähigkeit gegenüber medialen Bildern unabdingbar, um eine Koppelung von Lebenszufriedenheit und Schönheitskult aufzuheben.
11. Resümee
Schönheitsideale gab es in allen Zeiten der Menschheitsgeschichte. Wie eingangs erwähnt gehört ein Verschönerungsbedürfnis zum Menschen und ist zeitlos und überdauernd. Wir haben einen Sinn für Schönheit. Sei es bei der Wahrnehmung eines schönen Menschen, Tieren, Blumen und allem anderen was die Sinne erfreuen und das Herz höher schlagen lässt. Doch wir leben im Zeitalter der hässlichen Schönheit. Während zahlreiche Umweltkatastrophen die Natur vernichten, und uns so ein Teil der Schönheit genommen wird, zerstört sich der Mensch zudem noch selbst. Die Freude an Schönheit und an der Verschönerung ist zu einem Zwang geworden, indem menschliche Werte an die Oberfläche transformiert werden, und das Sein vom äußeren Schein zunehmend ersetzt wird. Die im sechsten Kapitel dargestellten technischen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen der westlichen Industriegesellschaft haben hierbei einen entscheidenden Teil dazu beigetragen. Während der Massenkonsum und die Überflussgesellschaft Äußerlichkeiten zu einem essentiellen Wert werden lässt, wird durch den technisch–industriellen Fortschritt die überdauernde Funktions– und Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers zu einem utopischen Kriterium erhoben. Damit wird der Mensch selbst zur machbaren Maschine. Das Vertrauen in den menschlichen Fortschritt und der Massenkonsum lässt zudem die Wichtigkeit gemeinschaftlicher Traditionen und Religionen verblassen. Die Hülle des Menschen wird so zum neuen verbindlichen Wert und zu seiner Identität. Weil der Schönheitskult mehr Einfluss auf das weibliche Geschlecht ausübt, was durch zahlreiche Studien und Erhebungen belegt worden ist, musste auch der feministischen Sichtweise und der weiblichen Sozialisation erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Während die Bedeutung von Schönheit als Element von Weiblichkeit in der feministischen Theorie als neue Erfindung politischer und wirtschaftlicher Institutionen gilt, ist bei der weiblichen Sozialisation eine gesellschaftlich tradierte und kulturell verankerte Verbindung von Schönheit und Weiblichkeit immer noch feststellbar. Zudem fördert dich typisch weibliche Sozialisation ein mangelndes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, was die Bedeutung des weiblichen Körpers als wichtigen Faktor der Lebensgestaltung nach sich zieht.
All diese gesellschaftlichen Mechanismen und Veränderungen finden Ausdruck in den Massemedien und wirken so auf jeden Einzelnen ein.
Als technische Kontrollfunktion, Sozialisationsinstanz und essentiellem Wirkungsfaktor für finanzielle und wirtschaftliche Interessen verbreiten sie imperativisch das genormte, idealistische Körperkonzept und somit die neuen verbindlichen Werte von Schönheit, Schlankheit und Jugend. Die in Kapitel 7 aufgeführten, verankerten Prozesse, welche menschliche Schönheit mit positiven Eigenschaften assoziieren lässt und ihre Wirkweise im Verhalten Anderer und in der sozialen Realität erzeugt, werden durch die massenmediale Verbreitung des Schönheitswertes in ihrer Bedeutung unterstrichen. Verbindliche gesellschaftliche Werte finden so zunehmend Ausdruck im körperlichen Erscheinungsbild. Dementsprechend werden Schlankheit, Muskeln, Jugend und vermeintliche Natürlichkeit zum Sinnbild für Disziplin, Erfolg und Prestige. Die Schönheitschirurgie stellt dabei den letzten Rettungsanker dar, diese Werte zu erreichen. Dem Eingreifen in den menschlichen Körper werden infolgedessen keine Grenzen mehr gesetzt. Er ist somit auf dem „Höhepunkt“ seiner „Machbarkeit“ und Figur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Warenwertes. Die ständige Konfrontation mit normierten Schönheitsidealen, deren Assoziation mit verbindlichen Werten und die Betonung der Eigenverantwortung für gutes oder schlechtes Aussehen haben, wie in Kapitel 9 dargestellt, nicht nur eine technische Umgestaltung des Körpers zur Folge, sondern beeinflussen das Seelenleben und das Verhalten in erheblichem Maße. Die Schönheitsnorm verhindert, dass gerade pubertierende Mädchen, welche durch die anstehenden Entwicklungsaufgaben und körperliche Veränderungen eigentlich gesellschaftliche Unterstützung und positive, differenzierte Vorbilder zur Orientierung benötigen würden, ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufbauen. Die daraus resultierende Verinnerlichung von Schönheit als Wert für Liebe und Anerkennung verhindert somit den Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls und zieht psychisch und soziale Probleme nach sich.
Die Notwendigkeit eines Handlungsauftrages der sozialen Arbeit ergabt sich aus den psychosozialen Folgen und Problemen, welche in Kapitel 9 dargestellt wurden. Die eingehende Beschäftigung mit dem Thema Schönheitskult hat die eigentliche Brisanz aufgezeigt, weil sich einige Zentralen der Gesundheitsförderung mit diesem Thema beschäftigen und die Notwendigkeit präventiver und aufklärender Maßnahmen betonen, und zwar nicht nur im Hinblick auf Essstörungen. Medienpädagogische, gesundheitsaufklärende und sexualpädagogische Maßnahmen und Methoden können einen entscheidenden Teil dazu beitragen, dass Jugendliche nötige Handlungskompetenzen und Selbstbewusstsein entwickeln können, und somit nicht von genormten Schönheitsidealen abhängig werden.
Allerdings ist es fast nicht möglich, sich den gesellschaftlich erwünschten Werten wie Schönheit und Schlankheit zu entziehen. Da in der gesamten Diplomarbeit ersichtlich wurden, dass alle möglichen Industriezweige, welche durch Werbung und Medien ihre Interessen transportieren die Produzenten der heutigen unerreichbaren Ideale sind, um beste wirtschaftliche Erfolge zu erzielen, müssten sich das Marketing dieser Systeme ändern.
Politisches Engagement könnte dazu beitragen, eine Vernetzung und Verständigung von Schönheitsindustrie, Werbeagenturen und Einrichtungen der Gesundheitsförderung und Jugend– bzw. Mädchenarbeit herzustellen, damit realistische und vor allem differenzierte Frauen– und Männerbilder geschaffen werden, welche eine positive, individuelle Identifikation zulassen könnten. Ebenfalls wären verbindliche gesetzliche Regelungen und Bestimmungen im Hinblick auf Schlankheits– und Diätprodukte dringend notwendig.
Letztendlich ließ sich feststellen, dass Schönheitskult unserer Industriegesellschaft zu allem anderen führt als zu Schönheit. Je mehr Menschen von Äußerlichkeiten abhängig werden, desto mehr erkranken sie „innerlich“. Der Kult um die Schönheit wirkt dem eigentlichen Verständnis von Schönheit, nämlich dem Gleichgewicht und der Harmonie der Teile, entgegen.
12. Quellenverzeichnis
Aliabadi, Christiane; Lehning, Wolfgang: Wenn Essen zur Sucht wird, 2. Aufl., München:
Kösel Vlg., 1990
Assunto, Rosario: Die Theorie des Schönen im Mittlealter, 2. Aufl., Köln: Dumont Vlg.,
1996
Bancroft, John: Grundlagen und Probleme Menschlicher Sexualität, Stuttgart: Enke Vlg.,
1985
Becker, Kuni: „Wenn ich erst mal schlank bin...“, in: Psychologie heute Spezial 04/1992, S. 80-85
Bierhoff, Hans Werner: Personenwahrnehmung – Vom ersten Eindruck zur sozialen Interaktion, Lehr– und Forschungstexte Psychologie Vol. 20, Berlin/Heidelberg u.a.: Springer-Vlg., 1986
Bodamer, Joachim: Vertrauen zu sich selbst – Menschsein im technischen Zeitalter, 2. Aufl.,Freiburg im Breisgau: Herderbücherei Band 541, 1975
Boeger, Anette: Das Körperbild im Jugendalter – Eine geschlechtsspezifische Betrachtung unter entwicklungspsychologischer und klinischer Perspektive, in: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Dokumentation der Fachtagung zur Sexualpädagogischen Mädchenarbeit – „meineSache“ – Mädchen gehen ihren Weg, am 19.-21. Juni 2000, S. 48-52
Böhme, Gernot: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht – Darmstädter Vorlesung, neue Folge Band 301, Frankfurt am Main: Suhrkamp Vlg., 1985
Brockhaus: Die Enzyklopädie 20., Bd. 19, überarbeitete Aufl., Mannheim/Leipzig: F.A. Brockhaus, 1996
Brownmiller, Susan: Weiblichkeit, Frankfurt am Main: S. Fischer Vlg., 1984
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Kompetent, authentische und normal? Aufklärungsrelevante Gesundheitsprobleme, Sexualaufklärung und Beratung von Jungen, Forschung und Praxis der Sexualaufklärung und Familienplanung , Bd. 14, Köln 1998
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Forum Sexualaufklärung und Familienplanung – Mädchen und Frauen 03/2000 unter: www.BZgA.de, letzter Zugriff am 08.04.03
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Schriftliche Stellungnahme zum Sachverständigenhearing des Ausschlusses für Gesundheit im Deutschen Bundestag am 2. März 2001, Themenfeld Frauen und Gesundheit unter:
www.zweiwochendienst.de/Gesundheit/0782c.htm, letzter Zugriff am 08.04.03
Chapkis, Wendy: Schönheitsgeheimnisse – Schönheitspolitik, 1. Aufl., Berlin: Orlanda Frauenverlag, 1986
Cramer, Friedrich: Das Schöne, das Schreckliche und das Erhabene – Eine chaotische Betrachtung des lebendigen Formprinzips, in: Bien, Günther; Gil, Thomas; Wilke Joachim (Hrsg.): Natur im Umbruch – Zur Diskussion des Naturbegriffs in Philosphie, Naturwissenschaften und Kunsttheorie, Stuttgart – Bad Cannstatt: Frommann Vlg., 1994
Damkowski, Christa: Schönheitsfabrik, in: Psychologie heute Spezial 04/1992, S. 27
Deuser, Karin; Gläser, Elisabeth; Köppe, Daniela: 96-60-90 - Zwischen Schönheit und Wahn- Das Buch zum Schlankheitskult, Berlin: Zyankrise Vlg., 1995
Doczi, György: Die Kraft der Grenzen - Harmonische Proportionen in Natur, Kunst und Architektur, Glonn: Capricorn Vlg., 1987
Dowling, Colette: Der Cinderella Komplex - Die heimliche Angst der Frauen vor der Unabhängigkeit, Frankfurt am Main: Fischer Vlg. 1982, 1991
Drolshagen, Ebba D.: Wir wollen was wir wollen sollen - Ein Gespräch mit Ebba Drolshagen, in: Psychologie heute Spezial 04/1992, S. 6-13
Drolshagen, Ebba D.: Des Körpers neue Kleider - Die Herstellung weiblicher Schönheit, Frankfurt am Main: Fischer Vlg., 1995
Dörrzapf, Reinhold: Eros, Ehe, Hosenbeutel - Eine Kulturgeschichte der Geschlechterbeziehungen, Frankfurt am Main: Eichborn Vlg., 1995
Duden: Das Herkunftswörterlexikon - Eine Etymologie der Deutschen Sprache, Band 7, Mannheim/Wien u.a.: Meyers Lexikonverlag, Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, 1963
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus: Ernst Haeckel – Der Künstler im Wissenschaftler, in: Häckel, Ernst, Kunstformen der Natur, München/ New York: Prestel Vlg., 1998, S. 19-30
Etcoff, Nancy: Nur die Schönsten überleben - Die Ästhetik des Menschen, München: Diederichs Vlg., 1999
Flaake, Karin: Zur Frau werden, in: Psychologie heute Spezial 04/1992, S. 98-101
Flaake, Karin; King, Vera: Weibliche Adoleszenz – Zur Sozialisation junger Frauen, 2. Aufl., Frankfurt am Main/New York: Campus Vlg.,1993
Flaake, Karin: Körperlichkeit und Sexualität in der weiblichen Adoleszenz, in: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Dokumentation der Fachtagung zur Sexualpädagogischen Mädchenarbeit – „meineSache“ – Mädchen gehen ihren Weg, am 19.-21. Juni 2000, S. 53-59
Freedman, Rita: Die Opfer der Venus - Vom Zwang, schön zu sein, 1. Aufl., Zürich: Kreuz Vlg., 1989
Gerhardinger, Günter: Vorlesungsskript „Medizinische Prävention“ SS 01
Gerlinghoff, Monika: Magersüchtig, 4. Aufl., 18.-22. Tsd., München: Piper Vlg., 1992
Gossmann, Ulla: Sind Sie ganz sauber? Körperkult als Seifenoper, in: Psychologie heute 08/1996, S. 64-67
Gottschlach, Wilfired: Narziß und Ödipus – Anwendung der Narzissmustheorie auf soziale Konflikte, Heidelberg: Asanger Vlg.,1988
Gross, Peter: Körperkult – Die Anbetung des Fleisches, in: Psychologie heute 12/2000, S. 28-35
Helfferich, Cornelia: Jugend, Körper und Geschlecht – Die Suche nach sexueller Identität. Opladen: Leske + Budrich, 1994
Henss, Ronald: Gesicht und Persönlichkeitseindruck, Schriftreihe: Lehr– und Forschungstexte Psychologie, Göttingen/ Bern u.a.: Hogrefe, Verlag für Psychologie 1998
Henss, Ronald: „Spieglein, Spieglein an der Wand“ – Geschlecht, Alter und physische Attraktivität, Weinheim/Saarbrücken: Beltz Psychologie Verlags Union, 1992
Holler-Nowitzki, Birgit: Psychosomatische Beschwerden im Jugendalter – Schulische Belastungen, Zukunftsangst und Stressreaktionen, Gesundheitsforschung,
Weinheim/ München: Juventa Vlg., 1994
Kanning, Uwe Peter: Die Psychologie der Personenbeurteilung, Göttingen/Bern u.a.: Hogrefe, Verlag für Psychologie, 1999
Kluge, Norbert u. a.: Studien zur Sexualpädagogik – Körper und Schönheit als soziale Leitbilder, Band 13, Frankfurt am Main: Peter Lang - Europäischer Verlag der Wissenschaft, 1999
Liepmann, Detlev; Arne Stiksrud: Entwicklungsaufgaben und Bewältigungsprobleme in der Adoleszenz – Sozial– und entwicklungspsychologische Perspektiven, Göttingen/Toronto u.a.: Hogrefe, Verlag für Psychologie, 1985
Luca, Renate: Medien und weibliche Identitätsbildung – Körper, Sexualität und Begehren in Selbst– und Fremdbildern junger Frauen, Frankfurt am Main: Campus Vlg., 1998
Mainzer Rheinzeitung: Schlankheitswahn hat seinen Preis – Fachtagung der Landeszentrale für Gesundheitsförderung, Ausgabe 31.03./01.04.2001, Verfasserin: Isabelle Wolf, Rubrik: Vereine Mainz & Rheinhessen, unter:
www.passe-partout.de/docs_de/qufit4d.htm, letzter Zugriff am 08.04.03
McCoy, Kathy; Wibbelsman, Charles: Mein Körper und ich – Teenager, Deutsche Erstveröffentlichung, München: Wilhelm Heyne Vlg., 1982
Milhoffer, Petra: Wie sie sich fühlen, was sie sich wünschen – Eine empirische Studie über Mädchen und Jungen auf dem Weg in die Pubertät, Geschlechterforschung, Weinheim/ München: Juventa Vlg., 2000.
Miller, Geoffrey F: Die sexuelle Evolution – Partnerwahl und die Entstehung des Geistes, Heidelberg/Berlin: Spektrum Akademischer Vlg., 2001
Minker, Margaret: Selbstwert statt Marktwert – Sich schön fühlen und selbstbewusster werden, München: Gräfe und Unzer Vlg. GmbH, 1996
Neue Züricher Zeitung: o. A., Europäische Schönheitsideale in China, Artikel vom 11.02.2002 unter www.nzz.ch/2002/02/11/al/page-article7Y00P.html, letzter Zugriff am 08.04.03
Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales: Dokumentation 2001 – Nudeldicker Hansel, spannenlange Dirn – Fachtagung zur Prävention von Ess-störungen am 6. März 2001 in Hannover, unter:
www.uni-leipzig.de/essstoerungen/nudeldicker.pdf, letzter Zugriff am 08.04.03
Nuber, Ursula: Mächen – Immer noch zuviel Anpassung, in : Psychologie heute 04/1992 S. 66-71
Philipps, Ina-Maria: Zusammenfassung und Diskussion, in: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Dokumentation der Fachtagung zur Sexualpädagogischen Mädchenarbeit – „meineSache“ – Mädchen gehen ihren Weg, am 19.-21. Juni 2000, S. 78-81
Piel, Edgar: Eine Allensbach-Umfrage für den Deutschen Studienpreis, in: Gero von Randow (Hrsg.): Wie viel Körper braucht der Mensch? Standpunkt zur Debatte für den Deutschen Studienpreis, Hamburg: Körper-Stiftung, 2001. Auch unter
www.stiftung.koerber.de/wettbewerbe/studienpreis/presse/index.html
Pfannenschwarz, Christl: Schön und gut, aber: Was heißt eigentlich „schön“? in: Psychologie heute Spezial 04/1992, S. 36-43
Posch, Waltraud: Körper machen Leute – Der Kult um die Schönheit, Frankfurt am Main: Campus Vlg., 1999
Preiser, Siegried: Personenwahrnehmung und Beurteilung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979
Psychologie heute: (o.A.), Verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers, 05/1999, S. 14
Redler, Elisabeth: Der Körper als Medium zur Welt – Eine Annäherung von außen: Schönheit und Gesundheit, Frankfurt am Main: Mabuse- Vlg., 1994
Redler, Elisabeth: Skript zum Vortag: „Ja sagen. Schönheit, Gesundheit und Lebenskunst“ an der Georg-von-Vollmar-Akademie, Kochel, 01.03.2001 im Seminar „Schönheit ist Macht: in Beruf, Politik und Medien“
Rodin, Judith: Die Körper-Falle, in: Psychologie heute 07/1993, S. 20-25
Röhl, Klaus Rainer: Die verteufelte Lust – Die Geschichte der Prüderie und die Unterdrückung der Frau, Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, 1983
Rose, Lotte: „Das Kampffeld ist der Körper“ in: Psychologie heute 11/1992, S. 66-70
Schneider, Sylvia: Schönheit: Letztes Mittel gegen die Emanzipation? in: Psychologie heute Spezial 04/1992, S. 52-57
Scholz, Renate: Änderungsschneiderei, in: Psychologie heute Spezial 04/1992, S. 22-28
Schüler 2002. Körper. Friedrich Verlag, Pädagogische Zeitschrift in Zusammenarbeit mit Klett
Siebel, Hiltrud: Mädchen- und Frauenzeitschriften in der Schule – Ideen und Erfahrungen, unter: www.stiftunglesen.de/aktuell/zeitschr/08_Kapitel6.pdf, letzter Zugriff am 08.04.03
Sielert, Uwe; Keil, Siegfried u.a.: Sexualpädagogische Materialien für die Jugendarbeit in Freizeit und Schule, Weinheim/Basel. Beltz Vlg., 1993
Stock, Walter: Mythos Schönheit in Film – Literatur – Musik – Werbung – Körperkult unter dem Diktat der Medien, Filmwochenende Nov. 97 in Marktbreit ( bei Würzburg)
Voss, Anja: Schön (eigen)artig sein! Mädchen und junge Frauen zwischen Körperlust und Körperfrust im organisierten Sport! Praktische Ansätze mädchenorientierter Vereins- und Verbandsjugendarbeit der Sportjugend NW, in: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Dokumentation der Fachtagung zur Sexualpädagogischen Mädchenarbeit – „meineSache“ – Mädchen gehen ihren Weg, am 19.-21. Juni 2000, S. 73-77
Wardetzki, Bärbel: Spieglein, Spieglein an der Wand...oder: Wer wird Opfer des Schönheitskultes? in: Psychologie heute Spezial 04/1992, S. 44-47
Wellhöfer, Peter R.: Grundstudium Sozialpsychologie – Für Sozialberufe, Psychologen und Soziologen, 2., völlig überarbeitet Aufl., Stuttgart: Ferdinand Enke Vlg., 1988
Wilser, Anja; Preiß, Dagmar: Schönheitsideale zwischen Standards und Individualitätsansprüchen, in: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Dokumentation der Fachtagung zur Sexualpädagogischen Mädchenarbeit – „meineSache“ – Mädchen gehen ihren Weg, am 19.-21. Juni 2000, S. 67-72
Wolf, Naomi: Der Mythos Schönheit, 1. Aufl., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1991
Wolfrum, Christine; Papenfuss Heike: Wenn die Seele nicht satt wird – Wege aus Magersucht und Bulimie, 1. Aufl., Düsseldorf: Patmos Vlg., 1993
Zauner, Johann: Psychosomatische Aspekte der Adoleszenz, in: Zauner, Johann; Biermann, Gerd ( Hrsg.): Klinische Psychosomatik von Kindern und Jugendlichen – Beiträge zur Psychologie und Soziologie des kranken Menschen 5, München/Basel: Ernst Reinhardt Vlg. 1986, S. 10-22
www.media.brigitte.de: Was bedeutet ihnen Schönheit? Studien, Erscheinungsjahr 2002, letzter Zugriff am 08.04.03
www.presse.dak.de: (o.A.) „Verflixte Schönheit“ – eine Erlebnis–Ausstellung über Lust und Last des Schönseins, Archiv, Erscheinungsdatum 19.11.96, letzter Zugriff am 08.04.03
13. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14. Eidesstattliche Erklärung
Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt wurde, keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche oder sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet wurden.
Melanie Zöbinger
[...]
[1] vgl. Etcoff, S. 22ff.
[2] vgl. Doczi, S. 111; Cramer, S. 270
[3] vgl. Etcoff, S. 159
[4] vgl. Doczi, S. 111
[5] vgl. Etcoff, S. 160
[6] vgl. Cramer, S. 271ff.
[7] vgl. Etcoff, S. 160
[8] vgl. Cramer, S. 275f.
[9] vgl. Henss 1998, S. 55f.
[10] vgl. Freedman, S. 20
[11] vgl. Henss 1998, S. 56
[12] vgl. Etcoff, S. 162ff.
[13] vgl. Henss 1998, S. 57f.
[14] vgl. Etcoff, S. 165
[15] vgl. Henss 1998, S. 89
[16] vgl. Etcoff, S. 186
[17] vgl. Eibl-Eibesfeldt, S. 22f.
[18] vgl. Etcoff, S. 187
[19] vgl. Henss 1998, S. 59ff.
[20] vgl. Etcoff, S. 183 f.
[21] vgl. Henss 1998, S. 63ff.; Eibl-Eibesfeldt, S. 23.
[22] vgl. Etcoff, S.171, 28ff.
[23] vgl. Henss 1998, S. 75ff.
[24] vgl. Miller, S. 145ff.,127; Etcoff, S. 191ff., 32f.
[25] vgl. Henss 1998, S. 81ff.
[26] vgl. Etcoff, S. 32ff.,80ff.
[27] vgl. Henss 1998, S. 75f.,54
[28] vgl. Etcoff, S. 156
[29] Henss 1998, S. 53f., S. 88
[30] Etcoff, S. 157f.
[31] vgl. Henss 1998 ,S. 81ff.; Miller, S. 256
[32] vgl. Etcoff, S. 151ff., 31
[33] vgl. Freedman, S. 22
[34] S. ist in diesem Zitat eine Abkürzung für das „Schöne“
[35] vgl. Brownmiller, S. 15f.; Stock, S. 6
[36] vgl. Etcoff, S. 212
[37] vgl. Brownmiller, S. 15
[38] vgl. Dörrzapf, S. 212; Minker, S. 8
[39] vgl. Brownmiller, S. 29
[40] vgl. Stock, S. 6
[41] vgl. Dörrzapf, S. 228ff.
[42] vgl. Etcoff, S. 12,139
[43] vgl. Brownmiller, S. 30ff.; Stock, S. 7
[44] vgl. Wolf, S. 17
[45] vgl. Stock, S. 7; Brownmiller, S. 18, 33f.
[46] vgl. Drolshagen 1995, S. 97f.
[47] vgl. Brownmiller, S. 34
[48] vgl. Röhl, S. 274f.
[49] vgl. Brownmiller, S. 44; Drolshagen 1995, S. 98f.
[50] vgl. Stock, S. 7ff.
[51] vgl. Chapkis, S. 13
[52] vgl. Wolf, S. 91
[53] vgl. Drolshagen 1995, S. 100
[54] vgl. Stock, S. 9ff.; Minker, S. 10f.
[55] vgl. Wolf, S. 91
[56] vgl. Drolshagen 1995, S. 125
[57] vgl. Minker, S. 11
[58] vgl. Etcoff, S. 253
[59] vgl Stock, S. 10
[60] vgl. Bodamer, S. 12ff.
[61] vgl. Posch, S. 28f.
[62] vgl. Bodamer, S. 18f.
[63] vgl. Posch, S. 28
[64] vgl. Bodamer, S. 18
[65] vgl. Posch, S. 176f.; Wolf, S. 396; Deuser, S. 20f.
[66] vlg. Freedman, S. 179
[67] vgl. Posch, S. 177
[68] vgl. Bodamer, S. 14.
[69] vgl. Kluge, S. 53, 97
[70] vgl. Bodamer, S. 28ff.
[71] vgl. ebd., S. 35ff.
[72] vgl. Böhme, S. 173f.
[73] vgl. Posch, S. 26
[74] vgl. Posch, S. 26f.
[75] vgl. Drolshagen 1995, S. 175
[76] vgl. Kahrmann in Stock, S. 107
[77] vgl. Posch, S. 100f.
[78] vgl. Kahrmann in Stock, S. 108
[79] vgl. Drolshagen 1995, S. 175, 217f.
[80] vgl. Posch, S. 101
[81] vgl. Drolshagen 1992, S. 8f.
[82] vgl. Posch, S. 101
[83] vgl. Gross, S. 28ff.
[84] vgl. Rodin, S. 22
[85] vgl. Schneider, S. 52f.; Wolf, S. 12ff.
[86] vgl. ebd., S. 16, 22, 96ff.
[87] vgl. Schneider, S. 53
[88] vgl. Drolshagen 1992, S. 9
[89] vgl. Posch, S. 69ff.; Rodin , S. 23
[90] vgl. Drolshagen 1992, S. 13; Drolshagen 1995, S. 23; Posch, S. 124
[91] vgl. Nuber, S. 66ff.
[92] vgl. Freedman, S. 25
[93] vgl. Posch, S. 83ff.
[94] vgl. Dowling, S.104ff.
[95] vgl. Nuber, S.68ff.
[96] vgl. Flaake 1992, S. 99
[97] vgl. Dowling, S. 113
[98] vgl. Helfferich, S.129
[99] vgl. Flaake 1992, S.100f.
[100] vgl. Posch, S.91f.; Flaake 1992, S.100f.
[101] vgl. Schüler 2002, S. 48, 42
[102] vgl. Posch, S.92ff.
[103] vgl. Rodin, S.22
[104] vgl. Posch, S. 94
[105] vgl. Etcoff, S. 49
[106] vgl. Duden. Das Herkunftswörterlexikon, S. 275
[107] vgl. Henss 1992, S. 88ff.
[108] vgl. Etcoff, S. 50
[109] vgl. Henss 1992, S. 91
[110] vgl. Etcoff, S. 53
[111] vgl. Preiser, S. 21
[112] vgl. Etcoff, S. 50ff.
[113] vgl. Kanning S. 208
[114] vgl. Henss 1992, S. 59
[115] vgl. Kanning, S. 204
[116] vgl. Wellhöfer, S. 114
[117] vgl. Kanning, S. 208; Henss 1992, S. 59ff.
[118] vgl. Etcoff, S. 44f.
[119] vgl. Pfannenschwarz, S. 39
[120] vgl. Etcoff, S. 59; Pfannenschwarz, S. 38
[121] vgl. Kanning, S. 208
[122] vgl. Etcoff, S. 54
[123] vgl. Kanning, S. 209
[124] vgl. Bierhoff, S. 297f.; Etcoff, S. 57; Pfannenschwarz, S. 40; Henss 1992, S. 80
[125] vgl. Bierhoff, S. 472
[126] vgl. Etcoff, S. 57; Bierhoff, S. 289f.; Henss 1992, S. 82f.; Pfannenschwarz, S. 40
[127] vgl. Kanning, S. 210; Pfannenschwarz, S. 40
[128] vgl. Etcoff, S. 60ff.
[129] vgl. Pfannenschwarz, S. 42; Henss 1992, S. 38f.
[130] vgl. Kluge, S. 53, 227
[131] vgl. Henss 1992, S. 56ff.
[132] vgl. Kannig, S. 209f.
[133] vgl. Pfannenschwarz, S. 42f.
[134] vlg. Kluge, S. 54,155,138,94,228,104
[135] vgl. Kanning, S. 209; Pfannenschwarz, S. 41f.
[136] vlg. Etcoff, S. 97f.
[137] vgl. www.media.birgitte.de
[138] vgl. Gerlinghoff, S. 9f.; Aliabadi/Lehning, S. 16
[139] vgl. Milhoffer, Tab. 36a u. 36b, S. 52
[140] vgl. Posch, S. 48
[141] vgl. Wolfrum/Papenfuss, S. 52ff.
[142] vgl. Aliabadi/Lehning, S. 16
[143] vgl. Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales, S.13
[144] vgl. Posch, S. 197,150
[145] vgl. Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales, S.13
[146] vgl. Becker, S. 80
[147] vgl. Posch, S. 191,156
[148] vlg. Becker, S. 80ff.
[149] vlg. Posch, S. 58
[150] vlg. Piel, Tab.5, S. 177
[151] vgl. Posch, S. 49ff.
[152] vgl. Freedman, S. 238
[153] vgl. Posch, S. 180f.
[154] vgl. www.media.birgitte.de
[155] vgl. Drolshagen 1995, S. 201
[156] vgl. Posch, S. 180
[157] vgl. ebd., S. 54ff.; Drolshagen 1995, S. 198ff.
[158] vgl. ebd., S. 185
[159] vgl. www.media.brigitte.de
[160] vgl. Piel, Tab.2, S. 174
[161] vlg. Drolshagen 1995, S. 35f., 42
[162] vgl. ebd., S. 44; Posch, S. 73
[163] vgl. Drolshagen 1995, S. 43f.
[164] vgl. Posch, S. 179
[165] vgl. ebd., S. 166
[166] vgl. Scholz, S. 23
[167] vgl. Mainzer Rheinzeitung
[168] vgl. Scholz, S. 24
[169] vgl. Mainzer Rheinzeitung
[170] vgl. Scholz, S. 23f.
[171] vgl. Mainzer Rheinzeitung
[172] vgl. Damkowski, S. 27
[173] vgl. Neue Züricher Zeitung
[174] vgl. Posch, S. 64
[175] vgl. Redler, 1994, S. 58
[176] vgl. Zauner, S. 20f.
[177] vgl. Redler 1994, S. 58f.
[178] vgl. Helfferich, S. 57
[179] vgl. Boeger, S. 48
[180] vgl. Zauner, S.20
[181] vgl. Entwicklungsaufgaben nach Havinghurst in Liepmann/Stiksrud, S. 59
[182] vgl. Boeger S. 48f.; Wilser/Preiß S. 67f.
[183] vgl. Psychologie heute 1999/05, S. 14
[184] vgl. Deuser, S. 104f.
[185] vgl. Wolf, S. 68
[186] vgl. Boeger, S. 52
[187] vgl. Psychologie heute, 1999/05, S. 14
[188] vgl. Boeger, S. 52
[189] vgl. Freedman S. 52
[190] vgl. Holler-Nowitzki, S. 72; Deuser, S. 105; Boeger, S. 52
[191] vgl. Milhoff, Tab. 36a, S. 52
[192] vgl. BZgA 1998, S. 226ff.
[193] vgl. Deuser, S. 105
[194] vgl. Freedman, S. 54f.
[195] vgl. Entwicklungsaufgaben nach Havinghurst in Liepmann/Stiksrud, S. 59
[196] vgl. Wilser/Preiß, S. 71; Posch, S.117ff.
[197] vgl. Freedman, S. 149f.
[198] vgl. Wardetzki, S. 44
[199] vgl. Freedman, S. 144 ff.
[200] vgl. Wardetzki, S. 44ff.
[201] vgl. Gottschalch, S. 50f.
[202] vgl. Luca, S. 115
[203] vgl. Bancoft, S. 224,227
[204] vgl. Luca, S. 115
[205] vgl. ebd,, S. 117ff.
[206] vgl. Posch, S. 131f.
[207] vgl. Deuser, S. 112
[208] vgl. Wilser/Preiß, S. 68
[209] vgl. Posch, S. 126f.; Deuser, S. 112f.
[210] vgl. Flaake 1993, S. 206ff.
[211] vgl. Deuser, S.113; Wolf, S. 102
[212] vgl. Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales, S. 11, 14
[213] vgl. ebd., S. 7,11
[214] vgl. ebd., S. 11,16f.
[215] vgl. ebd., S. 14
[216] vgl. Rose, S. 69
[217] vgl. Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales, S. 15ff.
[218] vgl. Deuser, S. 178f.
[219] vgl. Becker, S. 83ff.
[220] vgl. Deuser, S. 179
[221] vgl. Redler 1994, S. 28
[222] vgl. ebd., S. 25ff.
[223] vgl. Redler 2001, S. 1
[224] vgl. Redler 1994, S. 25ff.
[225] vgl. http://www.presse.dak.de
[226] vgl. Gerhardinger
[227] vgl. Philipps, S. 79
[228] vgl. BZgA 2001, S. 2
[229] vgl. BZgA 2001, S. 4
[230] vgl. Luca, S. 139
[231] vlg. Siebel, S. 20f.
[232] vgl. Luca, S. 140, 200, 217
[233] vgl. Deuser, S. 139
[234] vgl. ebd., S. 144f.
[235] vgl. ebd., S. 149; Posch, S. 155f.
[236] vgl. Deuser, S. 159
[237] vgl. ebd., S. 161f.
[238] vgl. ebd., S. 145
[239] vgl. Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales, S. 75f.
[240] vgl. BZgA 2000, S. 9f.
[241] vgl. BZgA 2001, S. 2
[242] vgl. Philipps, S. 79
[243] vgl. ebd., S. 80; Voss, S. 73
[244] vgl. Sielert, S. 168
[245] Flaake 2000, S. 53ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kanon der Schönheit?
Der Kanon der Schönheit erklärt Schönheit als eine Form, die sich durch Proportionen und Zahlen ausdrücken lässt. Faktoren wie Klarheit, Symmetrie, Harmonie und intensive Farbgebung spielen hierbei eine Rolle.
Wie lautet die Formel der Schönheit?
Die Formel der Schönheit basiert auf dem goldenen Schnitt oder der Zahl Phi, ein Proportionssystem, bei dem das Verhältnis des kleineren zum größeren Teil das gleiche ist, wie das des größeren Teils zum Gesamten. Dieses Verhältnis findet sich in vielen biologischen Formen, Architektur und menschlichen Körpern.
Was bedeutet Durchschnittlichkeit in Bezug auf Schönheit?
Die Attraktivitätsforschung hat gezeigt, dass Durchschnittsgesichter, also Gesichter, die den mathematischen Mittelwert einer Population entsprechen, oft als attraktiver wahrgenommen werden. Dies wird auf einen neuronalen Schaltkreis im Gehirn zurückgeführt, der für das Erkennen von Gesichtern zuständig ist.
Welche Rolle spielt Symmetrie bei der Definition von Schönheit?
Symmetrie wird von der Attraktivitätsforschung als Indikator menschlicher Attraktivität angesehen. Symmetrische Gesichter werden oft als attraktiver eingestuft, aber perfekt symmetrische Gesichter können unnatürlich wirken.
Was ist das „Kindchenschema“ in der Attraktivitätsforschung?
Das „Kindchenschema“ bezieht sich auf kindliche Merkmale eines Gesichts. Studien haben gezeigt, dass Gesichter mit kindlichen Zügen oft als attraktiver wahrgenommen werden.
Sind Schönheitsideale kulturell bedingt oder biologisch determiniert?
Die Frage, ob Schönheitsideale kulturell bedingt oder biologisch determiniert sind, ist umstritten. Die Evolutionspsychologie geht davon aus, dass die Attraktivität mit dem Fortpflanzungserfolg einer Spezies korreliert und somit biologische Aspekte eine Rolle spielen. Kulturelle Einflüsse überlagern jedoch die angeborenen Fähigkeiten, Schönheit zu erkennen.
Wie haben sich Schönheitsideale im Laufe der Geschichte gewandelt?
Schönheitsideale haben sich im Laufe der Geschichte stark verändert. Von der Betonung üppiger Formen in der Steinzeit bis zum Schlankheitswahn im Zeitalter der Medien spiegeln Schönheitsideale die jeweiligen Interessen und Wertmaßstäbe einer Epoche wider.
Welche Mechanismen tragen zur Entstehung des „Konzepts der neuen Körper“ bei?
Mehrere Mechanismen tragen zur Entstehung des Schönheitskults und des „Konzepts der neuen Körper“ bei, darunter die Konsum- und Überflussgesellschaft, die Technisierung des Körpers, der Einfluss der Medien, der Verlust von Religion und Tradition, feministische Sichtweisen und die Sozialisation des schönen Körpers.
Wie wirkt sich die Konsum- und Überflussgesellschaft auf das Schönheitsideal aus?
In der Konsum- und Überflussgesellschaft wird der Körper selbst zum Kapital. Schlankheit wird zum Ausdruck von Wohlstand und Erfolg. Menschen definieren sich über materielle Dinge und fallen Manipulation zum Opfer. Mode und Schönheit ändern sich schnell, um den Konsum anzukurbeln.
Welche Rolle spielen die Medien bei der Verbreitung von Schönheitsidealen?
Die Medien spielen eine zentrale Rolle bei der Verbreitung von Schönheitsidealen. Sie präsentieren stereotype Bilder von Schönheit und Erfolg, die die körperliche Selbstwahrnehmung erheblich beeinflussen. Das Authentische wird allmählich durch das Nicht-Authentische ersetzt.
Wie beeinflusst der Verlust von Religion und Tradition das Körperbild?
Der Verlust von Religion und Tradition führt dazu, dass der Körper selbst zum Unterscheidungskriterium wird. Das attraktive Äußere und der Aufwand, der betrieben wird, um dem perfekten Körperideal näher zu kommen, gelten als Ausdruck für eine erfolgreiche Lebensweise.
Welche Rolle spielt die feministische Sichtweise bei der Entstehung des Schönheitskults?
Nach feministischer Sichtweise wird der Kult um die weibliche Schönheit als "letztes Mittel gegen die Emanzipation" verstanden. Die Befreiung vom Kinder-Küche-Kirche-Zwang müsse demnach abgelöst werden von einem neuen Instrument der sozialen Kontrolle.
Wie werden Mädchen im Hinblick auf Schönheitsideale sozialisiert?
Mädchen und Jungen erfahren eine unterschiedliche, typisch männliche und typisch weibliche Erziehung. Mädchen werden eher in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrängt und bewerten ihr Selbstwertgefühl mehr von der äußerlichen Attraktivität abhängig.
Wie wirkt sich Schönheit als soziale Macht aus?
Schönheit übt eine soziale Macht aus. Attraktive Menschen werden oft positiver bewertet und bevorzugt behandelt. Dies kann sich in der Persönlichkeitsentwicklung, im Selbstbild und im sozialen und privaten Leben niederschlagen.
Welche Folgen und psychosozialen Probleme können durch den Schönheitskult entstehen?
Der Schönheitskult kann zu verzerrter Selbstwahrnehmung, negativem Körperbild, Rollenkonfusion, narzisstischen Störungen, Sexualitäts- und Partnerschaftsproblemen, Konkurrenzverhalten und Essstörungen führen.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die soziale Arbeit im Bezug auf den Schönheitskult?
Die soziale Arbeit sollte präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen anbieten, um einen kompetenten Umgang mit Schönheitsidealen und Werbebildern zu fördern, sowie die Stärkung von individuellen und sozialen Ressourcen.
Welche Präventionsmöglichkeiten gibt es?
Präventionsmöglichkeiten sind u.a. medienpädagogische Methoden wie die Analyse von Frauen- und Mädchenzeitschriften und die produktorientierte Medienpädagogik, gesundheitsaufklärende Maßnahmen und sexualpädagogische Mädchenarbeit.
Details
- Titel
- Das Konzept der neuen Körper - Macht und Zwang des Schönheitskults
- Hochschule
- Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg
- Note
- 1,3
- Autor
- Melanie Zöbinger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 100
- Katalognummer
- V111085
- ISBN (eBook)
- 9783640091867
- Dateigröße
- 659 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Konzept Körper Macht Zwang Schönheitskults
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Arbeit zitieren
- Melanie Zöbinger (Autor:in), 2003, Das Konzept der neuen Körper - Macht und Zwang des Schönheitskults, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/111085
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









