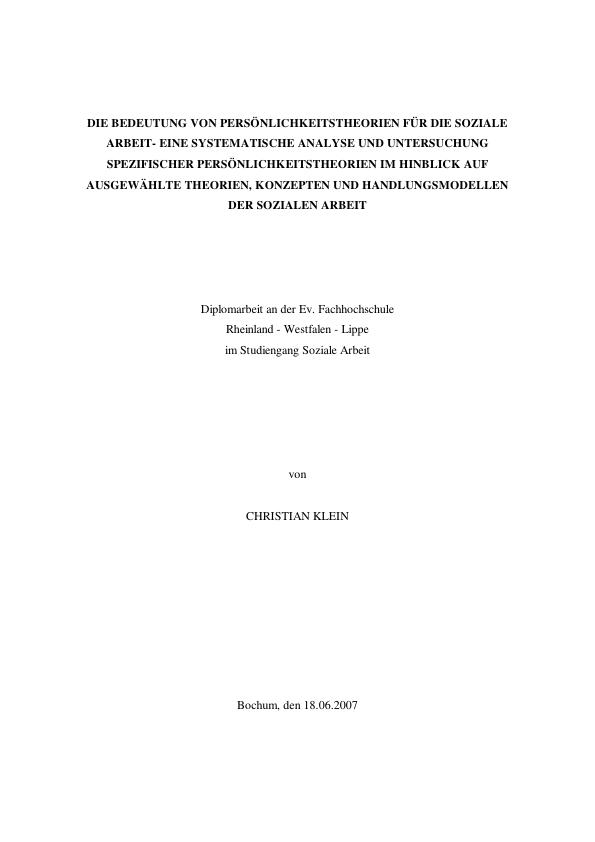Die Bedeutung von Persönlichkeitstheorien für die soziale Arbeit
Diplomarbeit, 2007
128 Seiten, Note: 1.0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Teil I: Die analytische Darstellung spezifischer Persönlichkeitstheorien
2.1 Psychodynamische Persönlichkeitstheorien
2.2 Die Persönlichkeitstheorie des Sigmund Freud (1856-1939)
2.2.1 Kurzbiographie
2.2.2 Struktur
2.2.3 Prozess
2.2.4 Wachstum und Entwicklung
2.2.5 Psychopathologie und Veränderung
2.2.6 Menschenbild
2.2.7 Auffassung von Wissenschaft, Theorie und Forschung
2.2.8 Bewertung und Einschätzung
2.3 Die Persönlichkeitstheorie des Alfred Adler (1870-1937)
2.3.1 Kurzbiographie
2.3.2 Grundbegriffe seiner Lehre
2.3.3 Das Menschenbild
2.3.4 Bewertung und Einschätzung
2.4 Die Persönlichkeitstheorie des C. G. Jung (1875-1961)
2.4.1 Kurzbiographie
2.4.2 Struktur
2.4.3 Prozess
2.4.4 Wachstum und Entwicklung
2.4.5 Psychopathologie und Veränderung
2.4.6 Menschenbild
2.4.7 Bewertung und Einschätzung
3. Lerntheoretische Persönlichkeitstheorien
3.1 Die Persönlichkeitstheorie des John B. Watson (1878-1958)
3.1.1 Biographie
3.1.2 Struktur
3.1.3 Prozess
3.1.4 Menschenbild
3.1.5 Auffassung von Wissenschaft, Theorie und Forschung
3.2 Die Persönlichkeitstheorie des B. F. Skinner (1904-1990)
3.2.1 Biographie
3.2.2 Struktur
3.2.3 Prozess
3.2.4 Wachstum und Entwicklung
3.2.5 Menschenbild
3.2.6 Auffassung von Wissenschaft, Theorie und Forschung
3.2.7 Bewertung und Einschätzung
4. Sozial-kognitive Lerntheorien
4.1 Die Persönlichkeitstheorie des Albert Bandura (*1925)
4.1.2 Biographie
4.1.3 Struktur
4.1.4 Prozess
4.1.5 Wachstum und Entwicklung
4.1.6 Menschenbild
4.1.7 Auffassung von Wissenschaft, Theorie und Forschung
4.2 Die Persönlichkeitstheorie des Walter Mischel (*1930)
4.2.1 Prozess: Kognitiv-affektives Verarbeitungssystem (CAPS)
4.2.2 Wachstum und Entwicklung
4.2.3 Psychopathologie und Veränderung
4.2.4 Bewertung und Einschätzung
5. Humanistische Persönlichkeitstheorien
5.1 Die Persönlichkeitstheorie des Carl R. Roger (1902- 1987)
5.1.1 Biographie
5.1.2 Struktur: Das Selbst, Ideal-Selbst
5.1.3 Prozess
5.1.4 Wachstum und Entwicklung
5.1.5 Psychopathologie und Veränderung
5.1.6 Auffassung von Wissenschaft, Theorie und Forschung
5.1.7 Menschenbild
5.1.8 Bewertung und Einschätzung
5.2 Die Persönlichkeitstheorie des Viktor E. Frankl (1905-1997)
5.2.1 Biographie
5.2.2 Schilderungen über das Konzentrationslager
5.2.3 Ausgangssituation
5.2.4 Ursachen des Sinnlosigkeitsgefühls
5.2.5 Kritik an Freud, Adler, Jung
5.2.6 Freiheit vs. Determinismus
5.2.7 Der Wille zum Sinn
5.2.8 Psychotherapie und Religion
5.2.9 Die Logotherapie
5.2.10 Menschenbild
5.2.11 Frankl und der Existenzialismus
5.2.12 Bewertung und Einschätzung
6. Teil II: Darstellung ausgewählter Methoden, Konzepte und Handlungsmodelle
6.1 Florence Hollis: Soziale Einzelhilfe als psychosoziale Behandlung
6.1.1 Allgemeine Einführung
6.1.2 Elemente der sozialen Einzelhilfe
6.1.3 Bewertung und Einschätzung
6.2 Helen Harris Perlman: Soziale Einzelhilfe als problemlösender Prozess
6.2.1 Allgemeine Einführung
6.2.2 Die Person
6.2.3 Das Problem
6.2.4 Der Prozess
6.2.5 Synoptische Nachbemerkung
6.2.6 Bewertung und Einschätzung
6.3 Germain; Gitterman: Das „Life Model“ der Sozialen Arbeit
6.3.1 Allgemeine Einführung
6.3.2 Elemente des „Life Models“
6.3.3 Bewertung und Einschätzung
6.4 Silvia Staub-Bernasconi: Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft
6.4.1 Jane Addams (1860 - 1935) - Systemtheoretikerin der ersten Stunde
6.4.2 Auffassung von Wissenschaft
6.4.3 Addams als Systemtheoretikerin
6.4.4 Soziale Arbeit als handlungswissenschaftliche Disziplin
6.4.5 Soziale Probleme als Gegenstand der Sozialen Arbeit
6.4.6 Entstehung sozialer Probleme
6.4.7 Werte und Ethik anhand der drei Paradigmen
6.4.8 Die Funktionen sozialer Arbeit anhand der Paradigmen
6.4.9 Das W-Fragen Modell und der transformative Dreischritt als zwei Komponenten einer normativen Handlungswissenschaft
6.4.10 Soziale Arbeit auf dem Weg zur Weltgesellschaft
6.4.11 Bewertung und Einschätzun
6.5 Heiko Kleve: Postmoderne Sozialarbeit
6.5.1 Ausgangspunkt
6.5.2 Die philosophischen Überlegungen Jean Francois Lyotards (1924 - 1998)
6.5.3 Auffassung von Sozialen Arbeit und deren Wissenschaft
6.5.4 Konsequenzen und Anwendungen in der Praxis: Mediation und Casemanagement
6.5.5 Bewertung und Einschätzung
6.6 Lutz Rössner: Ein kritisch-rationalistisches Modell
6.6.1 Ausgangspunkt
6.6.2 Wissenschaftsverständnis
6.6.3 Theorie der Sozialarbeit
6.6.4 Ausgangsüberlegungen für die Theorie und Praxis einer Sozialarbeit
6.6.5 Folgerungen für die Praxis
6.6.6 Ein kritisch-rationalistisches Modell: Eine kurze Erläuterung
6.6.7 Bewertung und Einschätzung
7. Ausblick
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Jeder Mensch hat sich wohl im Laufe seines Lebens schon mal die Frage gestellt, warum er eigentlich so ist, wie er ist. Fragen wie „Warum bin ich eigentlich gelegentlich deprimiert?“ oder „Wieso werde ich bei Rendezvous immer nervös, andere dagegen nicht?“, haben sich sicherlich schon viele Personen gestellt. Sind wir deswegen schon alle Persönlichkeitstheoretiker? In gewisser Hinsicht schon, denn wir alle haben unsere eigenen Ideen, Überzeugungen und Vorstellungen darüber, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 27). Dabei greifen wir im Unterschied zu Wissenschaftlern auf Alltagstheorien zurück, d. h. wir bemühen uns in der Regel nicht um eine systematische Formulierung, Überprüfung, logische Konsistenz und eine klare Terminologie, wenn es darum geht, Aussagen über die menschliche Natur zu machen (vgl. Flammer 2005: 12). Dies zeichnet aber genau den Persönlichkeitspsychologen aus, ist er doch bestrebt, „eine umfassende, wissenschaftlich überprüfbare Theorie über die menschliche Natur und individuelle Unterschiede zu entwickeln“ (Pervin/Cervone/John 2005: 29). „Persönlichkeitstheorien sind Bilder vom Menschen“ (Steden 2004: 85). Auch die von Wissenschaftlern entwickelten Persönlichkeitstheorien haben immer auch einen subjektiven Charakter, in denen eigene Vorlieben, persönliche Überzeugungen und Weltanschauungen zum tragen kommen. Auf diesen Aspekt weist Langenfeldt hin, der diesen Subjektcharakter durch einen Vergleich mit künstlerischen Werken unterstreicht: „So, wie wir selbstverständlich akzeptieren, dass ein Portrait von Lucas Cranach anders aussieht als eines von Picasso, müssen wir akzeptieren, dass Psychologen ebenfalls unterschiedliche Bilder (Theorien) vom Menschen entwerfen“ (Langenfeldt 1993: 137, zit. in: Steden 2004: 86). Persönlichkeitstheorien haben immer auch einen intentionalen Charakter, geht es doch auch darum, Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens aufzuzeigen, woraus sich letztlich unterschiedliche Vorstellungen über Erziehung und Therapie, im weiteren Sinne über die Lösung konkreter Probleme im zwischenmenschlichen Bereich ableiten lassen (vgl. Correll 1976: 9). Genau hier zeigt sich ein gewichtiger Berührungspunkt mit der Sozialen Arbeit. Sozialarbeiter sind in ihrer äußerst komplexen, vielschichtigen und oft mehrdeutige Arbeit mit ihren Klienten auch darum bemüht, Klienten in ihren „Entwicklungen zu steuern oder zu unterstützen oder gewisse Entwicklungen zu verhindern“ (Flammer 2005: 7). Persönlichkeitstheorien können meiner Ansicht nach einen wertvollen Beitrag dazu leisten. Mit dieser hier vorliegenden Arbeit möchte ich den Leser zunächst über bedeutende Persönlichkeitstheorien analog der drei großen psychologischen Richtungen informieren, so dass mir eine Einteilung in psychodynamische, lerntheoretische und humanistische Persönlichkeitstheorien als sinnvoll erschien. Bei der Analyse der Persönlichkeitssysteme geht es mir in Anlehnung der Autoren Pervin/Cervone/John (Pervin/Cervone/John: 2005) um die Beantwortung der Fragen des „Was“, „Wie“ und „Warum“. Jede Theorie liefert in spezifischer Weise Erklärungen dafür, was der Mensch ist, wie er zu dem wurde, was er ist, und warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Dabei lege ich Wert darauf, dass jede von mir vorgestellte Theorie die vier Bereiche abdeckt: 1) Struktur- der Leser soll von „den beständigen Qualitäten, die das Individuum definieren“, den „Bausteinen der Persönlichkeit“ erfahren; 2) Prozess- dieser Bereich soll über dynamischen Aspekte der Persönlichkeit, wozu auch die Motive gehören, informieren; 3) Wachstum und Entwicklung- hier geht es im Wesentlichen um Informationen bzw. der „Entwicklung von Individuen zu reifen Erwachsenen, die sich psychologisch voneinander unterscheiden; und 4) Psychopathologie und Verhaltensänderung- dieser Bereich deckt Vorstellungen über mögliche Veränderungen von Menschen ab und behandelt auch Fragen, die eine Veränderung erschweren. Darüber hinaus untersuche ich aber auch noch andere Aspekte, wie das jeweilige Menschenbild des Autors, seine Auffassung von Theorie und Forschung, das Verhältnis zur Religion und dergleichen. Hier habe ich eine klare Systematik vermieden, da jeder Autor bei bestimmten Themen unterschiedliche Schwerpunkte setzt, einige sind auch originärer, ursprünglicher Art und tauchen bei anderen Theoretikern erst gar nicht auf. Ich bitte um Entschuldigung, wenn gelegentlich auch keine Systematik bei der Beschreibung der vier Teilbereiche zu erkennen ist. In einigen Fällen schien mir ein zusammenhängender Text sinnvoller als eine allzu strenge Phrasierung oder Einteilung in kleinen Unterabschnitten. Dennoch ergibt sich dann aus dem Text, inwiefern die Erläuterungen den vier Analyseeinheiten zuzuordnen sind. Gelegentlich zeige ich innerhalb der Persönlichkeitstheorien Wege auf, die einen Zugang zur Sozialen Arbeit ermöglichen, damit die Kluft zwischen dem ersten und zweiten Teil nicht zu groß wird. Damit ist nun für den ersten Teil meiner Arbeit alles gesagt. Im zweiten Teil stelle ich von mir ausgewählte Theorien, Konzepten und Handlungsmodelle der Sozialen Arbeit vor. Dabei greife ich auf ältere und neuere Modelle zurück, möchte den Leser aber darauf hinweisen, dass die Auswahl nicht auf beliebiger, fakultativer Weise erfolgte, sondern mit einer direkten Anwendung der Persönlichkeitstheorien verbunden ist. Mit anderen Worten geht es mir bei der Arbeit darum, dem Leser aufzuzeigen, inwiefern Persönlichkeitstheorien Eingang in Modelle der Sozialen Arbeit gefunden haben, sei es nun in expliziter, impliziter oder potentieller, also möglicher Form. Ich gehe also auch der Fragestellung nach, ob spezifische Aspekte der Persönlichkeitstheorien in sozialarbeiterischen Modellen dort integriert werden können, wo auf den ersten Blick zunächst keine direkten Berührungspunkte bestehen. Indem einige Modelle auch kritisch vor dem Hintergrund sozialstaatlicher Veränderungen und rechtlicher Normierungen reflektiert werden, konfrontiere ich die Leser mit der These, dass Soziale Arbeit eine dialogische, kommunikative Koproduktion ist bzw. sein sollte. Mit anderen Worten kommt im zweiten Teil meine persönliche Auffassung von Sozialen Arbeit zur Geltung, von der ich den Leser als drittes Anliegen überzeugen will.
Soziale Arbeit bietet allgemein formuliert „Hilfe und Unterstützung bei der Lebens- und Alltagsbewältigung von Individuen, Gruppen und Gemeinwesen“ (Galuske 1998: 35). In diesem Sinne ist die Zielperspektive vergleichbar mit anderen Professionen wie Ärzten, Psychologen und Juristen. Ein wesentliches und von anderen Professionen zu unterscheidendes Merkmal ist ihre Allzuständigkeit, das bedeutet, (ebd.: 35ff.) dass eine große Bandbreite von Problemen zum Gegenstand Sozialer Arbeit werden kann. Die Vielfalt von Problemen, die unterschiedlichen Lebenslagen der Klienten und die zahlreichen Arbeitsfelder, in denen Sozialarbeiter tätig sind, verlangen nach unterschiedlichen Methoden, Konzepten und Handlungsmodellen. Durch die Integration psychologischer Konzepte in sozialarbeiterischen Modellen können eventuell Überforderungsgefühle der Professionellen angesichts von Allzuständigkeit begrenzt, die sozialarbeiterische Komplexität insgesamt reduziert werden. Dass eine Orientierung an psychologischen Konzepten auch problematisch sein kann, wird sich dabei noch zeigen.
Zum Aufbau der Arbeit ist zu sagen, dass ich der deduktiven Methode folge. Zwar arbeite ich die spezifischen Merkmale und Charakteristika der Persönlichkeitstheorien heraus, indem ich aber den Versuch unternehme, einen Zusammenhang mit sozialarbeiterischen Handlungsmodellen herzustellen, gehe ich zum Besonderen, Konkreten über. Abschließend sei noch angemerkt, dass mit dem Begriff Soziale Arbeit die professionelle Sozialarbeit gemeint ist, welche Sozialpädagogik mit einschließt. Auch habe mich für die männliche Form „Sozialarbeiter“ entschieden, die selbstverständlich die weiblichen Akteure mit einschließt.
2. Teil I: Die analytische Darstellung spezifischer Persönlichkeitstheorien
2.1 Psychodynamische Persönlichkeitstheorien
2.2 Die Persönlichkeitstheorie des Sigmund Freud (1856-1939)
2.2.1 Kurzbiographie
Sigmund Freud (1856-1939), Begründer der Psychoanalyse, studierte in Wien Medizin. 1875 schloss er sich dem physiologischen Laboratorium von Ernst Wilhelm Ritter von Brücke an. Brücke stand dem Positivismus nahe; diese Bewegung unternahm den Versuch, menschliches Verhalten nach naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten zu erklären. Brücke ordnete den Menschen innerhalb eines dynamischen physiologischen Systems ein, das menschliches Verhalten auf ein nach physikalischen Prinzipien gestütztes Energiesystem betrachtete. Freud nahm diese Sichtweise des Menschen in seinen später entwickelten Persönlichkeitssystem auf (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 108 ff.). Als Freud heiratete, den Doktortitel zu dieser Zeit bereits erhalten, machte er eine Phase psychischen Stresses durch: Angstzustände und Depressionen hielten sich die Hand, die er durch unregelmäßigen Kokainkonsum in Schach halten wollte. Zu dieser Zeit kam er auch mit der Katharsis- Methode des Wiener Arztes Joseph Breuer in Berührung. Es handelte sich um ein Verfahren, das die Verbalisierung von Problemen als nützlich ansah, da auf diese Weise sich der Patient von unliebsamen, quälenden Emotionen befreien konnte. Von Jean Charcot lernte er die Hypnose kennen, fand sie aber unzureichend bei der Behandlung seiner Patienten. Ein entscheidendes Ereignis war die Entdeckung der freien Assoziation, eine Methode, bei der Patienten improvisierend ihre Gedanken äußern sollten, um verdrängtes Material an die Oberfläche des Bewusstseins zu spülen. Freud sah in ihr sowohl eine Behandlungsmethode als auch eine wissenschaftliche Methode (ebd.: 110). Freud sagte einmal über das Seelenleben: „Wir nehmen an, dass das Seelenleben die Funktion eines Apparates ist, dem wir räumliche Ausdehnung und Zusammensetzung aus mehreren Stücken zuschreiben, den wir also ähnlich vorstellen wie ein Fernrohr, ein Mikroskop u. dgl.“(Freud 1972: 9). Eine derart mechanische Auffassung über das Seelenleben muss in Bezug zu den physikalischen, biologischen und physiologischen Erkenntnissen seiner Zeit gesetzt werden. Beispielsweise formulierte Helmholtz die beiden Hauptsätze der Thermodynamik; Gustaf Robert Kirchhoff konnte die Spannung und Stromstärke in aufgebauten Netzen berechnen, wobei die Größe der Widerstände die Spannung beeinflusst (vgl. Richter 1994: 87 ff.) Analog dazu postulierte Freud in der freien Assoziation von Patienten Widerstände, da schmerzhafte Kindheitserinnerungen verdrängt waren und nur schwer an die Oberfläche des Bewusstseins gerieten.
Freud starb im Alter von 83 Jahren in London.
2.2.2 Struktur
Freud entwickelte ein Strukturmodell der Persönlichkeit, das sich aus drei Persönlichkeitsstrukturen konstituiert: das Es, das Ich und das Über-Ich. In „Abriss der Psychoanalyse“ (Freud 1972) geht er u. a. auf diese drei Konstrukte näher ein. An dieser Stelle möchte ich Freuds Auffassung von der Seele des Menschen nur kurz umreißen, da sein Konstrukt des psychischen Apparates zu bekannt ist. Das Es funktioniert nach dem Lustprinzip, d. h. es arbeitet irrational und drängt auf unmittelbare Triebbefriedigung. Auf der Instanz des Es spielt es keine Rolle, ob die Triebbefriedigung von sexueller, körperlicher oder emotionaler Lust sozial und moralisch vertretbar und akzeptabel ist. Das Es umfasst die Gesamtheit der Triebe und arbeitet nach dem Lust - Unlust Prinzip. Unter dem Einfluss der Außenwelt entwickelt sich später aus Teilen des Es das Ich, welches die Triebbefriedigung regelt, kognitive Prozesse leitet und dem Realitätsprinzip unterliegt. Hier liegen die koordinierenden Funktionen zur Regelung der Beziehung des Individuums zu seiner Umgebung. Das Ich vermittelt also zwischen Es, Außenwelt und der dritten psychischen Instanz, dem so genannten Über-Ich, welches Normen und Motive internalisiert. Man könnte es als das Gewissen bezeichnen, zumal es das Ich beobachtet und kontrolliert. Es evoziert Schuldgefühle, wenn Handlungen die im Über-Ich enthaltenden Normen widersprechen. Es und Über-Ich stehen antagonistisch zueinander.
2.2.3 Prozess
Freuds dynamisches, motivationales Konzept wird verständlich vor dem Hintergrund seiner Trieblehre und den Abwehrmechanismen, die er in den psychotherapeutischen Behandlungen seiner Patienten beobachtete. Zunächst nahm er eine Vielzahl von Trieben an, die zusammengenommen die psychische Energie (Libido) darstellen und ihren Sitz im Es haben. In späteren Abhandlungen ordnete er sämtliche Triebe innerhalb des Eros ein und entwickelte ein duales Triebverständnis: „Nach langem Zögern und Schwanken haben wir uns entschlossen, nur zwei Grundtriebe anzunehmen, den Eros und den Destruktionstrieb. (Der Gegensatz von Selbsterhaltungs- und Arterhaltungstrieb sowie der andere von Ich - Liebe und Objektliebe fällt noch innerhalb des Eros) “ (Freud 1972: 12). Der Lebens-, bzw. Erostrieb ist konservativer Natur, da er auf Erhaltung und Reproduktion des Organismus drängt, der Todestrieb dagegen stellt die diametrale Umkehrung dar, denn er zielt auf Zerstörung und will alles „Lebende in den anorganischen Zustand überführen“ (ebd.). Beide Triebarten in ihrer antagonistischen und komplementären Form manifestieren sich nach Freud innerhalb zahlreicher menschlicher Vorgänge: Beim Essvorgang findet simultan eine Zerstörung des Objekts und die Einverleibung statt, beim Sexualakt mischen sich aggressive und vereinigende Momente. Bleibt festzuhalten, dass „Freuds Motivationstheorie auf der Annahme fußt, dass die Triebe die einzige Energiequelle des menschlichen Verhaltens darstellen“ (Correll 1976: 19). Des Weiteren basieren nach Freud letztlich alle menschlichen Verhaltensweisen auf Sexualtrieben, die sich im späteren Leben hinter Ersatzaktivitäten verstecken.
Abwehrmechanismen: Jeder Mensch kennt das Phänomen der Angst, sei es nun Prüfungsangst oder die Angst, bei dem anderen Geschlecht nicht gut anzukommen. Die Entstehung der Angst wird nach dem psychischen Apparat durch die antagonistischen Strebungen der drei Instanzen erklärt. Danach kann das Ich den Ansprüchen innerhalb dieses Systems und den Forderungen der Umwelt nicht genügen, sie kontrollieren und in ein kohärentes Bild fügen. Freud unterscheidet zwischen verschiedenen Formen der Angst (ebd.: 22 ff.). Und egal, ob es sich dabei um eine Realitätsangst, neurotische Angst oder moralische Angst handelt, immer ist in solchen Situationen das Ich bestrebt, Abwehrmechanismen einzusetzen, die sozusagen strategische Anstrengungen darstellen, „um mit den gesellschaftlich inakzeptablen Impulsen des Es fertig zu werden“ (Pervin/Cervone/John 2005: 129). Es folgt nun eine kurze Schilderung zweier von mir ausgewählter Abwehrmechanismen und ihrer Relevanz für die Forschung und das gesellschaftliche Leben (ebd.: 128-140):
1. Verleugnung: Bei diesem Abwehrmechanismus werden in der Regel traumatische, reale oder andere sozial inakzeptable Tatsachen verleugnet. Steiner (1966, dt. 1994) stellte fest, dass dieser Abwehrmechanismus in Konzentrationslagern zu beobachten war. Trotz der offenkundigen Massentötung in den Lagern wurde von vielen Insassen dort die Wahrheit verleugnet, Lügen und Illusionen wurden der traumatischen Wahrheit vorgezogen. Eine andere Studie geht auf das Jahr 1983 zurück: Auf ein vorausgesagtes Erdbeben in Südkalifornien reagierten Studenten sehr unterschiedlich. Diejenigen, die in maroden Gebäuden untergebracht waren, leugneten diese Tatsache eher, als der Studententeil, der in besseren Gebäuden untergebracht war. Bei beiden Gruppen zeigte sich aber eine gewisse Apathie, denn es wurden keine vorbereitenden Maßnahmen ergriffen. Somit wird Verleugnung vor allem dann eingesetzt, wenn drohende Katastrophen zeitlich unbestimmt sind (Lehmann/Taylor 1987: 551, 553).
2. Projektion: Bei diesem Vorgang werden eigene unliebsame Regungen nicht akzeptiert und nach außen projiziert. Experimentelle Forschungsergebnisse (Newman et al. 1997) zeigen, dass Projektionen angewendet werden, wobei sie den Bezug zur Triebdynamik im Es ablehnen. Versuchspersonen wurden bei diesem Experiment mit negativen Persönlichkeitsattributen versehen, über eines sollten sie reden, das andere dagegen gedanklich unterdrücken. Bei der Vorführung eines Videos wurde die dort gezeigte Person genau mit den Persönlichkeitsattributen versehen, die sie vorher unterdrückten.
2.2.4 Wachstum und Entwicklung
Nach Freud vollzieht sich die Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung in verschiedenen Entwicklungsphasen. Er geht davon aus, dass in den ersten fünf Lebensjahren die Grundlage für die später vorherrschende Einstellung zum Leben gelegt wird (s. u. a Correll: 30-34, Pervin/Cervone/John 2005: 146, kritisch dazu Urban 2004: 250 ff.). Freud geht davon aus, dass „die Libido-Energie nach dieser Theorie bei jedem Individuum zu unterschiedlichen Zeiten an bestimmte seelisch- körperliche Erlebnisse gekoppelt ist, die sich jeweils auf eine so genannte erogene Zone beziehen“ (Urban 2004: 237). Die erste Phase stellt die Orale Phase dar (1.Lebensjahr), in der im Fokus des Interesses der Mund und das Essen der jungen Persönlichkeit steht. Werden nun die oralen Wünsche des Kindes in einem Übermaß gestillt, so kommt es nach Freud zu einer Fixierung auf diese Phase und es entstehen so genannte orale Charaktere. Sie sind nach seiner Theorie narzisstisch, also nur an sich selbst interessiert, zeigen passives und abhängiges Verhalten und fordern auch häufig aggressiv Hilfe ein oder wollen ständig Zuwendung erhalten. Die anale Phase (2-3 Lebensjahr) ist dadurch gekennzeichnet, dass das Kind die Libido- Energie auf den After richtet. Freud nahm an, dass bei einer Tabuisierung oder Abwertung dieser Interessen ein analer Charakter die Folge wäre. Ein solcher Charakter hätte aufgrund einer zu früh erfolgten Reinlichkeitserziehung einen übermäßigen Ordnungssinn, zeigt Sparsamkeit bis zum Geiz oder einen Hang zum Perfektionismus. Umgekehrt kann eine anale Fixierung ins gegenteilige Extrem umkippen und es kommt zu einem unkontrollierten Ausleben der unterdrückten Bedürfnisse. Im phallischen Stadium (3-5 Lbs.) sind die eigenen Geschlechtsteile die wichtigste erogene Zone. Der Ödipuskomplex nimmt in dieser Phase eine Zentralstellung innerhalb der Persönlichkeitsentwicklung ein. „Freud glaubt, dass der Ödipuskomplex und seine Überwindung eine seiner größten Entdeckungen gewesen sei“ (Correll 1976: 32). Im Kern versuchte Freud mit diesem Konstrukt die Genese des Über-Ich und die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil zu erklären. Bei dem Jungen nimmt er an, dass er sich in diesem Stadium der Mutter sexuell bemächtigen und den Vater „ersetzen“ will. Aus Angst vor Sanktionen (Kastrationsangst) internalisiert das Kind jedoch die Ge- und Verbote der Eltern und identifiziert sich mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil.
Mädchen würden stattdessen „Penisneid“ entwickeln oder einen Männlichkeitskomplex. Eine Fixierung auf die phallische Phase hätte den phallischen Charakter zur Folge, der sich nach Freud recht unterschiedlich äußern kann. Es kann zu Konkurrenz und Machtstreben kommen und auch zu der Tendenz, von den Leuten bewundert werden zu wollen (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 144 ff./ Urban 2004: 244 ff.). Auf die Latenzzeit und die genitale Phase möchte ich nicht mehr näher eingehen, da Freud nur die vorher genannten Phasen bedeutend fand im Hinblick auf die spätere Entwicklung. Die beschriebenen Fixierungen haben gemeinsam, dass der Betroffene bei einer Form der Triebbefriedigung bleibt, die zu einer früheren Lebensphase gehörte.
Natürlich erntete das von Freud entwickelte Phasenmodell nicht nur Lob. Adrian Urban führt z. B ein paar von Forschern formulierte Kritikpunkte an (ebd.: 250 ff.): So wird u. a. kritisiert, dass Freud die Persönlichkeitsentwicklung im Wesentlichen nach dem fünften Lebensjahr als abgeschlossen ansah. Die Psychotherapie hat aber den Menschen mit psychischen Problemen immer wieder Möglichkeiten zur Veränderung eröffnet, auch im späteren Leben.
2.2.5 Psychopathologie und Veränderung
Neurotische Verhaltensmuster basieren Freud zufolge auf in die Kindheit zurückgehende traumatische Fixierungen, die im Erwachsenenalter von neuem aktualisiert werden können (vgl. Flammer 2005: 71). Dabei werden vom Ich Verdrängungsmechanismen eingesetzt, die die Symptome hervorrufen. Die psychoanalytische Therapie will mittels der Technik der freien Assoziation die retrospektiven Konflikte verbal und emotional aufarbeiten, indem insbesondere eine Traumanalyse bei der Aufdeckung unbewusster, verdrängter Wünsche und Konflikte zum besseren Verständnis der Symptome verhelfen soll (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 173 ff.).
2.2.6 Menschenbild
Freuds Menschenbild genau zu beschreiben ist keine leichte Aufgabe, da es je nach Perspektive und Fokussierung auf einen einzelnen Aspekt seines Gesamtwerks automatisch mehrdeutig wird. Außerdem hat man das Gefühl, dass einzelne von ihm selbst vorgenommene Modifikationen ein äußerst heterogenes Bild vermitteln. In Anlehnung an Flammer (Flammer 2005) ist es sowohl mechanistisch, da menschliche Verhaltensweisen immer in einem Ursache- Wirkungszusammenhang eingebettet sind, aber auch thermodynamisch, weil Freud postulierte, dass der durch die Libido erzeugte Triebdruck in irgend einer Form abgeführt werden müsse. Andere wiederum gehen von einem topologischen Menschenbild aus, da der psychische Apparat sich aus Instanzen konstituiert, die um antagonistische, konfliktverursachende Interessen kämpfen. Darüber hinaus vermitteln Freuds eher soziologische Abhandlungen wie das „Unbehagen in der Kultur“(19301929 ), „Die Zukunft einer Illusion“(1927) und die bereits 1908 erschienene Schrift „Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität“ ein eher pessimistisches Menschenbild. Alle drei Abhandlungen haben gemeinsam, dass sie thematisch den Antagonismus zwischen Kultur und Trieben bzw. die Konflikte, die daraus resultieren, behandeln. In das „Unbehagen in der Kultur“ bemerkt Freud, durch die Dominanz des Lustprinzips sei Glück nur phasenweise erreichbar: „Man möchte sagen, die Absicht, dass der Mensch „glücklich sei“, ist im Plan der „Schöpfung“ nicht enthalten“ (Freud Bd. IX 1974: 208). An anderer Stelle führt er Beispiele an, um zu belegen, dass der Mensch aggressiver Natur ist (Eroberung Jerusalems, 1. Weltkrieg), und kommt so zu der vernichtenden Erkenntnis: „Das gern verleugnete Stück Wirklichkeit hinter alledem ist, dass der Mensch nicht ein sanftes, liebebedürftiges Wesen ist,...sondern dass er zu seinen Triebbegabungen auch einen mächtigen Anteil von Aggressionsneigungen rechnen darf“ (ebd.: 240).
2.2.7 Auffassung von Wissenschaft, Theorie und Forschung
Die Psychoanalyse als Konglomerat von Forschung, Theorie und Therapie ist in ihrer Entstehung eng verbunden mit der damaligen naturwissenschaftlichen Euphorie. Bestimmte Termini wie z. B. Widerstand, Regression oder Projektion sind der Physiologie entliehen. Freuds Anliegen war es, psychisches Geschehen nach naturwissenschaftlich- kausalen Gesetzmäßigkeiten zu interpretieren (vgl. Steden 2004: 37). Durch seine medizinische Ausbildung war er zeitlebens bemüht, theoretische Konzepte präzise zu definieren. Er akzeptierte aber auch, dass sich die Wissenschaft in einem frühen Stadium ihrer Forschungen mit spekulativen Prämissen begnügen müsse. Seine wissenschaftlichen Beobachtungen resultieren primär aus der Analyse seiner Patienten (klinische Fallstudien), wobei er generell nicht um eine Verifizierung seiner Theorien im Labor bemüht war (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 113 ff.). Freuds Denkart ist kausal - reduktiver Natur, da er menschliches Verhalten im weiteren Sinne, psychische Erkrankungen im engeren Sinne immer auf frühkindliche Erlebnisse zurückführt: „Die gemeinsame Ätiologie für den Ausbruch einer Psychoneurose oder Psychose bleibt immer die Versagung, die Nichterfüllung eines jener ewig unbezwungenen Kindheitswünsche, die so tief in unserer phylogenetisch bestimmten Organisation wurzeln“ (Freud, Bd. III 1975: 335).
2.2.8 Bewertung und Einschätzung
Die Psychoanalyse kann als erste systematische Konzeption der Psychotherapie betrachtet werden. Bis heute praktiziert und in vielen Therapien bewährt, darüber hinaus in Film, Kunst und Literatur rezitiert, was sicherlich ihre Bedeutung und den ausgeübten Einfluss auf die Gesellschaft unterstreicht (vgl. Flammer 2005: 79). Viele von Freuds Annahmen wurden aber falsifiziert. Darunter fällt auch sein Energiemodell, wonach der Mensch lediglich Spannungen abbauen will. Diese Sichtweise wird der Komplexität menschlichen Verhaltens bei weitem nicht gerecht. Viele Begriffe sind metaphorischer Natur (Todestrieb, Ödipuskomplex, Kastrationsangst und entziehen sich einer wissenschaftlichen Operationalisierung (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 207ff.). Ferner konzentriert sich die Psychoanalyse mehr auf Defizite und Störungen und übersieht dabei die Kompetenzen ihrer Klienten (vgl. Urban 2004: 252).
2.3 Die Persönlichkeitstheorie des Alfred Adler (1870-1937)
2.3.1 Kurzbiographie
Alfred Adler, 1870 in Wien geboren, war das zweitgeborene Kind von insgesamt sechs Kindern, wobei sein jüngerer Bruder starb, als Adler drei Jahre alt war. Seine spätere Berufswahl, der des Arztes, wurde von diesem schlimmen Erlebnis maßgeblich beeinflusst. Seine frühe Kindheit wurde durch gesundheitliche Probleme diktiert. Eine rachitische Erkrankung begleitet mit Stimmritzkrämpfen sowie nächtliche Erstickungsanfälle vermitteln den Eindruck eines schwachen, kränklichen Kindes. In den folgenden Jahren entwickelte er ein ausgeprägtes Mitgefühl für Menschen mit verschiedenen Leiden, gleichzeitig lernte er während seiner Schulzeit, sich seinen körperlich überlegenen Kameraden durch viel Sport und Training anzugleichen. Nach dem Abitur begann er sein Studium der Medizin an der Wiener Universität, 1895 promovierte er zum Doktor der Medizin. In „Der Arzt als Erzieher“ (1904) wird zum ersten Mal deutlich, dass Adler sich von Freuds Sexualtheorie distanziert. Im Jahre 1911 kam es dann zum offiziellen Bruch mit Freud: Adler hielt einen Vortrag, in dem er Freuds Annnahme der Genese von Neurosen falsifizierte und stattdessen konstatierte, dass Sicherheit, Geltung und Macht die Hauptziele psychischer Aktivität sind. Er gründete 1912 den Verein für Individualpsychologie. Mit diesem Begriff wollte Adler die Einmaligkeit und Ganzheit der Psyche betonen. Adler legte viel Wert darauf, konkrete pädagogische Maßnahmen aus seinem theoretischen Konzept abzuleiten, so dass in der Zeit zwischen 1920 und 1930 mehrere Beratungsstellen gegründet wurden. Er erlag 1937 während einer Vortragsreise in Aberdeen einem Herzversagen (sämtliche Informationen aus Wehr 1996: 74 ff./ Correll 1976: 11 ff.).
2.3.2 Grundbegriffe seiner Lehre
In „Der Arzt als Erzieher“ (1904) werden Adlers grundlegende pädagogische Prämissen erstmals erwähnt, zudem tauchen auch hier schon gelegentlich seine konstitutiven Begriffe wie Organminderwertigkeit, Minderwertigkeitsgefühl und Gemeinschaftsgefühl auf.
Es ist verwunderlich, dass die pädagogischen Implikationen erst wieder vermehrt nach dem ersten Weltkrieg auftauchten (Anmerkung d. Verfassers). Adler betont, dass Erziehung immer auf Liebe und Zuneigung aufgebaut werden muss, Prügelstrafe und Schläge lehnt er grundsätzlich ab, bezeichnet sie sogar als „Barbarei“. Auch erkennt er die Individualität jedes Menschen an: „Ein flüchtiger Blick belehrt uns über die überraschende Mannigfaltigkeit persönlicher Anlagen. Kein Kind ist dem andern gleich, und bei jedem sind die Spuren seiner Anlage bis ins höchste Alter zu verfolgen“ (Adler/Furtmüller/Wexberg 1973 in: ebd.: 201). Auch die Prophylaxe bekommt einen hohen Stellenwert, insofern, als gesunde Kinder vor Krankheiten geschützt werden sollen. Im Kontext schüchterner Kinder taucht der Begriff der Organminderwertigkeit auf: „Als Ursache findet man Organminderwertigkeiten, die oft schon einen Ausgleich gefunden haben, oder in den Folgen als gleichwertig eine strenge oder verzärtelte Erziehung...“(ebd.: 208). Adlers finale Denkweise wird auch schon indirekt formuliert: Kinder, die häufig fragen stellen, möchten wissen, woher sie kommen und in welche Richtung sie gehen (vgl. ebd.: 208). Und zuletzt betont er die Erziehung zur Gemeinschaft und leitet daraus ab, dass Edukatoren Gemeinschaftsgefühl besitzen müssen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden (vgl. ebd.: 209).
Die „Studie über Minderwertigkeiten von Organen“(1907) verlagert den Schwerpunkt von pädagogischen Anliegen hin zu Organminderwertigkeiten, bewegt sich somit primär auf anatomischem und physiologischem Gebiet. Im Kontext der Organminderwertigkeiten leitet er erstmals die Begriffe Kompensation und Ü berkompensation ein: „Eine besondere Betrachtungsweise hat mich gelehrt, wie oft ein morphologischer oder funktioneller Mangel des Organs sich in höhere Ausbildung des Organs verkehrt“ (Adler 1977 in: ebd.: 51). Er weist dabei auf Demosthenes hin, der bekanntlich als Kind gestottert hat und durch überkompensatorisches Training schließlich zum größten Redner Griechenlands wurde. Mit Freud teilt er in dieser Schrift noch die Bedeutung der Sexualität in der frühen Kindheit, setzt aber einen anderen Akzent, insofern, als Neurosen und Abwehrmechanismen auf Organminderwertigkeiten basieren: „Nur muss ich erwähnen, dass die interessanten psychischen Phänomene der Verdrängung, der Ersatzbildung, der Konversion,...der Psychoneurosen...auf der oben geschilderten Gestaltung der Psyche bei minderwertigen Organen erwachsen“ (ebd.: 101). Adlers’ Denken ist somit in dieser Zeit noch kausalorientiert, da psychische Störungen auf defekte Organe abgeleitet werden.
In „Über den nervösen Charakter“ (1912), das als sein Hauptwerk gilt, vollzog sich eine Art Paradigmenwechsel, da von nun an der Fokus auf spannungsreiche zwischenmenschliche Beziehungen gelegt wurde (Adler 1976 in: ebd.: 17), außerdem wird der Mensch von nun an „als zielgerichtete Ganzheit “ betrachtet, der aufgrund eines Minderwertigkeitsgefühls nach Sicherung und Überlegenheit strebt“ (Schmidt 1989: 32). Nach Adler erlebt jeder Mensch von Geburt an aufgrund einer konstitutionellen Schwäche und das Angewiesensein auf die Eltern ein Minderwertigkeitsgefühl. Ein Bezug zu dem Zoologen Adolf Portmann (1897 - 1982), der den Menschen als „physiologische Frühgeburt“ bezeichnete ist nicht zu leugnen, auch Gehlens Begriff des „Mängelwesens“ passt in dieses Konzept (vgl. Böhringer 1985: 29ff.). Adlers Maxime lautet somit: „Menschsein heißt Minderwertigkeitsgefühle haben“ (Adler 1976, 35). Er betrachtet es außerdem als den Ausgangspunkt menschlichen Handelns. Nun wurde bereits erwähnt, dass zunächst organische Mängel dieses Gefühl verstärken können. In späteren Schriften betont er, dass vor allem eine falsche Erziehung (zu strenge, extrem verwöhnende, vernachlässigende) Ausgangspunkte sind für pathologische Charakterentwicklungen. Ein verzärteltes Kind zeigt z. B. narzisstische, egoistische Züge und entwickelt ein Mittelpunksdenken (vgl. Adler 1973: 27). Erziehung muss nach Adler immer auf Kooperation, Geborgenheit und Anerkennung aufbauen, ansonsten bestünde immer die Gefahr, dass der Mensch überkompensatorische Bestrebungen einleitet, in dessen Folge er über andere Menschen herrschen will. Ein übertriebenes Machtbedürfnis kommt also in der Überkompensation zum Ausdruck. Gerhard Wehr (Wehr 1996: 88 ff.) stellt Adlers Machtstreben zunächst mit Nietzsches „Wille zur Macht“ in Verbindung. Obwohl dieser noch in „Über den nervösen Charakter“(1912) akzeptiert wird, geht Wehr aber von divergierenden Ausgangspunkten der beiden aus: Nietzsche betone eher „die Überwindung der Menschlichkeit zugunsten des Übermenschen“, Adler wolle dagegen nicht die Beherrschung über andere, sondern kooperierende Individuen. Er sieht das Gemeinschaftsgefühl als etwas ursprüngliches an, spricht auch von einem „angeborenen Gemeinschaftsgefühl“ und einem „biologischen Erbe“ (Adler 1973: 18, 1975: 72) und betonte mehrmals, dass er mit dem Begriff der Gemeinschaft keine konkrete meint, sondern sie immer auch „sub specie aeternitatis“ (Perspektive der Ewigkeit) betrachtet: „Gemeinschaft ist nie etwas Gegebenes, sondern immer etwas, das es zu verwirklichen gilt“(Jacoby 1974: 52).
Bisher habe ich Adlers Begriffe des Minderwertigkeitsgefühls, Kompensation bzw. Überkompensation, Macht (Geltungsstreben) und Gemeinschaftsgefühl kurz umrissen. Kommen wir nun zu einem anderen, in Adlers Konzeption sehr bedeutsamen Begriff, nämlich den der Leitlinie (auch: Lebensplan, Lebensstil). Nach Adler konstituiert sich der Lebensplan aus dem Ausmaß der Minderwertigkeitsgefühle, dem Ursprung und Art der Minderwertigkeitsgefühle sowie dem Ausmaß des Gemeinschaftsgefühls. Er spricht von einem „geheimen Lebensplan“, womit er ausdrücken wollte, dass dieser in der Regel unbewusst ist (ebd.: 39). Die Entwicklung des Lebensplans ist seiner Auffassung nach vor dem fünften oder sechsten Lebensjahr abgeschlossen, jedoch beeinflusst er das weitere Leben. Der Lebensplan äußert sich später im Lebensstil, (Lebensleitlinie) in dessen Folge der Einzelne typische Handlungs- und Lösungsversuche vollzieht, um bestimmte Probleme zu meistern. Der Aufbau einer Lebensleitlinie und damit auch die psychische Entwicklung können u. a. durch die Stellung innerhalb der Geschwisterreihe entwickelt werden (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 188). So stellte Adler fest, dass gerade das jüngste Kind gegenüber den älteren eher verwöhnt wird, und somit eine Leitlinie wie „Ich muss mich pflegen lassen“ konstruiert. Nach Adler ist es eine Hauptaufgabe der Psychotherapie, fehlgeleitete Leitlinien aufzudecken und zu modifizieren im Hinblick auf ein gemeinschaftliches Handeln (vgl. Böhringer 1985: 38 ff.). Wichtig bei den Leitlinien sind ihr finaler Charakter und die damit verbundenen Fiktionen (Leitlinien). In „Über den nervösen Charakter“ (1912) betont Adler, dass sich der Neurotiker im Unterschied zum psychisch gesunden Menschen stärker an solche Fiktionen orientiert, die mit der Realität nichts zu tun haben müssen und betont dabei kurz die philosophischen Überlegungen Hans Vaihingers (Adler 1976: 54). Vaihinger brachte 1911 das Buch „Die Philosophie des Als- Ob“ heraus, worin er herausstellte, dass der Mensch Fiktionen als Mittel benutzt, um die Umwelt zu bewältigen (s. auch Correll 1976: 58 ff./Jacoby 1974: 30 ff./Böhringer 1985: 35 ff.).
Adler hat in späteren Schriften betont, dass der Lebensstil (Bewegungsgesetz, Lebenslinie) dem Kind nicht durch äußere Einflüsse aufoktroyiert wird, sondern vielmehr Resultat eines freien, schöpferischen Prozesses ist: „Dieses Bewegungsgesetz entspringt in dem engen Raum der Kindheit und entwickelt sich in wenig eingeschränkter Wahl unter freier, durch keine mathematisch formulierbare Aktion beschränkter Ausnützung von angeborenen Kräften und Eindrücken der Außenwelt“ (Adler 1973: 35 ff.) . Diesen schöpferischen Prozess bezeichnet er auch mit dem Begriff des „ kreativen Selbst “ und versteht darunter ein „hochpersonalisiertes subjektives System, das die Erfahrungen des Organismus überhaupt erst bedeutsam macht. Dieses Selbst sucht nach Erfahrungen, die dem Menschen helfen, seinen persönlichen Lebensstil zu vollenden. Wenn diese Erfahrungen nicht in der Welt zu finden sind, sucht das Selbst sie zu schaffen“ (Correll 1976: 57). Correll würdigt Adlers erst in späteren Schriften auftauchenden Begriff des „kreativen Selbst“, da nun Umwelteinflüsse auf das Verhalten insgesamt weniger Bedeutung haben, der Mensch nun vermehrt als Selbstgestalter seines Lebens betrachtet wird. Er geht sogar soweit, ihn als wichtigsten Begriff innerhalb seines Persönlichkeitssystems zu bestimmen, da er ursprünglich sei und andere Begriffe sich von ihm ableiten ließen. (vgl. ebd.: 64 ff.).
2.3.3 Das Menschenbild
Bei der Beschreibung des Menschenbildes werde ich mit einem Zitat Adlers beginnen, da es treffender nicht sein könnte: „Der Mensch ist von Natur aus weder gut noch böse. Alle seine Charaktere zeigen sich sozial gerichtet und verraten deshalb ihren Ursprung aus der Bezogenheit zur Umwelt, sind nicht angeboren, sondern erworben im Strom der Welt“ (Adler 1975: 81). Ich möchte an dieser Stelle Adlers Menschenbild mit eigenen Worten beschreiben und ergänzen:
1.
Nach Adler ist der Mensch von Natur aus eher gut als böse, da er die Möglichkeit eines angeborenen Gemeinschaftsgefühls einräumt.
2.
Seine Individualpsychologie geht aus von der Einmaligkeit der Persönlichkeit. Sie konstituiert sich z. B. aus bestimmten Motiven, Charakterzügen und Einstellungen.
3.
Er betrachtet das Individuum als zielgerichtete, teleologische Einheit, das sich in der Kindheit eine leitende Fiktion (Leitlinie, Lebenslinie) konstruiert hat. Das gesamte Verhalten ist seiner Auffassung nach von dieser Leitlinie her motiviert. Die Zielgerichtetheit betont auch das Zukünftige, anders als bei Freud, bei dem menschliches Verhalten im Wesentlichen auf die Triebe zurückzuführen ist. Nach Adler kann der Mensch ohne Zielsetzung nicht denken, nicht fühlen und nicht handeln. Trotzdem stellt er das Minderwertigkeitsgefühl als Basis für jede Bewegung in den Fokus, so dass man eher von einer „kausalen Finalität“ sprechen sollte.
4.
Der später eingeführte Begriff des kreativen Selbst räumt den Menschen innerhalb Adlers Persönlichkeitspsychologie einen noch größeren Subjektstatus ein. Mit diesem Begriff wird der Mensch als Selbstgestalter des Lebens aufgefasst, der sich die Lebensziele selber bestimmt sowie die Mittel, um sie zu vollenden.
5.
Adlers Theorie impliziert ein linear - eingleisiges und reduktives Denken (vgl. Brühlmeier 1974, Kapitel II, Abschnitt 2). Er betrachtet die Bewegung des Lebens von einem Ausgangspunkt ausgehend hin zu einer Richtung verlaufend. In „Sinn des Lebens“ stellt er die Lebensbewegung von „unten nach oben“ oder auch von einer „Minussituation zu einer Plussituation“ (Adler 1973: 42) fest. An anderer Stelle umschreibt er diese Erkenntnis, indem er feststellt, dass das „Ziel der menschlichen Seele Überwindung, Vollkommenheit, Sicherheit, Überlegenheit ist“ (ebd.: 109). Der Mensch hat dabei nur zwei Möglichkeiten: entweder er bewegt sich auf der nach Adler als pathologisch bewerteten vertikalen Ebene, in der das Macht- und Geltungsstreben dominiert, oder er begibt sich auf der von Adler erwünschten horizontalen Linie, die zur Gemeinschaft gerichtet ist. Reduktiv ist sein Denken, da diese Bewegungen immer vom Minderwertigkeitsgefühl aktualisiert werden, er führt menschliches Verhalten immer darauf zurück. In seinen Werken wird deutlich, „dass das gesamte menschliche Verhalten mit diesem Ansatz erfasst werden kann“(Brühlmeier 1974, Kapitel II, Abschnitt 2).
2.3.4 Bewertung und Einschätzung
Adlers Individualpsychologie, von ihm selber als eine „systematisierte Menschenkenntnis“ und „verstehende und deutende Menschenkenntnis“ verstanden (Jacoby 1974: 10) ist genau genommen eine Sozialpsychologie, denn sie zielt auf eine Erziehung in und zur Gemeinschaft hin. Die Hervorhebung auf die Bedeutung der Mutter für die Persönlichkeitsentwicklung und die Fokussierung auf das Gemeinschaftsgefühl bringen ihn mit Pestalozzi in Berührung (s. Rattner 1978: 79, 97 ff., in: Engelke 1999, 183). Der Begriff „Gemeinschaftsgefühl“ und die bereits in „Der Arzt als Erzieher“ (1904) zur Geltung kommende Sichtweise einer prophylaktischen Erziehung lassen auch enge Bezüge zu dem Sozialmediziner Rudolf Virchow (1821- 1902) herstellen (vgl. Böhringer 1985: 101). Das viele Beratungsstellen in der Sozialen Arbeit individualpsychologisch orientiert sind und viele Psychologen von ihm angeregt wurden, wie z. B Viktor E. Frankl, Abraham H. Maslow, Erich Fromm (Ansbacher/Ansbacher 1982: 27-39, in: Engelke 1999: 184), kann sicherlich als ein Zeichen für die Wertschätzung und Bedeutung Adlers Konzeption verstanden werden.
Aber Engelke umgeht die negativen Kritikpunkte völlig oder will sie nicht sehen. Nach Adler ist der Mensch „soziologisch determiniert“ (Correll 1976: 56). Ihm steht eigentlich nur die Option offen, durch die Erfüllung der Lebensaufgaben (Beruf, Liebe, Gesellschaft) ein psychisch gesundes Leben zu führen, oder aber er wird bei Nichterfüllung in Form eines Geltungsstrebens und Minderwertigkeitskomplexes psychisch krank. Dieser Kategorie können dann Neurotiker, Kriminelle, schwer erziehbare oder aber auch Homosexuelle zugeordnet werden. Homosexuelle sind Adler zufolge geplagt von Minderwertigkeitskomplexen, die durch eine Ermutigung im „Sinne des verantwortungsbewussten, kooperationsfähigen Gemeinschaftsgefühls“ (Adler 1977: 131) „geheilt“ würden. Ein solches Denken fördert meiner Meinung nach Ausgrenzung und Intoleranz. Die Vertreter Adlers Theorie sollten in der Sozialen Arbeit diesen Punkt berücksichtigen. Auch sollte vor dem Hintergrund der Vorstellungen von der Individualisierung der Lebenslagen und Pluralisierung der Lebensstile (Beck 1986) Orientierungen an längst überkommende Ideale verschwinden, sie sind obsolet. Noch ein letzter Punkt:
Adler folgt einem philosophischen System, das die Welt letztlich aus einem Prinzip heraus erklären will, in diesem Falle die Lehre oder das Prinzip des ursprünglichen Minderwertigkeitsgefühls. Diese monistische Vorgehensweise vereinfacht die Erklärung menschlichen Verhaltens in extremer Weise. Man kann damit alles erklären, gleichzeitig aber auch nichts.
2.4 Die Persönlichkeitstheorie des C. G. Jung (1875-1961)
2.4.1 Kurzbiographie
Jung wurde am 26. Juli 1875 in der Schweiz geboren. Er entstammte einer evangelisch- reformierten Pfarrersfamilie und begann 1895 ein Medizinstudium in Basel, darauf folgte eine Ausbildung zum Psychiater. Ab 1900 war er Assistent in der psychiatrischen Klinik „Burghölzli“ in Zürich, die von Eugen Bleuler geleitet wurde. Später wurde er dort für vier Jahre Oberarzt, gab seine Arbeit an der psychiatrischen Klinik jedoch 1909 auf. 1907 kam es zur ersten Begegnung mit Freud; von da an kam es zur intensiven Beschäftigung mit der Psychoanalyse, 1911 wurde er sogar zum Präsidenten der „Internationalen Psychoanalytischen Gesellschaft“ ernannt. Dazwischen folgten sie beide einer Einladung an die Universität von Worcester, um dort Vorlesungen zu halten. Auf dem Weg dort hin besprachen sie auch ihre Träume, wobei ein Traum Jungs, in dem er sich in einem Haus mit verschiedenen Stockwerken befand, Jungs neue Richtung zeigen sollte: Die Annahme eines kollektiven Unbewussten und die Erkenntnis, dass die antike Mythologie an die Psychologie gekoppelt ist. Als sein Buch „Wandlungen und Symbole der Libido“ (1912) erschien, war die Trennung von Freud (1913 erfolgt) beinahe vorprogrammiert. In diesem Buch führt er einen erweiterten Libidobegriff ein, gleichzeitig lehnt er Freuds Überbetonung der Sexualität explizit ab. Von nun an bezeichnete er seine Psychologie als „Analytische Psychologie“, etwas später führte er auch den Begriff der „Komplexen Psychologie“ ein, in dem er psychologische Tatbestände insgesamt wesentlich „komplexer“ auffasste als Freud es tat. Durch Forschungen über das Unbewusste kam es zu größeren Reisen: Es ging z. B. nach Nordafrika (1921), zu den Pueblo- Indianern in Arizona und New - Mexiko (USA 1924 / 1925): Er sah einen Zusammenhang „zwischen den Inhalten des Unbewussten eines modernen Europäers und gewissen Manifestationen der primitiven Psyche und ihrer Mythen- und Sagenwelt“ (Jacobi 1959: 240), so dass in genau dieser Richtung seine Forschungen ausgedehnt wurden. Später kam eine umfassende Beschäftigung mit philosophischer und religiöser Symbolik hinzu, die wiederum auf seine analytische Psychologie Einfluss nahm. Jung starb 1961 in Küsnacht, Kanton Zürich (sämtliche Informationen aus Jacobi 1959: 237 ff./Wehr 2006: 100 ff.).
2.4.2 Struktur
Nach Jung setzt sich die Persönlichkeit („Psyche“) aus vielen Teilkomponenten zusammen, zu nennen wären hier das Ich, das persönliche Unbewusste mit seinen Komplexen, das kollektive Unbewusste mit den Archetypen, der Persona, der Anima, dem Animus, dem Schatten, dem Selbst als Zentrum der gesamten Persönlichkeit und die Einstellungen der Introversion und der Extraversion.
Das Ich stellt den bewussten Teil der Persönlichkeit dar. Ähnlich wie bei Freud besteht es aus den bewussten Wahrnehmungen, Erinnerungen, Gedanken und Gefühlen. Das persönliche Unbewusste ist nach Jung eng mit dem Ich verkoppelt, denn seine Inhalte stellen „die verdrängten, aber bewusstseinsfähigen Teile des Unbewussten“ (Jung 1991: 40) dar. Nach Jung befinden sich im persönlichen Unbewussten die Komplexe. „Hierbei handelt es sich um eine organisierte Konstellation von Gefühlen, Gedanken, Wahrnehmungen oder Erinnerungen, die einen Kern haben, der andere Erfahrungen gleichsam anzieht“ (Correll 1976: 39). Dabei haben sich diese Komplexe ursprünglich aus den Menschheitserfahrungen entwickelt (z. B. Mutterkomplex), die in Kombination mit den frühen, in diesem Fall mütterlichen Erfahrungen die Persönlichkeit insgesamt steuern können. Alle Aktivitäten der Person sind in diesem Fall letztlich auf die Mutter gerichtet (vgl. ebd.). Jung akzeptiert Freuds Konzept des Unbewussten, ergänzt es aber um das Konzept des kollektiven Unbewussten. Ihm zufolge sind in ihm die gesammelten Erfahrungen vergangener Generationen gespeichert. Es ist nach Jung universal aufgrund einer gemeinsamen Ahnenreihe.
Aber lassen wir ihn kurz selber zu Wort kommen:
„Es ist der Geist unserer unbekannten Ahnen, ihrer Art, zu denken und zu fühlen, ihre Art, Leben und Welt, Götter und Menschen zu erfahren. Die Tatsache dieser archaischen Schichten ist vermutlich die Wurzel des Glaubens an Reinkarnation und an Erinnerungen aus „früheren Existenzen“ (Jung 1939, Ges. Werke Bd. IX, 304 ff., zit. in: Pervine/Cervone/John 2005: 189). Das kollektive Unbewusste enthält universelle Bilder oder Symbole, die so genannten Archetypen. Sie tauchen in Märchen und Mythen auf (z. B. der Archetyp der Mutter) und sind nach Jung in allen Kulturen anzutreffen. Jung erklärt sich die Genese der Archetypen durch kollektive Menschheitserfahrungen über Generationen hinweg, die dann im kollektiven Unbewussten gespeichert werden. So haben z. B. die Generationen Phänomene der Sonne beobachtet, aus der sich dann ein Sonnenarchetyp konstituiert hat (vgl. Correll 1976: 41). Unter den zahlreichen Archetypen haben sich nach Jung im Laufe der Evolution drei profiliert, nämlich der Archetyp der „Persona“, der der „Anima“ (bzw. des „Animus“) und der des „Schattens“. Die „Persona“ ist nicht in toto etwas individuelles, sie ist „ursprünglich die Maske, die der Schauspieler trug“, „eine Maske, die Individualität vortäuscht, die andere und einen selber glauben macht, man sei individuell, während es doch nur eine gespielte Rolle ist, in der die Kollektivpsyche spricht“ (Jung 1991: 41). Mit „Anima“ bzw. „Animus“ meint Jung die männlichen und weiblichen Anteile in uns. Demzufolge hat jeder Mann einen weiblichen Anteil (Archetyp der Anima) und jede Frau einen männlichen (Archetyp des Animus). Der Archetyp des „Schattens“ besteht aus den im Laufe der Evolution gebildeten animalischen Instinkten, auch unerfreuliche, destruktive Gedanken gehen auf diesen Archetyp zurück. In gewisser Weise ist er der Kontrapunkt des Sonnenarchetyps. Schattenmotive finden wir z. B. in der Kunst, Literatur oder im Film zahlreich wieder. Hierfür zwei Beispiele: Goethes Faust, in dem Faust von Mephisto verführt wird oder die ambivalente Figur des Golom in der „Herr der Ringe“, der besessen von dem bösen „Ring der Macht“ ist. Jacobi stellt nun fest, das Jungs Schattenmotiv einen wichtigen, wenn nicht sogar den bedeutendsten Aspekt innerhalb seiner analytischen Psychologie darstellt, denn erst, „wenn wir gelernt haben uns von unserem Schatten zu unterscheiden, indem wir seine Realität als einen Teil unseres Wesens erkannt und anerkannt haben und dieser Erkenntnis auch immer gegenwärtig bleiben, kann die Auseinandersetzung mit den übrigen Gegensatzpaaren der Psyche gelingen“ (Jacobi 1959: 175).
Werner Herkner teilt mit ihr die Relevanz des Schattenmotivs, da die Ermöglichung der Individuation (Selbstfindung, Selbstverwirklichung) qua Bewusstmachung des Schattens erfolge. (vgl. Herkner 1992: 340). In Jacobis Zitat taucht der Begriff „Gegensatzpaare“ auf. In Jungs Schriften ist eine kontrapunktische Struktur generell sehr auffällig, auf einige Gegensatzpaare habe ich bereits hingewiesen. Bezogen auf die Archetypen der Persona, der Anima (Animus) und des Schattens verweisen die Gegensatzpaare auf einen wichtigen Aspekt in Jungs Theorie, nämlich „wie Menschen mit widerstreitenden Kräften in sich kämpfen“ (Pervin/Cervone/John 2005: 190). Nach Jung führt der Mensch z. B. einen Kampf zwischen der Maske (Persona) und dem privaten Selbst, mit anderen Worten kann eine Überbetonung der Persona zum Verlust des Selbstgefühls führen, eine Ablehnung der weiblichen Anteile des Mannes eine kalte, unsoziale und aggressive Persönlichkeit bilden und umgekehrt (vgl. ebd.).
Die kontrapunktische Struktur setzt sich auch an Jungs Einstellungstypen der Introversion und Extraversion fort. In „Psychologische Typen“(Jung 1995), eines von Jungs Hauptwerken, problematisiert er das Typenproblem in historischer, kultureller, philosophischer, psychiatrischer und geisteswissenschaftlicher Hinsicht. Im dritten Kapitel „Das Apollinische und Dionysische“ (142-153) bezieht er sich bei dem Gegensatzpaar eng auf Nietzsches apollinischen und dionysischen Trieb und ordnet diese den Typen Extraversion und Introversion zu (vgl. Jung 1995 151 ff.). Ersteren ordnet Jung dem introvertierten Typ zu, zweiten dem extrovertierten Typ. Der introvertierte Typ ist eher nach innen gerichtet, während der extrovertierte Typ sich mehr auf die äußere Realität bezieht. Jung geht davon aus, dass jeder Mensch beide Anteile in sich hat, wobei ein Typ aber dominiert und bewusst ist, die andere Einstellung dagegen eher latent, unbewusst auftritt.
Aus den psychologischen Funktionen (Denken, Fühlen, Wahrnehmen, Intuieren) leitet Jung einen Denktyp, einen Fühltyp, einen Wahrnehmungstyp und einen Intuitionstyp ab. Mit anderen Worten, eine Funktion dominiert beim Menschen, während die anderen zwar vorhanden, aber als „inferiore Funktionen“ (Correll 1976: 44, Herkner 1992: 340) schwächer entwickelt sind und sich z. B. in Träumen und Phantasien ausdrücken. Nach Jung kann die vollständige Synthese aller Funktionen nur durch eine absolute Selbstverwirklichung erreicht werden, die aber nur ein Ideal und damit unerreichbar ist. Festzuhalten bleibt, dass in Jungs sehr komplexem Persönlichkeitssystem Spannungen und Konflikte jederzeit möglich sind. Die strukturellen Komponenten beeinflussen sich gegenseitig, sie können sich entgegenstellen, ausgleichen oder auch vereinigen (vgl. Correll 1976: 45).
2.4.3 Prozess
Nach Jung ist jedes lebendige Sein und somit auch psychisches Sein nur als Bewegung zu verstehen. Diese Bewegung wird nicht wie bei Adler ausschließlich eingleisig- linear gedeutet, sondern ereignet sich stets im Spannungsfeld zweier Pole (vgl. Brühlmeier 1974, Kapitel II, Abschnitt 2). Leben ist nach Jung ein energetischer Prozess. „Energie aber beruht notwendigerweise auf einem vorausgehenden Gegensatz, ohne welche es gar keine Energie geben kann. Immer muss Hoch und Tief, Heiss und Kalt usw. vorhanden sein, damit der Ausgleichsprozess, welcher eben Energie ist, stattfinden kann“ (Jung 1971: 82, in: ebd.). Und so lautet seine Überzeugung: „Nur am Gegensatz entzündet sich das Leben“ (ebd.: 58). Jungs Persönlichkeitsdynamik wird anhand zweier Prinzipien, an die er sich orientiert, verständlich (Correll 1976: 45 ff.). Im ersten Fall handelt es sich um das Äquivalenzprinzip, das besagt, dass die Summe der Energie immer gleich bleibt, auch wenn sie an einer Stelle zurückgenommen wird. Hier hat Jung das Helmholtzsche Prinzip der Erhaltung der Energie auf die Psychologie angewandt (ebd.). Innerhalb der strukturellen Komponenten kann dann z. B. dem Ich Energie abgezogen und auf ein anderes System, z. B. der Persona übertragen werden. Das zweite Prinzip bestimmt er als Entropieprinzip. Dieses, ursprünglich aus der Thermodynamik stammende Prinzip besagt, dass zwei Körper mit unterschiedlichen Temperaturen bei einer Berührung sich auf ihre Wärme bezogen angleichen, bis beide schließlich dieselbe Temperatur haben. Das Prinzip findet nun in Jungs Persönlichkeitssystem insofern ihre Anwendung, als die psychische Energie nach einem Gleichgewichtszustand strebt (ebd.: 46). Der Gleichgewichtszustand ist aber nur ein angestrebtes Ideal der Persönlichkeit, der nach Jung nie vollständig erreicht werden kann. Im Falle der Einstellungen der Introversion und der Extraversion muss man sich das so vorstellen:
„Ein ausgesprochen stark extravertierter Mensch wird sich gleichsam unter einem energetischen Druck fühlen, indem das Gleichgewicht in seiner Persönlichkeit durch eine Energieverlagerung in Richtung auf Introversion angestrebt wird“ (ebd.: 47). Die psychische Energie hat zwei Funktionen: Zum einen ist sie auf angeborene, instinktive Bedürfnisse gerichtet (Nahrung, Sexualität) und zielt somit auf die Erhaltung des Lebens generell ab, zum anderen fokussiert sie geistige und kulturelle Aktivitäten, die nach Jung auf einer höheren Stufe angesiedelt sind.
2.4.4 Wachstum und Entwicklung
Jung hat im Unterschied zu Freud kein spezielles Phasenmodell der Entwicklung konzeptualisiert, dennoch weist er auf typische Merkmale in bestimmten Lebensphasen hin (vgl. Correll 1976: 49 ff.). Er betont, dass in frühen Kindesjahren die Libido auf Aktivitäten gerichtet ist, die dem psychischen Überleben gewidmet ist. Ab dem fünften Lebensjahr entstünden sexuelle Werte, die sich schließlich in der Pubertät stärker entfalten. Eine völlige Umorientierung erfährt der Mensch nach Jung gegen Ende der dreißiger Jahre, denn nun treten gesellschaftliche, religiöse und philosophische Werte in den Vordergrund, mit anderen Worten, „der Mensch wird zu einem geistigen Menschen“ (ebd.: 50). Nach Jung kann die Entstehung einer Neurose auch dadurch begünstigt werden, dass sich die psychische Energie in dieser Übergangsphase nicht auf diese Werte richtet. Im Gegensatz zu Freud sieht Jung die Entwicklung der Persönlichkeit nicht nur einseitig in der frühen Kindheit festgelegt, neben den kausalen Aspekt betont er auch den finalen Aspekt der Persönlichkeit. Wäre der Mensch einseitig kausal determiniert, so wäre er Jung zufolge gefangen in seiner Vergangenheit. Der Mensch setzt sich aber auch Ziele, die seinem Leben Sinn verleihen. Jung spricht auch von einer „causa finalis“(Jung: 52, in: Alt 1986); diese Komplementarität teleologischer und reduktiv- kausaler Aspekte transportiert er im Unterschied zu Freud auch in den Träumen. Somit weisen nach Jung Trauminhalte nicht nur einseitig auf Erfüllungen verdrängter, zurückliegender Wünsche hin, sondern er sieht in Traumanalysen einen sich manifestierenden Entwicklungsvorgang, ein unbewusster Prozess, den er auch als Individuation bezeichnet (vgl. ebd.: 62 ff.).
„Individuation bedeutet: zum Einzelwesen werden, und, insofern wir unter Individualität unsere innerste, letzte und unvergleichbare Einzigartigkeit verstehen, zum eigenen Selbst. Man könnte „Individuation darum auch als „Verselbstung“ oder als „Selbstverwirklichung“ übersetzen“ (Jung 1991: 59). Jung betont, dass der Begriff der Individuation nicht mit Egoismus oder Individualismus verwechselt werden darf, denn der Mensch setzt sich seiner Sichtweise entsprechend aus universalen, kollektiven Faktoren zusammen. Der Zweck des Individuationsprozesses besteht darin, die verschiedenen widerstreitenden Kräfte der Persönlichkeit harmonisch miteinander zu integrieren, sie zu einer harmonischen Ganzheit zu führen, um somit die Einheit im Selbst zu finden, eine von jedem Individuum zu bewerkstelligende, aber nie völlig zu erreichende Aufgabe (s. Correll 1976: 51/ Pervin/Cervone/John 2005: 190, Jacobi 1959: 165 ff.). Das Selbst, als unbewusste, im kollektiven Unbewussten archetypische Kraft hat nach Jung somit eine leitende und motivierende Funktion zur Erreichung einer harmonischen Ganzheit der Persönlichkeit. Jung sah in den Mandalas Symbole, die das ganzheitliche Streben des Menschen widerspiegeln. Da er das Selbst ins kollektive Unbewusste verlagert, müssten die Mandalas in verschiedenen Kulturen sehr ähnlich sein, was auch tatsächlich so ist (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 191).
Der Vorgang der Sublimation spielt innerhalb des Individuationprozesses eine nicht unerhebliche Rolle (vgl. Correll 1976: 51 ff.). Jung geht in diesem Punkt mit Freuds Annahmen konform, dass die psychische Energie umgewandelt werden kann in Richtung auf eine kulturelle, religiöse oder geistige Betätigung. Er sieht in der Sublimation eine integrative Kraft zur Erlangung einer harmonischen Ganzheit, in der Verdrängung dagegen eine desintegrative, der Individuation zuwiderlaufende Kraft, die entsprechend Freud psychische Störungen begünstigen kann. Nach Jung wird Selbstverwirklichung auch dann ermöglicht, wenn das Individuum den Gegensatz zwischen Individualismus und Kollektivismus bewältigt. Eine einseitige Orientierung in eine Richtung hin bewertet er als pathogen, d. h. ein extremer Individualismus missachte Kollektivnormen in der Weise, dass ein Individuum nicht mehr lebensfähig ist, umgekehrt führe eine extreme kollektive Lebensführung zur Zerstörung der eigentlichen Moralität. Er will letztlich beide „Ismen“ in einer komplementären Beziehung zueinander setzen (vgl. Jung 1995: 470 ff.).
2.4.5 Psychopathologie und Veränderung
Jung hat kein „allgemeingültiges“ Rezept aufgestellt, um Wege der Persönlichkeitsver- änderung zu ermöglichen (vgl. Jacoby 1959: 90 ff.). Die Psychotherapie im Jungschen Sinne ist eine Art „Heilsweg“, die Effekte der Psychotherapie „muss man an seine lebendige Wirkung an sich erfahren“ (ebd.). Da er die Sexualität (Freud) und das Machtstreben (Adler) anerkennt, finden gelegentlich sowohl die Freudschen als auch die Adlerschen Techniken ihre Anwendung. Aufgrund der Hinzufügung zweier weiterer potentiell pathogen wirkenden Triebfaktoren, das geistige und religiöse Bedürfnis, wird die Behandlung aber um diese Dimensionen erweitert. Generell werden die Methoden und Techniken auf den Einzelfall abgestimmt, von daher sind sie unbestimmt (ebd.: 91).
2.4.6 Menschenbild
Aus den bisherigen Erläuterungen lassen sich einige grundlegende Aspekte des Jungschen Menschenbildes ableiten. Die philosophische Fragestellung, ob der Mensch gut oder böse ist, will Jung nicht einseitig in eine bestimmte Richtung tendierend bestimmen. Anhand des Schattenmotivs wird deutlich, dass die menschliche Natur sich aus beiden Komponenten konstituiert, d. h., dass Gut und Böse nach Jung eine komplementäre Einheit bilden. Jung vertritt eine Art philosophischen Relativismus, wenn er sagt: „Zum Licht gehört der Schatten, zum guten gehört das Böse und umgekehrt“ (Jung 1991: 20). Analog dazu führt Jung eine lange Liste von Archetypen auf, in denen sich Lichtgestalten wie Götter und Engel und „dunkle“ Gestalten wie Hexen, Dämonen die Hand reichen. Dabei sollte sich der Leser damit vertraut machen, dass Jung nicht von metaphysischen Phänomenen spricht. Es handelt sich (Gott, Geister, Dämonen) Jung zufolge um psychische Tatsachen, „psychische Erscheinungsformen der Instinkte, insofern sie habituelle und universal vorkommende Verhaltensweisen und Denkweisen darstellen“ (Jung: 359, in: Alt 1986). Anhand der beschriebenen Persönlichkeitsdynamik wird auch bewusst gemacht, dass Jung die psychischen Prozesse, das menschliche Sein insgesamt als äußerst ambivalent bewertet, eingebettet in einer Vielzahl von Gegensatzpaaren. Und das ist meiner Meinung nach ein fundamentaler Unterschied zu Freud und Adler, die, wie hoffentlich aus meinen Ausführungen ersichtlich, die Dynamik des Lebens auf ein duales Prinzip reduzieren, bei Adler nämlich das Minderwertigkeits- Geltungs- bzw. Machtstreben, bei Freud die Dualität von Lust- und Todestrieb. Man könnte Jungs Denkweise auch als polar- komplementär bezeichnen, eine Haltung, die von Gegensätzlichkeiten ausgeht, dennoch aber ein „Sowohl- als auch“ berücksichtigt (vgl. Brühlmeier 1974, Kapitel II, Abschnitt
1). Im Falle von Freuds kausaler und Adlers kausal- finaler Denkweise ist das so: „Ich kann keine der beiden Autoren eines fundamentalen Irrtums zeihen, sondern bin im Gegenteil bestrebt, beiderlei Hypothesen soweit wie möglich anzuwenden, indem ich ihre relative Richtigkeit durchaus anerkenne“ (Jung: 60, in: Alt 1986). Was Jung an Adler und Freud auszusetzen hat ist ihre Absolutsetzung in der Sicht vom Menschen. Eine Haltung, die Relativität negiert und sie durch endgültige Wahrheiten ersetzt. Eine Sicht vom Menschen, die beinahe schon dogmatisch anmutet, in denen Zweifel und Widersprüche erst gar nicht toleriert werden, insofern auch einen apodiktischen Charakter haben (vgl. Jung 1991: 23 ff., 1986: 39 ff.).
In Jungs Menschenbild hat auch das geistige und religiöse Bedürfnis des Menschen seinen Platz. Jacobi hebt diesen Aspekt deutlich hervor, der in Adlers und Freuds Menschenbild ihrer Sicht nach zu kurz komme (vgl. Jacobi 1959: 92 ff.). Die geistige Dimension mutet aber bei Jung sonderbar, denn „das Geistige erscheint in der Psyche auch als ein Trieb, ja als wahre Leidenschaft. Es ist kein Derivat eines anderen Triebes, sondern ein Prinzip sui generis, nämlich die der Triebkraft unerlässliche Form“ (Jacoby 1959: 93).
2.4.7 Bewertung und Einschätzung
Ich konnte hier aufgrund der ungeheuren Komplexität, die Jungs Analytische Psychologie auszeichnet, lediglich auf ein paar für mich wesentliche Aspekte eingehen. Ich gebe Correll Recht, wenn er sagt, Jungs Werk ist insgesamt schwer verständlich. Als Kritikpunkte könnte man einbringen, dass gerade sein Konzept der Archetypen für viele ein „Rückfall in vorwissenschaftliches Denken“ (Correll 1976: 53) darstellt. Sicherlich ein großer kreativer Denker des 20. Jahrhunderts, der aber eine spekulative, wissenschaftlich schwer überprüfbare Theorie aufgestellt hat (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 191 ff.).
3. Lerntheoretische Persönlichkeitstheorien
3.1 Die Persönlichkeitstheorie des John B. Watson (1878-1958)
3.1.1 Biographie
John B. Watson (1878- 1958) war der Begründer der psychologischen Richtung, die als Behaviorismus bezeichnet wird. Zunächst studierte er Philosophie an der Universität Chicago, widmete sich dann aber dem Studium der Psychologie, in dem er auch Kurse in Neurologie und Physiologie belegte. Seine Forschungsarbeiten konzentrierten sich auf eine große Anzahl von Tierversuchen, in denen er u. a. die Komplexität des Verhaltens von Ratten untersuchte. Noch bevor er seinen Doktortitel erhielt kam es zu einem psychischen Zusammenbruch verbunden mit Schlaflosigkeit und anderen Begleiterscheinungen. Zu dieser Zeit akzeptierte er Freuds Annahmen über die Persönlichkeit (Watson 1936, zit. in: Pervin/Cervone/John 2005: 437). Watson entwickelte während seiner Abschlussarbeit in Chicago klare Vorstellungen von Forschungsarbeiten:
„In Chicago habe ich zum ersten Mal zögernd formuliert, was später mein Standpunkt wurde. Ich wollte nie menschliche Versuchsobjekte verwenden. Ich selbst hasste es, Versuchsperson zu sein... Mit Tieren hatte ich dagegen keine Probleme. Wenn ich sie erforschte, hatte ich das Gefühl, dass ich mich streng an die Biologie hielt und mit den Beinen fest auf dem Boden stand...“ (Watson 1936: 276, zit. in: ebd.: 437).
Watson wechselte von der Universität Chicago zur John Hopkins University, wo er als Professor bis 1919 lehrte. 1914 veröffentliche er das Buch „Behavior“, in dem er seine grundlegenden psychologischen Überzeugungen von der ausschließlichen Untersuchung beobachtbaren Verhaltens und die Ablehnung der Introspektion als Forschungsmethode formulierte. Watsons Thesen brachten ihm viel Ruhm ein; 1915 wurde er schließlich zum Präsidenten der American Psychological Association gewählt. Watson musste seine Karriere als Forscher aufgrund privater Vorkommnisse aufgeben, und er begann darauf eine Karriere in der Werbung.
3.1.2 Struktur
Watson konzentrierte sich, ähnlich wie Skinner es tat, ausschließlich auf das beobachtbare, durch Reize induzierte Verhalten. Verhalten sollte nach Watson immer mit „Reiz und Reaktion“ beschreibbar sein. Ähnlich wie Skinner hielt er Begriffe wie „Bewusstsein“ oder „Seele“ für unwissenschaftlich: „Niemand hat jemals eine Seele berührt oder sie in einem Reagenzglas gesehen oder ist auch nur in irgendeiner Weise mit ihr in Berührung gekommen wie mit anderen Objekten des täglichen Lebens“ (Watson 1976: 37).
3.1.3 Prozess
Watson war bei seinen Konditionierungsstudien stark beeinflusst von den Arbeiten des russischen Physiologen Iwan Petrowitch Pawlow (1849-1936). Zur Erinnerung: Anhand von Hunden demonstrierte er den Vorgang der klassischen Konditionierung (Signallernen, respondente / reaktive Konditionierung). Dabei wurde eine Speichelabsonderung durch ursprünglich neutrale Reize (z. B. Glocke) ermöglicht, indem durch mehrmalige, fast gleichzeitige Darbietung eines neutralen Stimulus mit einem unkonditionierten Stimulus (räumlich-zeitliche Kontiguität) aus dem neutralen Reiz ein Signalreiz wurde (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 438 ff./Bredenkamp in: Brinkmann 1980: 212 ff.). Watson und Rayner (1920) übertrugen diese Erkenntnisse nun auf den Menschen, indem sie bei einem kleinen Jungen („der kleine Albert“) aufgrund der gleichzeitigen Darbietung einer Ratte (neutraler Stimulus) mit einem Angsterzeugenden Geräusch (unkonditionierter Stimulus) eine emotionale Angstreaktion hervorriefen. Die Ratte wurde nun selbst zum Angstauslöser. Im weiteren Verlauf wurde auf Reize, die dem konditionierten Reiz ähnelten, in gleicher Weise reagiert (Reizgeneralisation). Auf Reize, die dem konditionierten Reiz nicht ähnelten (z. B. Bauklötze) zeigte Albert positive emotionale Reaktionen (Diskrimination). Wurde die zeitlich- räumliche Kontiguität der Reize aufgehoben unter Beifügung eines angenehmen Reizes (z. B. Essen), konnte sich wieder eine normale Reaktion einstellen, das Verhalten wurde gelöscht (Extinktion).
Mit den letzten Ausführungen wird deutlich, wie Angstzustände konditioniert werden können und durch Darbietung angenehmer Reize zum Verschwinden gebracht werden. Von daher verzichte ich auf das Kapitel „Psychopathologie und Veränderung“.
3.1.4 Menschenbild
Watson sagte einmal, er könne jedes neugeborene Kind nach Belieben formen, es z. B. zu einem Arzt, einem Rechtsanwalt oder einem Dieb machen. Diese Aussage entspricht einer amerikanischen Mentalität, nach der jeder von Geburt an mit gleichen Rechten und Möglichkeiten ausgestattet ist (Steden 2004: 47ff.). Würde man die Aussage in einer Anlage- Umwelt Diskussion einbringen, käme mit Sicherheit Kritik von Seiten der Anlagen- Theoretiker. Watson selber schenkte den Anlagen des Menschen wenig Beachtung im Hinblick auf die spätere Persönlichkeitsentwicklung. Seinen Vorstellungen gemäß bestimmt die Umwelt das Verhalten des Menschen. Es handelt sich um ein deterministisches, mechanistisches Menschenbild. Der Mensch erscheint dieser Sichtweise entsprechend als passiver Organismus, der lediglich auf äußere Reize reagiert.
3.1.5 Auffassung von Wissenschaft, Theorie und Forschung
Watsons` Auffassung von Wissenschaft kommt im folgenden Zitat passend zur Geltung: „Der Behaviorismus ist (...) eine Naturwissenschaft, die das gesamte Gebiet menschlicher Anpassungsvorgänge umfasst. Sein nächster Nachbar in den Wissenschaften ist die Physiologie“ (Watson 1976: 43). Und weiter heißt es: „Es ist die Aufgabe der behavioristischen Psychologie, menschliches Verhalten vorherzusagen und zu kontrollieren. Zu diesem Zweck müssen wissenschaftliche Daten mit Hilfe experimenteller Methoden zusammengetragen werden“ (ebd.: 44).
3.2 Die Persönlichkeitstheorie des B. F. Skinner (1904-1990)
3.2.1 Biographie
B. F. Skinner (1904- 1990) wurde 1904 in Pennsylvania in einer Rechtsanwaltsfamilie geboren. Seinen Vater beschrieb er als einen Menschen, der viel Lob austeilte, die Mutter dagegen als eine Person, die klare Vorstellung von richtigem und falschem Verhalten hatte. Schon während der Kindheit zeigte er großes Interesse in der Beschäftigung mit mechanischem Spielzeug, er konstruierte z. B. ein kleines Flugzeug und baute eine Maschine, mit der man reife und unreife Beeren sortieren konnte. Am Hamilton College studierte er zunächst englische Literatur. Sein berufliches Ziel bestand anfangs darin, Schriftsteller zu werden und er schrieb mehrere Kurzgeschichten, für die er auch eine positive Resonanz erhielt. Nach dem College gab er jedoch das Schreiben auf, da er seiner Meinung nach nicht wusste, worüber er eigentlich noch schreiben konnte. Es kam dann zu der Beschäftigung mit Watsons` Behaviorismus, so dass bald darauf ein Psychologiestudium in Harvard folgte, wo er schließlich 1931 promovierte. Schon vor diesem Studium, verstärkt aber während der Promotionszeit zielte sein Interesse auf die Beobachtung der Verhaltensweisen von Tieren, insbesondere der von Ratten ab. Nach Harvard folgten einige Ortswechsel: Zunächst ging er nach Minnesota, dann nach Indiana und 1948 kam er schließlich wieder nach Harvard zurück. Während dieser Zeit lernte er, wie man Ratten und Tauben bestimmte Verhaltensweisen antrainieren konnte. Seine Methode des operanten Konditionierens zeigte, wie tierisches Verhalten gezielt durch die Manipulation mit Belohnungen und Bestrafungen kontrolliert werden konnte. Skinner war aber auch davon überzeugt, dass die Gesetzmäßigkeiten tierischen Verhaltens auch auf menschliche Phänomene übertragen werden können. So baute er beispielsweise eine Baby- Box, um die Pflege eines Babys zu automatisieren, aber auch Unterrichtsmaschinen, die das didaktische Mittel der Belohnung benutzten. Skinner erhielt im Laufe seines Lebens mehrere Auszeichnungen, u. a. 1968 die National Medal of Science (sämtliche Informationen aus: Pervin/Cervone/John 2005: 452 ff.)
3.2.2 Struktur
Strukturelle Konzepte wie das Selbst noch Rogers oder das Es, Ich und Über-Ich nach Freud haben in Skinners Theoriegebäude keinen Platz, es handelt sich seiner Sichtweise entsprechend nur um hypothetische Konstrukte, Homunkuli innerhalb der Person und um „fiktive Erklärungen“ (Skinner 1973: 264), die nur dann von Nutzen sein könnten, wenn es der Forschung gelinge, sie als ein „funktional- geschlossenes Reaktionssystem darzustellen“(ebd.). Und Skinner verlagert diese Modelle auch nach außen, wenn er sagt, „die drei Persönlichkeiten des Freudschen Schemas repräsentieren wichtige Verhaltenscharakteristika in einem sozialen Milieu“ (ebd.). Somit bleibt nach Skinner lediglich die Reaktion als strukturelle Schlüsseleinheit bestehen, wobei er zwischen Reaktionen unterscheidet, die durch einen Stimulus ausgelöst werden (z. B. Lidschlagreflex durch Luftzug) und solchen, die spontan (emittiert) entstehen. Skinner ging davon aus, „dass der Mensch ein aktives Wesen ist“ (Steden 2004: 50), der spontanes, im Organismus begründetes Verhalten zeigt: „Es gibt keinen auslösenden Umweltreiz für operantes Verhalten; es tritt einfach auf...Ein Hund läuft, rennt, tollt herum; ein Vogel fliegt...in jedem dieser Fälle tritt das Verhalten ohne einen spezifischen auslösenden Reiz auf...“ (Reynolds 1968: 8, zit. in: Pervine/Cervone/John 2005: 456).
3.2.3 Prozess
Der Mensch als aktives Wesen ist nach Skinner auf die Verstärkungen seiner Tätigkeiten ausgerichtet; für diese Einsicht benutzte er auch den Begriff des operanten Konditionierens, demzufolge bestimmte Reaktionen durch Verstärkungen häufiger auftreten sollen (vgl. Skinner 1973: 70). Mit seiner selbst konstruierten Skinner- Box wollte er die Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens demonstrieren. In dieser Versuchsvorrichtung konnte man das Verhalten von Ratten und Tauben beobachten, die z. B. durch Hebeldrücken (Ratte) oder Tastenpicken (Taube) Futter erhielten. Die erwünschte Aktivität (z. B. Taste bedienen) wurde durch eine nachfolgende Belohnung erlernt. Skinner nannte diesen Vorgang positive Verstärkung. Skinner zeigte anhand von Laborraten auch, wie Ratten negativ verstärkt wurden. So wird eine Ratte z. B. nur dann nicht mit einem Stromstoß gequält, wenn sie auf eine bestimmte Taste drückt. Dieses Verhalten zeigte sie immer häufiger, um die Bestrafung zu vermeiden. Im Unterschied zu Thorndikes Katzenkäfigen wurde in der Skinner - Box jedes Verhalten, das in Richtung des erwünschten Endverhaltens ging, verstärkt (Steden 2004: 50). Skinner unterschied zwischen verschiedenen Darbietungen der Verstärkungen, z. B. der periodischen Zeitintervallsverstärkung, nach der die Verstärkung nach einem bestimmten Zeitraum (z. B. alle 10 Sekunden) erfolgt, oder der periodischen Reaktionsquotenverstärkung, nach der der Organismus z. B. zweimal die gewünschte Verhaltensform äußern muss, bevor er verstärkt wird. Correll lobt Skinners Verstärkungstheorie, da er auch zeigte, wie Verhalten intrinsisch motiviert wird, d. h. nicht mehr auf äußere Verstärker angewiesen ist (vgl. Correll 1976: 179).
3.2.4 Wachstum und Entwicklung
Skinner hat weder ein Phasen- oder Stufenmodell der Entwicklung konstruiert, noch kann überhaupt von einem Entwicklungspsychologen gesprochen werden (Flammer 2005: 52). Lernen vollzieht sich entsprechend der klassischen und operanten Konditionierung. Im Wesentlichen vollzieht sich „Entwicklung“ durch Verstärkungsprogramme, die dem Erwerb und Zeigen von Verhalten dienen. Ein Kind erlernt z. B. Reaktionen, die unter der Kontrolle von Verstärkungskontingenzen in der Umwelt bleiben. Es geht vor allem um „spezifische Reaktionen, wie sie durch bestimmte Umweltverstärker beeinflusst werden“ (Pervin/Cervone/John 2005: 458). Der Skinnersche Ansatz ist ein exogenistischer, d. h. „Entwicklung“ wird verstanden als ein Produkt äußerer Einflüsse und Bedingungen.
3.2.5 Menschenbild
Man kann das Menschenbild Skinners` sowohl als optimistisch als auch als äußerst beunruhigend, geradezu fatalistisch bezeichnen. Optimistisch ist es insofern, als Verhalten jederzeit durch die Veränderung von Umweltvariablen verändert werden kann. Gerade in den 60er Jahren war dieser Veränderungsoptimismus spürbar (vgl. Flammer 2005: 63). Fatalistisch deshalb, weil nach Skinner „jedes Verhalten bedingt ist durch vorausgegangenes Verhalten, so dass man von einem totalen Determinismus des menschlichen Verhaltens sprechen muss“ (Correll 1976: 174). Eine solche Haltung schließt eine freien Willen des Menschen völlig aus (s. auch Flammer 2005 60ff./ Pervine/Cervone/John 2005: 464 ff.). Auf einen ähnlichen Fatalismus weisen Nolting/Paulus hin, wenn sie betonen, dass der Behaviorismus den Menschen bezogen auf die Lerngesetzmäßigkeiten keine Sonderstellung einräumt, sie in dieser Hinsicht sogar mit Ratten, Mäusen und Tauben gleichsetzt (vgl. Noltin/Paulus 1996: 155). Skinner selber habe sich zum Aspekt der menschlichen Manipulation dahingehend geäußert, dass er den Begriff positiv auslege in Richtung einer pädagogischen Veränderung des Verhaltens, mit der auch humane, ethische Ziele insgesamt realisiert werden sollen (vgl. Correll 1976: 175). Flammer spricht auch von einem mechanistischen und einem individualistischen Menschenbild (Flammer 2005: 60 ff.). Mechanistisch deshalb, weil Skinner menschliches Verhalten immer in einem Ursache- Wirkungs Bedingungsgefüge betrachtet, individualistisch, da er sich bei seinen Beobachtungen immer auf das einzelne Individuum bezieht.
3.2.6 Auffassung von Wissenschaft, Theorie und Forschung
Nach Skinner ist die Wissenschaft eine „Suche nach Ordnung, nach Überein- stimmungen, nach gesetzmäßigen Relationen zwischen den Vorgängen in der Natur. Sie beginnt, so, wie wir alle beginnen, mit dem Beobachten einzelner Episoden, doch strebt dann rasch weiter zur allgemeinen Regel, zum wissenschaftlichen Gesetz“ (Skinner 1973: 22). Dasselbe postuliert er nun für eine Wissenschaft des Verhaltens, die das Ziel verfolgt, mittels des Einsatzes von bestimmten Instrumenten, Techniken und genauen Beobachtungen Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens aufzuzeigen. Skinner geht es um eine möglichst präzise Vorhersage, Lenkung und Kontrolle menschlichen Verhaltens, die durch die Lokalisierung und Analyse der dem menschlichen Verhalten zugrunde liegenden Ursachen erreicht werden soll. Flammer (Flammer 2005: 60) spricht in diesem Kontext von einer wissenschaftlichen Haltung, die als funktionalistisch und pragmatisch bezeichnet werden kann. Funktionalistisch deswegen, zumal Skinner bemüht war, Zusammenhänge von Ursachen und Wirkungen aufzuzeigen, pragmatisch, da er Verhalten beeinflussen und aktiv verändern wollte.
Darüber hinaus spielen für eine Wissenschaft des Verhaltens innerpsychische Vorgänge nur eine marginale Rolle, da sie nicht beobachtbar sind und somit für eine Erklärung und Vorhersage des Verhaltens wenig Nutzen haben. Auch genetische Faktoren bei der Ausformung des Verhaltens spielen so eine nur begrenzte Rolle. Skinner ignoriert genetische Faktoren nicht völlig, sie liefern aber nur „fiktive Erklärungen des Verhaltens“ (Skinner 1973: 33), auf die man ohnehin keinen Einfluss mehr nehmen kann.
3.2.7 Bewertung und Einschätzung
Nach Watson reagieren Organismen nur passiv auf äußere Reize, Skinner dagegen betont spontan auftretendes Verhalten, wobei der Organismus beim operanten Verhalten auf die Umwelt einwirkt. Das ist ein wichtiger Unterschied. In der Praxis der Sozialen Arbeit kommen die Prinzipien der operanten Konditionierung z. B. in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Form der Tokensysteme direkt zur Anwendung. Der Sozialarbeiter als „Verhaltenstechniker“ belohnt das erwünschte Patientenverhalten mit „Tokens“ (Chips, Spielmarken), die dann in Produkte eingetauscht werden können (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 463 ff.) Forschungsergebnisse bestätigen (Kazdin 1977) die Wirksamkeit von Tokensystemen bei psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen. Diese praktische Anwendung belegt, dass der orthodoxe Behaviorismus auch heute noch von Bedeutung ist. Die Interpretation des Falles vom „kleinen Hans“ (Freud 1909) klingt lerntheoretisch gedeutet plausibler. Wolpe und Rachman (1960) betrachten die Pferdephobie nicht als Resultat ödipaler Konflikte, sondern als eine konditionierte Angstreaktion. Für sie gibt es keinerlei Belege für eine ödipale Problematik des kleinen Hans, eine Ansicht, die ich mit ihnen teile.
Die Bedeutung des Behaviorismus liegt sicherlich auch darin begründet, dass er den Weg für den Kognitivismus („kognitive Wende“) vorbereitete, eine generelle Lernfähigkeit nachweisen konnte und das spekulative an der Psychologie durch exakte wissenschaftliche Methoden reduzierte (Steden 2004: 50 ff.).
Zwei negative Kritikpunkte sollen aber nicht unerwähnt bleiben. In „Jenseits von Freiheit und Würde“ (Skinner 1971) will uns Skinner von einer Freiheitsillusion überzeugen (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 464 ff.). Der Linguist und Politikwissenschaftler Chomsky (1987) vertritt die Ansicht, dass es dafür keine Belege gebe, weil Skinner eine experimentelle Datenbank benutzte, die sich auf Tieren bezog. Ich selber bin der Meinung, dass allein schon das Lesen seines Buches ein Ausdruck für die Wahl einer freien Entscheidung ist. Zum anderen wird der Behaviorismus der menschlichen Komplexität des Verhaltens nicht gerecht (Pervin/Cervone/John 2005: 468 ff.). Verhaltensweisen sind mehr als Reiz-Reaktions-Verbindungen (Watson) und „operants“ (Skinner).
4. Sozial-kognitive Lerntheorien
4.1 Die Persönlichkeitstheorie des Albert Bandura (*1925)
4.1.2 Biographie
Albert Bandura wurde 1925 in Kanada geboren und begann sein Studium an der University of British Columbia, seine Promotion in klinischer Psychologie erfolgte an der State University of Iowa. Bandura wurde durch mehrere Persönlichkeiten beeinflusst, beispielsweise von Kenneth Spence, der die lerntheoretischen Annahmen Clark Hulls` vertrat, aber auch von Neal Miller und John Dollard, die bestrebt waren, lerntheoretische Erkenntnisse bei der Untersuchung der Persönlichkeit anzuwenden. Nachdem er seinen Doktor 1952 in Iowa gemacht hatte, ging er zur Stanford University, wo er begann, sich „bei seiner Arbeit mit interaktiven Prozessen in der Psychotherapie und mit familiären Mustern zu beschäftigen, die zu Aggressivität bei Kindern führen“ (Pervien/Cervone/John 2005: 518). Sowohl bei der Genese von Aggression als auch der Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen wies er dem Lernen durch Beobachtung eine besondere Bedeutung zu. Im Jahre 1969 veröffentlichte er das Buch „Principles of Behavior Modification“. Dieses Buch beeinflusste die Verhaltenstherapie insofern, als Therapeuten nun in der Arbeit mit ihren Klienten sich auch auf deren Denkprozesse stützten, anstatt ihren Blick nur auf Umwelt- oder Konditionierungsprozesse zu richten. Von den Auszeichnungen, die er erhielt, sind z. B. die 1980 erlangte Auszeichnung der Vereinigung für „vorbildliche Leistungen als Forscher, Lehrender und Theoretiker“ erwähnenswert.
4.1.3 Struktur
1. Kompetenzen und Fertigkeiten
Die sozial-kognitiven Lerntheoretiker sehen Unterschiede zwischen Personen weniger durch motivationale Impulse verursacht, als vielmehr durch kognitive Kompetenzen und Fertigkeiten. Unterschieden wird dabei zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen (vgl. Pervine/Cervone/John 2005: 524 ff.). Deklaratives Wissen ist das Wissen, das verbalisiert werden kann, prozedurales Wissen meint dagegen die Ausführung einer bestimmten Handlung, ohne genau erklären zu können, wie diese ausgeführt wurde. Ein konstitutives Merkmal von Kompetenzen ist ihre Kontextspezifizität (ebd.: 525). Darunter verstehen sozial- kognitive Lerntheoretiker die Tatsache, dass Kompetenzen nur in bestimmten Situationen brauchbar sind. Hervorragende Physikkenntnisse sind z.
B. bei Rendezvous nicht nützlich. Ferner wird davon ausgegangen, dass Kompetenzen durch soziale Interaktionen und Beobachtung erworben werden, wie es noch später am Beispiel des Modellernens gezeigt wird.
2. Überzeugungen und Erwartungen
Sozial-kognitive Theoretiker gehen davon aus, dass Erwartungen, die auf die Zukunft gerichtet sind, die Emotionen und das Handeln des Menschen lenken. Ähnlich wie bei den Kompetenzen wird auch hier die Variabilität von Erwartungen bei einer Person in unterschiedlichen Situationen unterstellt. Auf einer Party beispielsweise ist lautes, ausgelassenes Verhalten angemessen, während wohl niemand auf die Idee käme, sich in dieser Weise auch in der Kirche zu verhalten. Durch die Hervorhebung der Erwartungen weicht die sozial-kognitive Theorie entscheiden vom Behaviorismus ab. „Beim Behaviorismus wird Verhalten so verstanden, dass es durch Verstärkungen und Bestrafungen in der Umwelt verursacht wird. In der sozial-kognitiven Theorie wird Verhalten im Gegensatz dazu vor dem Hintergrund der Erwartungen von Personen bezüglich Belohnungen und Bestrafungen in der Umwelt erklärt“ (Pervin/Cervone/John 2005, 526). Bandura konzentrierte sich bei seinen Forschungen nun auch auf so genannte Selbstwirksamkeitserwartungen, also auf „Bewertungen von Personen, was sie in einem bestimmten Setting zu leisten vermögen“ (ebd.: 528). Zahlreiche Forschungen konnten belegen (Bandura/Locke 2003; Stajkovic/Luthans 1998), dass es einen Zusammenhang zwischen wahrgenommener Selbstwirksamkeit und Leistung gibt.
Bandura stellte die These auf, dass Selbstwirksamkeitswahrnehmungen ursächlich das Verhalten beeinflussen. Um diese These zu verifizieren, haben Forscher sich einer Technik bedient, die als Manipulation der „Verankerung“ bezeichnet wird (Pervin/Cervone/John 2005: 530). Dabei geht es um die Beeinflussung der wahrgenommen Selbstwirksamkeit durch scheinbar irrelevante situative Faktoren. Cervone und Peake (1986) hatten in einem Experiment den Teilnehmern Testaufgaben gegeben. Bevor sie diese lösen sollten, mussten alle Probanden beurteilen, ob sie mehr oder weniger der Aufgaben lösen konnten (jedem wurde ein hoher oder niedriger Wert vorgelegt). Das Ergebnis dabei war, dass diejenigen, die niedrigen Zahlen ausgesetzt waren, eine geringere Selbstwirksamkeitserwartung und damit auch eine geringere Ausdauer bei der Bearbeitung der Aufgaben zeigten. Somit wurde Banduras These bestätigt.
3. Ziele
Bandura ist grundsätzlich davon überzeugt, dass der Mensch sich über das Setzen von Zielen selbst reguliert, d. h. sein Verhalten steuern kann. Forschungsergebnisse weisen darauf hin (Bandura/Schunk 1981; Stock/Cervone 1990), dass unmittelbare Ziele einen größeren Einfluss auf das Verhalten haben als ferne Ziele. Außerdem stehen sie in einer wechselseitigen Beziehung zu den Erwartungen. Personen mit hohen Selbstwirksamkeitserwartungen setzen sich höhere Ziele und wollen diese auch eher verwirklichen (Locke/Latham 2002). Wichtig ist hier auch die Betonung der kognitiven Prozesse, insofern, als Individuen zwischen Zielen auswählen können.
4. Bewertungsmaßstäbe
„Die sozial-kognitive Theorie erkennt, dass Personen allgemein ihr fortlaufendes Verhalten nach internalisierten persönlichen Maßstäben bewerten“ (Pervin/ Cervone/John 2005: 535). Es handelt sich dabei um bestimmte Richtlinien, nach denen Menschen den Wert einer Person oder Sache beurteilen. Bewertungsmaßstäbe können auch auf moralische und ethische Prinzipien ausgerichtet sein (Bandura 1986), durch die sich aber nicht alle Menschen umfassend regulieren lassen. Viele Menschen machen sich frei von moralischen Maßstäben, indem sie z. B. bei Diplomarbeiten auf Quellenangaben verzichten (Bandura et al. 1996). Durch die Bedeutung der persönlichen, vom Individuum gesetzten Maßstäbe hebt sich die sozial- kognitive Theorie vom Behaviorismus ab, der bekanntlich die Bewertungsmaßstäbe einseitig durch den Forscher festlegt.
4.1.4 Prozess
1. Der schon im Menschenbild erwähnte „reziproke Determinismus“ demonstriert die menschlichen Vorgänge auf theoretischer Ebene. Bandura betrachtet menschliches Verhalten immer im wechselseitigen Zusammenspiel zwischen Verhalten, Persönlichkeitsfaktoren und Umweltfaktoren. In dieser Sichtweise hat ein einseitiges Ursache-Wirkungs-Denken („Ein-Weg-Paradigma“) wie z. B. in Skinners Forschungen ersichtlich wurde, keinen Platz (Bandura 1979: 202 ff.). Er vertritt dagegen ein „Zweiwege Paradigma“, nach dem der Mensch nicht nur einfach auf die Umwelt reagiert sondern sie auch aktiviert und selber schafft.
4.1.5 Wachstum und Entwicklung
1. Beobachtungslernen (Modell-Lernen)
Viele der bisher angeführten theoretischen Ideen kommen im Beobachtungslernen (Lernen am Modell) zur Geltung. Beim Beobachtungslernen unterscheidet Bandura vier Teilprozesse (Bandura 1979):
1. Aufmerksamkeitsprozesse
Beim Beobachten von Personen (Modell) findet eine Selektion statt, d. h. Personen nehmen nicht alle Reize von dem Modell wahr, die auf sie einwirken, sondern konzentrieren sich auf unterschiedliche Reize, die vom Modell ausgehen. Umfang und Art der Beobachtung ist von vielen Faktoren abhängig. Der soziale Umgang hat dabei eine große Bedeutung, denn Personen, mit denen wir regelmäßig umgehen, bestimmen, welche Verhaltenstypen wir regelmäßig beobachten. Das vom Modell ausgehende Verhalten wird auch dann eher internalisiert (imitiert), wenn es für uns nützlich ist (Funktionswert). Häufig schenken wir gerade den Modellen Beachtung, die positive, gewinnende Eigenschaften haben.
2. Behaltensprozesse
Behaltensprozesse sind insofern von Bedeutung, als durch sie der Imitierende bei der Nachahmung nicht mehr auf die Anwesenheit des Modells angewiesen ist. Bei diesem Vorgang werden die Reaktionsmuster des Modells symbolisch im Gedächtnis repräsentiert. Typisch für diese kognitiven Repräsentationen ist ihre Vielgestaltigkeit, denn sie „stellen keine isomorphen Abbilder des Beobachteten dar, sondern sie geben jeweils den Inhalt der Beziehung wieder, den der Beobachtete zu dem Gegenstand oder der Person hat“ (Steden 2004: 198).
3. Motorische Reproduktionsprozesse
Bei der Umsetzung der symbolischen Repräsentationen in Handlungen handelt es sich um einen komplizierten Prozess, der mehrere Teilfertigkeiten erfordert. Bei diesem Vorgang führt der Beobachter das beobachtete Verhalten schließlich in einer eigenen Weise aus, indem er es in seine Verhaltensorganisation integriert.
Eine klassische Studie von Bandura und seinen Mitarbeitern (Bandura et al. 1963 a) zeigte, dass Belohnung und Strafe einen Einfluss auf die Ausführung von Verhaltensweisen hat. In dieser Studie beobachteten drei Gruppen von Kindern ein Modell mit aggressiven Verhaltensweisen gegenüber einer Puppe. In der ersten Gruppe folgten keine Konsequenzen auf das Verhalten des Modells. In der zweiten wurde es belohnt und in der dritten bestraft. Die Kinder wurden nun unterschiedlichen Konditionen ausgesetzt. Es stellte sich heraus, dass die Kinder, die vorher attraktive Anreize bekamen um das Verhalten zu imitieren, eher bereit waren, es auch tatsächlich auszuführen. Außerdem wurde das Verhalten weitaus häufiger nicht imitiert, wenn die Kinder gesehen hatten, wie das Modell bestraft wurde. Somit lieferte die Studie den Beweis dafür, dass zunächst Verhaltensweisen unabhängig von Verstärkern erlernt werden, die tatsächliche Ausführung aber ist abhängig von den Konsequenzen (Belohnung oder Bestrafung).
4. Motivationsprozesse
Die Studie ging indirekt auch auf die Motivationsprozesse ein, denn durch die positiven Verstärker wurden die Kinder dahingehend motiviert, das Modellverhalten zu imitieren. Auch die Bestrafung des Modells wirkte sich auf die Motivation der Kinder aus, insofern als unerwünschtes Verhalten vermieden wurde.
Die vier Teilprozesse des Beobachtungslernens wurden nur sehr verkürzt dargestellt. Es sollte aber aus den bisherigen Ausführungen klar hervorgehen, dass die sozial-kognitive Theorie sehr komplex ist und mehrere Teilbereiche der Psychologie integriert (vgl. Steden 2004: 200). Bei der Beschreibung der Aufmerksamkeitsprozesse nutzt die sozial- kognitive Theorie Erkenntnisse der Kognitionspsychologie. Bei den Ausführungsprozessen bedient sie sich dem Wissen der Handlungspsychologie. Lernen im Zeitablauf lässt sich dagegen der Entwicklungspsychologie zuordnen. Aspekte, die die Selbstregulation betreffen, werden der Motivationspsychologie zugeschrieben (Halisch 1990: 389, in: ebd.).
4.1.6 Menschenbild
Für Bandura stehen die Auffassung von der Wissenschaft, deren Forschungsmethoden und das Menschenbild in einer wechselseitigen Beziehung zueinander (Bandura 1979: 9). Wer, z. B. wie Skinner es tat, den Menschen einen freien Willen nicht einräumte, legte in seiner Forschungstätigkeit entsprechend mehr Wert auf äußere Einflussquellen. Im Gegensatz zu den radikalen Behavioristen werden intrapsychische Prozesse in die Forschung mit einbezogen, um einem „verstümmelten Bild menschlicher Möglichkeiten“ entgegenzusteuern (ebd.). Sozial-kognitive Lerntheoretiker betrachten den Menschen nicht ausschließlich als rein passiv formbare Marionette äußerer Umwelteinflüsse, sie betonen auch die mit den Denkoperationen verbundenen Selbstregulierungsprozesse. Der Mensch ist in dieser Sichtweise weder ein völlig freies Subjekt noch ein ohnmächtiges Objekt.
Es handelt sich vielmehr um ein Menschenbild, das von „einer ständigen Wechselwirkung zwischen kognitiven Determinanten, Verhaltensdeterminanten und Umweltdeterminanten“ (ebd.: 10) ausgeht. Bandura benutzt für diese Austauschprozesse auch den Begriff des „reziproken Determinismus“.
4.1.7 Auffassung von Wissenschaft, Theorie und Forschung
Bandura war generell darum bemüht, eine Theorie der Persönlichkeit auf der festen Grundlage empirischer Forschungen aufzustellen, die auch das Wohlergehen der Menschheit mit berücksichtigt: „Ich war ungeheuer daran interessiert, die klinischen Arbeitsmethoden auf eine solidere empirische Basis zu stellen, und mein ganzes Interesse richtete sich darauf, klinische Phänomene so darzustellen, dass sie experimentell überprüft werden können. Wir als klinische Psychologen stehen in der Verantwortung, die Wirksamkeit unserer Methoden zu überprüfen, so dass Menschen nicht Behandlungen unterworfen werden, deren Wirkungen wir nicht kennen“ (Evans 1979: 254, zit. in: Pervine/Cervone/John 2005: 518).
4.2 Die Persönlichkeitstheorie des Walter Mischel (*1930)
Vorab möchte ich dem Leser darauf hinweisen, dass Mischel die Ansichten Banduras im Wesentlichen teilt (s. auch Pervin/Cervone/John 2005: 517) Ich gehe deshalb nur kurz auf ihn ein, indem ich das gemeinsam mit Shoda (1995) entwickelte Modell der Persönlichkeit erläutere, sowie sein Belohnungsaufschub-Paradigma kurz umreiße.
4.2.1 Prozess: Kognitiv-affektives Verarbeitungssystem (CAPS)
1. Kognitiv-affektives Verarbeitungssystem (CAPS)
Sozial-kognitive Theoretiker sind in den letzten Jahren dazu übergegangen, die Persönlichkeit als ein System zu begreifen. Das bedeutet, dass die sozial-kognitiven Variablen nicht losgelöst voneinander zu betrachten sind, sondern vielmehr miteinander interagieren in der Weise, die eine Kohärenz des Funktionierens der Persönlichkeit ermöglicht (Cervone/Shoda 1999 b). Mischel und Shoda (1995) haben nun ein Modell der Persönlichkeit im Sinne eines kognitiv-affektiven Verarbeitungssystems entwickelt („cognitive- affective processing system“[CAPS]), das drei besondere Merkmale aufweist (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 539 ff.):
1. Kognitive und emotionale Persönlichkeitsvariablen interagieren in vielfältiger Weise miteinander. Personen setzen sich Ziele (z. B. mehr Dates zu bekommen), haben ein bestimmtes Kompetenzniveau (z. B. geringe Fertigkeiten für Rendezvous), eine bestimmte Erwartung (z. B. geringe wahrgenommene Selbstwirksamkeit) und bestimmte Bewertungsmaßstäbe. Dem Modell zufolge bestehen zwischen diesen Kognitionen und Affekte Verbindungen. Gedanken über das eigene Ziel lösen Gedanken über die eigenen Kompetenzen aus, die sich wiederum auf die wahrgenommene Selbstwirksamkeit auswirken. Und schließlich können alle Auswirkungen auf die Emotionen haben.
2. Soziale Situationen können verschiedene „Pakete an Kognitionen und Affekten aktivieren“. Unterhält sich jemand z. B. mit einer anderen Person über Politik, so können Ziele und Erwartungen im Kontext von Politik aktualisiert werden, im Falle von Sportthemen dagegen völlig andere.
3. Daraus kann gefolgert werden, dass das Verhalten von Personen je nach Situation variiert, da entsprechend der Situation spezifische Teilbereiche des gesamten Persönlichkeitssystems aktiv werden.
2. Das Belohnungsaufschub- Paradigma
Mischel zeigte in einer umfangreichen Forschungsreihe (Mischel 1974), dass kognitive Prozesse dazu in der Lage sind, Impulse zu kontrollieren. Bei dem Belohnungs- aufschub- Paradigma wurden Kinder davon unterrichtet, dass sie für kurze Zeit alleine gelassen werden. Vorher wurde ihnen aber ein Spiel beigebracht, in dem es um zwei Belohnungen geht. Die größere Belohnung hätten sie dann zu erwarten, wenn sie geduldig auf die Mutter warten, die kleinere, wenn sie es nicht tun und eine Glocke läuten, damit sie erscheint. Die experimentelle Manipulation bestand nun jeweils in einer Sichtbarmachung, sowie einer Verdeckung der Belohnung. Die Ergebnisse waren eindeutig, denn bei einer Abdeckung der Belohnung konnten die meisten Kinder ihren Impulsen widerstehen, umgekehrt aber nicht. Mischel ging noch einen Schritt weiter - er brachte den Kindern bei, bis zum Erhalt der großen Belohnung an andere Dinge zu Denken oder sich mit Beschäftigungen (Spiele, Lieder singen, etc) abzulenken. Jetzt konnten die Kinder sogar die Belohnung aufschieben, auch wenn sie in ihrem Blickfeld war. Ermöglicht wurde dies durch mentale Strategien (geistige Repräsentationen), die schon beim Lernen am Modell, wenn auch in einem anderen Kontext, erwähnt wurden. Wichtig in Zusammenhang mit den geistigen Repräsentationen ist die Fähigkeit des Organismus zur Selbstregulierung.
4.2.2 Wachstum und Entwicklung
Die bisherigen Ausführungen über die sozial-kognitive Theorie geben auch einen Einblick über die Vorstellungen von Wachstum und Entwicklung. Gerade die Prozesse des Beobachtungslernens und des stellvertretenden Konditionierens sind es, die die Persönlichkeitsentwicklung vorantreiben. Durch die Beobachtung von Verhaltensweisen und den emotionalen Reaktionen von Modellen eignen sich Individuen der sozial-kognitiven Theorie entsprechend bestimmte Verhaltensweisen und emotionale Reaktionen an. Die Studie von Bandura und seinen Kollegen (Bandura et al. 1963 a) zeigt, wie Individuen emotionale Reaktionen und Erwartungen erlernen, ohne selbst vorher die Konsequenzen des Verhaltens direkt zu erfahren (stellvertretende Erfahrung von Konsequenzen). Mischels Belohnungsaufschub-Paradigma (Mischel 1974) unterstreicht, dass sich der Organismus durch kognitive Repräsentationen selbst regulieren kann und seinen Impulsen somit nicht erliegen muss. Auch das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Insgesamt betrachtet entwickelt der Mensch kognitive Persönlichkeitsstrukturen wie Kompetenzen, Überzeugungen, Erwartungen, Ziele und Bewertungsmaßstäbe als Ergebnis von sozialen Erfahrungen. Dabei spielen aktive, besser: proaktive Prozesse eine bedeutende Rolle, denn sozial- kognitive Theoretiker betrachten Entwicklung nicht als einseitig durch Umwelteinflüsse bestimmt, vielmehr setzen sich Menschen eigene Ziele und Maßstäbe und versuchen so ihr Leben selbst zu gestalten (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 549).
4.2.3 Psychopathologie und Veränderung
Nach der sozial- kognitiven Theorie ist Psychopathologie das Ergebnis fehlangepasster Kognitionen. Die Therapie müsse dann kognitive Verzerrungen verändern und dabei versuchen, sie durch realistischere zu ersetzen (ebd.: 589).
Konkret geht die sozial-kognitive Theorie davon aus, dass Modelllernen und stellvertretendes Konditionieren bei Ängsten und Phobien eine Rolle spielen (ebd.: 594), indem ungeeignete Modelle beobachtet werden.
4.2.4 Bewertung und Einschätzung
Die sozial- kognitive Theorie erklärt menschliches Verhalten in umfassender Art und Weise. Die negativen Kritikpunkte lassen sich folgendermaßen zusammenfassen (ebd., 612 ff.): Sie stellt noch keine systematische, einheitliche Theorie dar. Unterschiedliche Konzepte werden zusammengeworfen (fehlende theoretische Kohärenz). Zudem ist das Wechselspiel von sozialen Erfahrungen, persönlichen Zielen, Maßstäben und Wirksamkeitsüberzeugungen noch nicht deutlich genug formuliert worden. Und zuletzt ist die Zieldimension anzuzweifeln. Nach Bandura werden Menschen durch die Diskrepanz zwischen ihrer Leistung und den Maßstäben motiviert. Er setzt Ziele mit Maßstäben gleich (es gibt noch andere Ziele!).
Außerdem werden Ziele häufig auch um ihrer selbst Willen erreicht (intrinsische Motivation). Hier wird ungenügend differenziert.
5. Humanistische Persönlichkeitstheorien
5.1 Die Persönlichkeitstheorie des Carl R. Roger (1902- 1987)
5.1.1 Biographie
Carl R. Rogers wurde 1902 in Oak Park, Illinois geboren. Nach eigenen Aussagen wuchs er in einer strengen, konservativ-religiösen Familie auf, in der aber dennoch ein liebevolles, warmherziges Klima herrschte. In seiner früheren Phase des Lebens haben sich insbesondere zwei Beschäftigungen auf seine spätere Arbeit ausgewirkt: zum einen die Beschäftigung mit religiösen und ethischen Fragen und zum anderen das große Interesse für die Naturwissenschaften. Als Rogers nämlich 12 Jahre alt war, kaufte sein Vater eine Farm und Rogers las zu dieser Zeit viele Bücher über Landwirtschaft. In dieser Zeit beobachtete er auch das Leben der Nachtfalter und zog Lämmer, Schweine und Kälber groß. Diese Zeit ging einher mit einem tiefen Respekt vor wissenschaftlichen Methoden. Rogers begann sein Studium in Wisconsin im Bereich Agrarwissenschaft, wechselte dann zu dem Bereich Geschichte und kam schließlich über Umwegen zu einer psychologischen Ausbildung. Während dieser Zeit arbeitete er auch im Bereich der Erziehungsberatung.
5.1.2 Struktur: Das Selbst, Ideal-Selbst
Zunächst ging Rogers davon aus, dass das Selbst ein „vager, vieldeutiger, wissenschaftlicher bedeutungsloser Begriff sei“, er erkannte aber in der therapeutischen Arbeit, dass die Klienten dazu neigen, oft über das Selbst zu sprechen. So benutzten sie beispielsweise Formulierungen wie „Ich mag es nicht, wenn jemand mein wirkliches Selbst kennt“ oder „Ich frage mich, wer ich wirklich bin“. Rogers bezeichnet es als eine „organisierte, in sich geschlossene Gestalt...um eine fließende, eine wechselnde Gestalt, um einen Prozess...“(Rogers 1991: 26). Die Autoren Pervin/Cervone/John bezeichnen es als das strukturelle Schlüsselkonzept in Rogers` Persönlichkeitstheorie. Das „Selbst“ kann sich demnach zwar verändern, aber es „behält immer eine vorgegebene, integrierte und organisierte Qualität. Da diese organisierte Qualität über die Zeit hinweg Bestand hat und das Individuum charakterisiert, ist das Selbst eine Persönlichkeitsstruktur“ (Pervin/Cervone/John 2005: 220). Des Weiteren stellt es nach Rogers eine Art
Konglomerat von Wahrnehmungen und Erfahrungen dar, die dem Bewusstsein zugänglich gemacht werden können oder es bereits sind. An dieser Stelle wird der Unterschied zu Jungs Sicht des Selbst deutlich: Er verlagerte es als archetypische Kraft im kollektiven Unbewussten, während Rogers das Selbst hauptsächlich auf die Ebene des Bewusstseins verlegte (vgl. ebd.: 220). Das Selbst-Ideal (Ideal-Selbst) stellt eine weitere Komponente des Selbst dar. Gemeint ist damit das Selbstkonzept, das eine Person am liebsten besäße oder wie jemand sich in Zukunft im Idealfall selbst sieht.
5.1.3 Prozess
Wie bereits aus dem Menschenbild zu entnehmen ist, betrachtet Rogers den Menschen als vorwärts gerichtet. Für diese finale Orientierung benutzte er den Begriff der Selbstaktualisierung, welches Rogers’ motivationstheoretisches Konzept darstellt: „Der Organismus hat eine grundlegende Tendenz, den Erfahrungen machenden Organismus zu verwirklichen, zu erhalten und zu erhöhen“ (Rogers 1951, zit. in: Pervine/Cervone/John 2005: 226). Diese Tendenz kann auch als eine schöpferische Kraft verstanden werden, nach der sich der Organismus von einer einfachen Struktur zu einer komplexen umstrukturiert und die inhärenten Potentiale verwirklicht, wodurch ein Prozess der Veränderung, des Wachstums und der Freiheit in Gang gesetzt wird. In „Der neue Mensch“ (Rogers 1981) bezeichnet er diese Tendenz auch als eine „zentrale Energiequelle“, wobei die Energie für die Erfüllung niederer Bedürfnisse (Nahrung, Sexualität) und höherer Bedürfnisse (z. B. soziale Kontakte) genutzt wird. Der Mensch als aktives Wesen befindet sich dabei ständig „in Transaktionen mit der Umgebung“ (ebd.: 74). Interessanterweise verweist Rogers bei der Selbstverwirklichungstendenz genau wie Adler in Bezug auf seine Ganzheitsphilosophie auf den ehemaligen südafrikanischen Feldherrn und Premierminister Jan Christian Smuts, der 1926 (Titel unbekannt) in seinem Buch „die ganzmachende, holistische Tendenz...die in allen Stadien zu beobachten ist...etwas Fundamentales im Universum...“ (Smuts 1926, zit. in: Rogers 1981: 65) thematisierte. Smuts Einfluss auf die humanistische Psychologie (Rogers, Maslow, Bühler, etc) und der Adlerschen Individualpsychologie als Erweiterung des tiefenpsychologischen Ansatzes ist daher von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Eigenen Angaben zufolge übte auch der Biologe Hans Driesch einen großen Einfluss auf Rogers aus. In einem Experiment mit Seeigeln zeigte er, wie die Trennung der Zellen dennoch zwei vollständige Seeigel - Larven hervorbrachte (ebd.: 71). Neben der Selbstverwirklichungstendenz postuliert Rogers eine noch umfassendere, „formative Tendenz im Universum als Ganzem“. Sie ist nach Rogers universal und gelte sowohl für organische als auch anorganische Organismen und geht dabei von der Prämisse aus, dass jede Form aus einer einfacheren, weniger komplexen Form hervorgegangen ist. Rogers führt zur Veranschaulichung u. a. die Entwicklung der menschlichen Eizelle an (ebd.: 77). Hier haben eigenen Angaben zufolge die Ideen und Gedanken des Biologen und Nobelpreisträgers Albert Szent- Gyoergyi (1974) und des Ideengeschichtlers Lancelot Whyte (1974) Rogers zu der Annahme einer „formativen Tendenz“ verholfen. Gyoergyi spricht von einer „Syntropie“, Whyte von einer „morphischen Tendenz“, beide Begriffe entsprechen inhaltlich der „formativen Tendenz“.
5.1.4 Wachstum und Entwicklung
Individuen können sich Rogers zufolge weiterentwickeln, wenn ein Milieu geschaffen wird, dass er auch als „psychologisches Fruchtwasser“ (Rogers 1981: 72) bezeichnet. Demzufolge müssen im therapeutischen Setting drei Bedingungen vorherrschen, die ein Wachstum förderndes Klima ermöglichen (ebd.: 66 ff.):
1. Echtheit, Unverfälschtheit, Kongruenz: Der Therapeut soll seine persönliche Fassade soweit wie möglich ablegen und seine wahren Gefühle dem Klienten mitteilen (Transparenz).
2. Akzeptanz, Anteilnahme, Wertschätzung: Rogers fordert eine „bedingungslose positive Zuwendung“ zum Klienten, so dass der Klient seine momentanen Gefühle ausleben kann.
3. Einfühlsames Verstehen: Der Therapeut soll durch ein sensibles, einfühlsames Verstehen in die private Welt des Klienten eintauchen.
Rogers Therapie ist klientenzentriert (Synonyme: personenzentrierter Ansatz, nicht direktive Beratung). In den Begriffen kommt zum Ausdruck, dass der Klient eigene Wege der Veränderung finden soll (Boeree 1998, Rogers, 5, in: Steden 2004: 55).
5.1.5 Psychopathologie und Veränderung
Rogers zufolge sind Individuen ausgeglichen und psychisch gesund, wenn ihre Verhaltensweisen mit dem Selbstkonzept übereinstimmen (Selbstkonsistenz) und eine Kongruenz zwischen dem Selbst und der Erfahrung vorliegt. In diesen Fällen stimmen die eigenen Gefühle mit dem Selbstbild überein. Umgekehrt können Abweichungen zwischen dem wahrgenommenen Selbst und der tatsächlichen Erfahrung psychische Spannungen (Zustände der Inkongruenz) evozieren (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 229). Solch ein Zustand liegt z. B. vor, wenn sich jemand als einen friedliebenden Menschen sieht und dennoch Hass erlebt. Die hasserfüllten Gefühle können dann Angst verursachen, wodurch Abwehrprozesse (Verleugnung, Verzerrung) aktualisiert werden können (ebd.: 229 ff.). Die Therapie zielt dann im Wesentlichen darauf ab, die Spaltung zwischen dem Selbst und der Erfahrung wieder aufzuheben, wobei auch hierfür ein Wachstum förderndes Klima eine zentrale Rolle spielt. Es sollte klar sein, dass die Zustände der Inkongruenz und deren Aufhebung prozessuale Vorgänge darstellen und somit auch der Analyseeinheit „Prozess“ zugeordnet werden könnten.
5.1.6 Auffassung von Wissenschaft, Theorie und Forschung
Rogers vertritt einen phänomenalen Ansatz, nach dem jeder Mensch die Welt in einer einzigartigen, subjektiven Weise wahrnimmt. Dieser Sichtweise entsprechend erscheinen ihm Forschungen in Disziplinen wie Physik und Mathematik immer als ein Ergebnis subjektiver Wahl. Wissenschaft beginnt nach Rogers nicht erst im Labor oder am Computer, „sondern scharfsinnige Beobachtungen, Sorgfalt und Kreativität sind der Beginn der Wissenschaft“ (Rogers 1991: 14). Rogers ist auch davon überzeugt, dass jede Wissenschaft einen Prozess der Weiterentwicklung durchläuft. Wenn sie darauf zielt, immer exaktere Messungen, größere Validität und Genauigkeit zu entwickeln, handelt es sich nach Rogers um eine „gesunde Wissenschaft“. Als Wissenschaftler kritisiert Rogers ähnlich wie die Vertreter der sozial-kognitiven Theorie ein Denken in einseitigen, unilateralen Reiz-Reaktion-Ursache-Wirkungs-Mechanismen. Hier folgt er der biologischen Erkenntnistheorie („morphogenetische Epistemologie“) von Murayama (1977), der Wachstumsprozesse in wechselseitigen Ursache-Wirkung- Interaktionen einbettet (vgl. Rogers 1981: 72 ff.). Bisher hat man den Eindruck eines rational agierenden Empirikers, doch gerade die Annahme einer „formativen Tendenz“ im Universum ist meiner Auffassung nach höchst spekulativ. Rogers zufolge haben sich er und seine Klienten während der Gruppenarbeit gemeinsame Empfindungen in Richtung eines universalen Bewusstseins, so genannte mystische, spirituelle Erfahrungen geteilt. Auch wenn er sich diesbezüglich an den Vorstellungen des Physikers Fritjof Capra (1975) orientiert, der der Physik eine mystische Note verleiht, insofern, als Raum und Zeit, Ursache und Wirkung entschwinden und letztlich im Universum als ein untrennbares Ganzes aufgehen (vgl. ebd.: 80 ff.), so bleibt mein Vorwurf reiner Spekulation bestehen.
5.1.7 Menschenbild
Rogers’ Sicht vom Menschen ist eine optimistische Sicht. Auch hinter destruktiven Verhaltensweisen gibt es immer einen positiven Kern des Menschen, der nach Selbstaktualisierung strebt. Der Mensch ist „von Grund auf sozial, vorwärtsgerichtet, rational und realistisch“ (Rogers 1973: 100). Rogers kommt nun nach langjähriger therapeutischer Erfahrung zu folgender Erkenntnis:
„Ich habe kein euphorisches Bild von der menschlichen Natur. Ich weiß, dass Individuen aus Abwehr und innerer Angst sich unglaublich grausam, destruktiv, unreif, regressiv, asozial und schädlich verhalten können. Es ist dennoch einer der erfrischendsten und belebendsten Aspekte meiner Erfahrung, mit solchen Individuen zu arbeiten und die starken positiven Richtungsneigungen zu entdecken, die sich auf den tiefsten Ebenen bei ihnen wie bei uns allen finden“ (ebd. : 42).
5.1.8 Bewertung und Einschätzung
Die klientenzentrierte Gesprächsführung ist eine verbreitete Methode in allen Bereichen der institutionalisierten Beratung. Zumal sie unmittelbar auf der Ebene des Individuums ansetzt, befindet sie sich in konzeptioneller Nähe zur Sozialen Einzelhilfe. Sie unterscheidet sich von der Psychoanalyse insofern, als keine Deutungen und Suggestionen vorgenommen werden. Zu den positiven Aspekten gehört sicherlich das Bild vom Klienten als ein selbständiges, autonomes Subjekt, das selber am besten weiß, was gut für es ist. Hierin sehe ich einen Anknüpfungspunkt in der Jugendhilfe, in der der sozialpädagogische Hilfeprozess durch kommunikative Aushandlungsprozesse geprägt ist (näheres dazu unter: Rössner). Die negativen Kritikpunkte bringt Galuske genau auf den Punkt (Galuske 1998: 187 ff.):
1. Rogers’ Ansatz konzentriert sich im Wesentlichen auf die Innenwelt des Klienten, wobei die Umwelt als problematische Größe außen vor bleibt. Dabei tritt der Sachaspekt (z. B. Arbeitslosigkeit, Schulden, beengter Wohnraum, etc) zurück, der aber eine wichtige Rolle für ein befriedigendes Leben spielen kann. Die Gefahr besteht vor allem darin, dass der Klient mit seinem eigentlichen Anliegen nicht ernst genommen wird.
2. Der personenzentrierte Ansatz versteht sich als ausschließlich nicht-direktives Verfahren. Für eine bestimmte Klientel (z. B. psychotisch erkrankte) ist solch ein Vorgehen notwendig; für den „psychisch gesunden“ jedoch kommen dabei erhebliche Zweifel auf. Gerade bei Sachaspekten wünschen sich viele Klienten direkte Hilfestellungen, diese sind z. T. sogar notwendig.
3. Rogers’ Ansatz zeichnet sich durch eine inhärente Widersprüchlichkeit aus. Hergestellt werden soll eine „echte und wahre Beziehung“, die aber durch die Haltungsvariablen erschwert wird: „Kommunikation und Empathie, die konstanten Ziele bei Rogers, werden hier geleugnet und in ihr Gegenteil verkehrt: zwischen Therapeut und Klient stellt sich keine persönliche Beziehung her; es gibt nur einen Zusammenhang von der Art, dass der Therapeut sein Schweigen zeigt, sich zurückzieht, darauf verzichtet, er selbst zu sein. Der Klient hat eine lebendige Beziehung...mit einer Abwesenheit“ (Snyders, zit. nach Gilles 1980: 74, in: Galuske ebd.: 187 ff.)
5.2 Die Persönlichkeitstheorie des Viktor E. Frankl (1905-1997)
5.2.1 Biographie
Viktor E. Frankl wurde 1905 in Wien geboren. Er war der Sohn jüdischer Eltern, der Vater aus Südmähren stammend, die Mutter aus Prag stammend. Schon als Kind fasste er den Entschluss Arzt zu werden. Während der Schulzeit eignete er sich unter Anweisung von Freud-Schülern bereits tiefenpsychologische Kenntnisse an. Freud selber lernte er auch persönlich kennen. Als Frankl 19 Jahre alt war half ihm Freud bei der Veröffentlichung eines Manuskripts. Er befasste sich aufgrund eines sozialistischen Interesses auch mit der Individualpsychologie Adlers und war für kurze Zeit in der individualpsychologischen Vereinigung, recht früh kam es aber aufgrund anderer Auffassungen zur Trennung. Auffallend bei Frankl ist, dass seine psychologischen Themen immer auch philosophische Fragestellungen mit einbeziehen. Sowohl seine Eltern, sein Bruder und auch seine erste Frau sind im Konzentrationslager umgekommen. Er selber überlebte die Konzentrationslager Auschwitz und Theresienstadt und ausgehend von diesen Erfahrungen entwickelte er eine eigenständige, von Freud, Adler und Jung abweichende Psychotherapie. Er gilt als Begründer der Logotherapie, die von einigen Autoren als „Dritte Wiener Richtung der Psychotherapie“ genannt wird (Informationen aus Wehr 1996: 208 f).
5.2.2 Schilderungen über das Konzentrationslager
Aufgrund der Tatsache, dass Frankls Werk vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen in den Konzentrationslagern gesehen werden muss, gehe ich zunächst kurz auf seine schriftlich festgehaltenen „Erlebnisse“ in den Konzentrationslagern ein. In „...trotzdem Ja zum Leben sagen“ (Frankl 1977) schildert er in einer sehr eindringlichen, schonungslosen und aufwühlenden Art die Situation in dem Konzentrationslager. Er unterteilt das Leben der Insassen zunächst in drei Phasen: der Phase der Aufnahme ins Lager, der Phase des eigentlichen Lagerlebens und der Phase nach der Entlassung, die er dann anhand der Reaktionsweisen der Insassen psychologisch beleuchtet. Frankl stellte fest, dass einige Insassen, worunter auch die sehr Empfindsamen fielen, das Lagerleben besser überstehen konnten: „Denn gerade ihnen steht der Rückzug aus der schrecklichen Umwelt und die Einkehr in ein Reich geistiger Freiheit und inneren Reichtums offen“ (ebd.: 63). Frankl selber hat trotz der schlimmen Erlebnisse in dem KZ versucht, seinem Leben dort einen Sinn zu geben. So dachte er sehr oft an seine Frau und kam zu der Erkenntnis, „dass Liebe irgendwie das Letzte und das Höchste ist, zu dem sich menschliches Dasein aufzuschwingen vermag“(ebd.: 65). Seine Kernthese, die er aufgrund von Beobachtungen im KZ entwarf ist, dass jeder Insasse „grundsätzlich...und auch noch unter solchen Umständen, irgendwie entscheiden, was - geistig gesehen - im Lager aus ihm wird: ein typischer „Kzler“- oder ein Mensch, der auch hier noch Mensch bleibt und die Menschenwürde bewahrt“ (ebd.: 109). Frankl ist also der Ansicht, dass die Einstellung zu den gegebenen Verhältnissen der entscheidende Punkt ist, um innere Freiheit aufrechtzuerhalten. Ich kann jedem, der sich mit Frankl näher beschäftigen möchte empfehlen, zunächst dieses wertvolle Buch zu lesen. Es vermittelt bereits wesentliche Erkenntnisse die in den späteren Werken auftauchen, darüber hinaus kann es dem Leser in schlechten Phasen seines Lebens auch Trost spenden.
5.2.3 Ausgangssituation
Frankl stellt in seinen Schriften die These auf, dass der Mensch an einem „abgründigen Sinnlosigkeitsgefühl“ leidet und spricht in diesem Zusammenhang auch von einem „existentiellen Vakuum“ (Frankl 1977: 11). Dieses Sinnlosigkeitsgefühl versucht er auch empirisch zu belegen, indem er sich auf mehrere Untersuchungen und Aussagen stützt. So ergab z. B. eine Untersuchung an der Harvard University, dass ein großer Prozentsatz der Studierenden über ein Sinnlosigkeitsgefühl klagt, auch Untersuchungen an einer afrikanischen Universität würden dies bestätigen.
5.2.4 Ursachen des Sinnlosigkeitsgefühls
Das Sinnlosigkeitsgefühl manifestiert sich nach Frankl in Form eines „existentiellen Vakuums“, dessen Begleitsymptome eine Art innere Leere, ein Gefühl der „Sinnlosigkeit des Daseins“ darstellen. Diese äußert sich dann konkret in Kriminalität, Alkoholismus, Drogenabhängigkeit und dergleichen. Für das Zustandekommen des „existentiellen Vakuums“ führt er im Wesentlichen zwei Gründe an: Zum einen die Instinktlosigkeit des Menschen im Unterschied zum Tier und zum anderen die Loslösung von überkommenen Traditionen. Durch diese Freisetzung des Individuums ergebe sich automatisch eine Orientierungslosigkeit, die in einem Konformismus (freiwillige Anpassung) oder in einem Totalitarismus (zwanghafte Anpassung) mündet (Frankl 1977: 13, 1979: 16, 1981: 19).
5.2.5 Kritik an Freud, Adler, Jung
Allen Drei wirft er generell ein einseitiges Denken vor. Freud habe die Bedeutung der Sexualität gewissermaßen überstrapaziert, er sei zu sehr in der „viktorianischen Plüschkultur“ verhaftet gewesen (Frankl 1977: 38, 1981: 35). Darüber hinaus kritisiert er das aus der Physik entnommene Homöostase-Modell und das damit verbundene Menschenbild, wonach der Mensch insgesamt passiv ist und lediglich Spannungen herabsetzen will. Dabei geht es dem Menschen nicht nur um die Herstellung von Gleichgewicht, sondern um die „Aufrechterhaltung von Spannungen“ (Frankl 1977: 41). Adler wirft er vor, Umwelt- und Erziehungseinflüssen eine zu große Beachtung für die Entwicklung der Persönlichkeit beigemessen zu haben. Außerdem würde Adlers Konzeption zur weiteren Ausgrenzung bereits marginalisierter beitragen, da z. B. an Schizophrenie Erkrankte nach Adler die drei Lebensaufgaben nicht erfüllen könnten (vgl. Frankl 1977: 105). Jung habe die Sinnfrage zwar gestellt, doch seine Psychologie sei zu sehr in der Religion verankert, auf die der Mensch nach Jung nur wenig Einfluss habe, da er sie dem Es zuordnete (vgl. Frankl 1975: 57 ff.). Sein Hauptkritikpunkt an allen drei Psychologen formuliert er so: „Am allerwenigsten ist es den drei Klassikern psychotherapeutischer Systematik - Freud, Adler, Jung - gelungen, sich von allem Psychologismus frei zu halten oder auch nur frei zu machen“ (Frankl 1977: 38).
Darunter versteht er eine bestimmte Haltung, die menschliches Verhalten in Anspruch auf ein „Totalwissen“ (Jaspers) verallgemeinert, wobei aber nur „partikuläre Perspektiven und Aspekte der Wirklichkeit vermittelt werden“ (Frankl 1979: 20). Der Psychologismus tendiere Frankl zufolge dazu, die geistige Dimension des Menschen zu vernachlässigen (Frankl 1975: 26). Er übersehe dabei, dass hinter einer seelischen Krankheit eine geistige Not liegt. Für Frankl kommt es für den Heilungsprozess ohnehin nicht so sehr auf eine bestimmte Psychotherapiemethode an, sondern „vielmehr ist es die menschliche Beziehung zwischen Arzt und Krankem, die den Ausschlag gibt“ (Frankl 1977: 47).
5.2.6 Freiheit vs. Determinismus
Frankl geht davon aus, dass der Mensch in gewisser Hinsicht nicht frei sein kann, da sowohl Triebe, Anlage als auch die Umwelt ihn einschränken. Er spricht in diesem Kontext auch von einer Unterwerfung von biologischen, psychologischen und soziologischen Bedingungen. Was den Menschen aber wiederum frei macht ist die Tatsache, dass er Stellungnahme zu diesen Bedingungen beziehen kann, er spricht auch von eine „Freiheit trotz aller Determiniertheit“ (Frankl 1979: 53). Diese Stellungnahme zu den Bedingungen macht letztlich die geistige Person aus. Frankl geht davon aus, dass durch eine somatische oder psychische Erkrankung die geistige Person zwar erkranken, aber niemals zerstört werden kann. Hinter den Symptomen einer bestimmten Erkrankung bleibt die geistige Person also immer erhalten, er ist also überzeugt von „den unerschütterlichen Glauben an die geistige Personalität auch noch des psychotisch Erkrankten“ (Frankl 1977: 104, vgl. Frankl 1979: 197). Hinter dieser Aussage steckt meines Erachtens eine sehr wertvolle Einsicht, gerade auch im Hinblick auf die Soziale Arbeit: Jeder Sozialarbeiter sollte Klienten in psychosozialen Notlagen als gleichwertige Individuen wohlwollend annehmen. Jedem Menschen als geistige Person kann und darf die Menschenwürde nicht genommnen werden.
5.2.7 Der Wille zum Sinn
Der „Wille zum Sinn“ stellt Frankls motivationstheoretisches Konzept dar. Nicht der Wille zur Lust (Freud) oder der Wille zur Macht (Adler) wird nach Frankl als Ausgangspunkt für menschliches Handeln betrachtet, sondern der „Wille zum Sinn“ als primäre Motivation, als Motivation „sui generis“, die nicht von anderen Bedürfnissen ableitbar ist (Frankl 1977: 17). Dabei betont Frankl aber, dass es dem Menschen um Sinnfindung und Sinnerfüllung geht. Es handelt sich dabei um einen Prozess, d. h. der Einzelne muss seinen subjektiven Sinn selber finden, er kann einem nicht aufoktroyiert werden. Somit stellt die Sinnfindung etwas höchst Einmaliges, Individuelles dar, die je nach Person und Situation variiert: Der „konkrete Sinn einer konkreten Situation“ (Frankl 1977: 39) ist gemeint, die „Sinnfahndung“ ist immer „ad personam et ad situationem“ zu verstehen (Frankl 1975: 192). Bei der Sinnerfüllung betont Frankl auch ihren intentionalen Charakter. Er geht davon aus, dass der Mensch sein Handeln nie auf sich selber richtet, sondern gerade in der Begegnung mit Anderen Sinn gefunden werden kann. So stellt er fest: „Denn es gehört zum Wesen des Menschen, dass er ebenfalls offen ist, dass er „weltoffen“ (Scheler, Gehlen und Portmann) ist. Mensch sein heißt auch schon über sich selbst hinaus sein. Das Wesen der menschlichen Existenz liegt in deren Selbsttranszendenz, möchte ich sagen“ (Frankl 1979: 26).
5.2.8 Psychotherapie und Religion
Frankl hat in seinen Schriften sehr oft den Bereich der Psychologie um philosophische und theologische Fragestellungen erweitert. Für ihn besteht ein fundamentaler Zusammenhang zwischen Religion und Psychotherapie. Zunächst stellt die Religion für die Logotherapie (näheres im nächsten Kapitel) nur einen Gegenstand dar, nicht aber einen Standort (Frankl 1977: 89 ff.). Unterschiede sieht er in deren Zielsetzungen, denn Psychotherapie ziele auf seelische Heilung, Religion dagegen auf das Seelenheil, wobei der religiöse Mensch in eine höhere Ebene vorstößt als der nichtreligiöse. Der gemeinsame Nenner besteht aber darin, dass beide verantwortlich sind im Hinblick auf die Erfüllung eines Sinnes, sowohl der Religiöse als auch der Nichtreligiöse glauben nach Frankl an einen Sinn. Frankl betont aber mit Nachdruck, dass im Unterschied zur Religion die Logotherapie den Menschen keinen Glauben aufoktroyieren kann, denn „man kann nicht glauben wollen“. Jungs Auffassung von Religion lehnt er vehement ab. Die Religiosität kann seiner Ansicht nicht ins kollektive Unbewusste verankert sein, denn es handelt sich in den meisten Fällen um persönliche, „Ich-haften Entscheidungen“, die nicht angeboren sind und zu denen der Mensch auch nicht getrieben wird (vgl. Frankl 1975: 57 ff).
5.2.9 Die Logotherapie
Viktor Frankl entwickelte die so genannte Logotherapie. Das altgriechische Wort „Logos“ (= „Hauch“, „Geist“, „Sinn“) verweist dabei auf das Streben der Menschen, ihr Leben nach Sinn bzw. Glaubensinhalten auszurichten. Wird diese Ausrichtung nach „Sinnfahndung“ unterbunden, sind psychische Spannungen im Individuum möglich (vgl. Steden 2004: 56). Psychische Spannungen haben nach Frankl im Unterschied zu Freud eine positive Konnotation, da sie bei der individuellen Sinngebung hilfreich sein können. Ohne Spannungen geraten Menschen in ein „existentielles Vakuum“. Die dabei empfundene innere Leere kommt in Frankls beschriebener Sonntagsneurose zum Ausdruck: Menschen hätten eigentlich Gelegenheit zur sinnvollen Beschäftigung, doch sie betrinken sich und führen andere „sinnlose“ Beschäftigungen aus (vgl. ebd.: 57). Logotherapie versteht sich als Therapie vom Geistigen her, sie zielt auf die „personal geistige Existenz“ (Frankl 1975: 145) und ist somit auch eine Existenzanalyse. Sie will den Menschen dabei helfen, „in seinem Dasein Sinnmomente zu entdecken“ (ebd.: 146), verzichtet aber generell ähnlich wie im personenzentrierten Ansatz auf direkte Anweisungen. Als Appell an den Willen zum Sinn versteht sie sich auch als „appellative Psychotherapie“. Mit dem tiefenpsychologischen Ansatz teilt sie das Konzept des Unbewussten, wobei aber nur der „Wille zum Sinn“ verdrängt sein kann und dann wieder hervorgeholt werden muss (vgl. ebd.: 149). Frankl entwickelte für die Heilung psychogener Neurosen und insbesondere noogener Neurosen (aus geistigen Konflikten entstandene Neurosen) spezifische Behandlungskonzepte, zu nennen wären hier (ebd.: 159 ff.):
° Paradoxe Intention: Der Patient soll gerade das, wovor er sich am meisten fürchtet, wünschen. Frankl verdeutlicht diese Methode an einem Mann, der an einer Hydrophobie (übermäßiges Schwitzen in sozialen Situationen) litt. Bei der nächsten Anbahnung sozialer Kontakte solle er sich dabei vorstellen, übermäßig viel zu schwitzen. Die Symptome sollen also verschwinden, indem die Neurose ironisiert wird.
° Dereflexion: Frankl verdeutlicht diese Methode u. a. am Beispiel der Sexualneurosen.
Die Betroffen wollen demnach den Sexualakt um jeden Preis erzwingen, er wird „forciert intendiert“. In anderen Fällen beobachten sich die Betroffenen beim Sexualakt selber, anstatt sich dem Partner hinzugeben, beides könne aber zur Impotenz führen. Bei der Dereflexion geht es im Kern darum, sich selber zu ignorieren und anderen Dingen (einer Person, Idee, Werk) hinzugeben. Er ist nach Frankl dann „geistig bei etwas“.
5.2.10 Menschenbild
Es handelt sich um ein Menschenbild, „in dessen Rahmen so etwas wie Sinn und Wert und Geist überhaupt Platz hat, jenen Platz, der ihm in Wirklichkeit zukommt. Mit einem Wort, vorausgesetzt ist jeweils das Bild des Menschen als eines geistigen, freien und verantwortlichen-verantwortlich eben für die Verwirklichung von Werten und für die Erfüllung von Sinn: das Bild des sinnorientierten Menschen“ (ebd.: 146).
5.2.11 Frankl und der Existenzialismus
Frankls Konzept steht dem existenzialistischen Ansatz sehr nahe. Der Existenzialismus, als philosophisches System im 19. Jahrhundert insbesondere durch die Schriften des dänischen Philosophen Soren Kierkegaard, im 20. Jahrhundert durch die Werke von Jean-Paul Sartre vertreten, zeichnet sich durch drei konstitutive Merkmale aus (Pervin/Cervone/John 2005: 272 ff.):
1) Beschäftigung mit der Existenz, dem Menschen in seinem menschlichen Dasein.
2) Die Hervorhebung der Bedeutung des Individuums als einmaliges und unersetzbares Wesen, wobei der Akzent auf eine in Freiheit und Verantwortlichkeit ausgerichtete Existenz begründet liegt.
3) Die Beschäftigung mit dem Tod.
Gerade das zweite Merkmal kommt nun in Frankls Schriften gehäuft zum Ausdruck, es spiegelt seine philosophische Anthropologie wieder, bei der er vor allem von Max Scheler beeinflusst wurde. Auf Scheler, der die Differenz von Mensch und Tier durch die geistige Dimension des Menschen, seine „Weltoffenheit“ und sein „Selbstbewusstwerden“ (Arbeitsbuch Pädagogik 1975: 29 ff.) erklärt, wird in Frankls Schriften zahlreich verwiesen (z. B. Frankl 1990: 33, 34, 124, 125, 270, 354, 364, 376).
5.2.12 Bewertung und Einschätzung
Frankls logotherapeutischer Ansatz, der die Würde des Menschen und die Erfüllung von Werten betont, kann für die Soziale Arbeit fruchtbar sein. Insbesondere über die Einstellungswerte, die es zu verwirklichen gilt, kann der Ansatz unter richtiger Anwendung in vielen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit hilfreich sein. Ich denke dabei insbesondere an die Altenhilfe, in der Leid und Tod älterer Menschen häufig direkt oder indirekt aufgegriffen und somit zum Thema wird. Frankl sieht im Leid eine treibende Kraft, ein „agens“, die Wachstum und Reifung durch die Auseinandersetzung mit dem individuellen Schicksal ermöglichen kann (vgl. Frankl 1975: 115). Aufgabe des Sozialarbeiters wäre es dann, Klienten den Sinn im Leiden erfahrbar werden zu lassen. Auf zwei negative Kritikpunkte muss ich dennoch verweisen. Zum einen ist die Nützlichkeit des logotherapeutischen Ansatzes noch nicht hinreichend bewiesen (Pervin/Cervone/John 2005: 274). Zum anderen kommen mir erhebliche Zweifel auf, ob sein Anspruch auf ganzheitliches Denken von ihm selber eingelöst wird. Obwohl er einen „Psychologismus“ auf schärfste verurteilt, nimmt er den Menschen primär als geistiges Wesen wahr. Somit muss er sich den Vorwurf eines „Noologismus“ aussetzen, dem die menschliche Komplexität nicht gerecht wird. Konflikte, die in der Hauptsache geistige Konflikte darstellen, vernachlässigen andere mögliche Ursachen (soziale, physische, materielle, etc) für ein psychisches Problem (vgl. Röhlein, 1986: 234).
6. Teil II: Darstellung ausgewählter Methoden, Konzepte und Handlungsmodelle
6.1 Florence Hollis: Soziale Einzelhilfe als psychosoziale Behandlung
6.1.1 Allgemeine Einführung
Für Hollis besteht die Aufgabe der Einzelhilfe im Wesentlichen darin, „den Menschen zu befähigen, seine Bedürfnisse umfassender erfüllen und in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen angemessener handeln zu können“ (Hollis 1971: 26). Drei Komponenten spielen nach Hollis in der Einzelhilfe eine tragende Rolle: Die Person als solches, die Situation und die Wechselwirkung zwischen diesen beiden. Sie spricht auch von einem Konzept „des Menschen in seiner spezifischen Situation“. Den theoretischen Bezugsrahmen der Einzelhilfe nach Hollis stellen die Annahmen Freuds dar, andere Vertreter, die mehr die zwischenmenschlichen Dimensionen herausge- arbeitet haben, werden sogar abgewertet: „Die Soziale Einzelhilfe würde in bedauerlicher Weise verarmen, wenn sie den Theorien von Horney und Sullivan folgen würde, die menschliches Verhalten in erster Linie aus zwischenmenschlichem Geschehen heraus erklären wollen, wobei sie die grundlegenden innerseelischen Phänomene übergehen, die von frühester Kindheit an die Wahrnehmung von den und die Reaktion auf die zwischenmenschlichen Erfahrungen beeinflussen“ (ebd.: 28).
Die Einzelhilfe versteht sich als eine „Behandlungsart“ oder auch als „psychosoziale Behandlungsmethode“, die sowohl innere als auch äußere Ursachen von „gestörten Verhaltensweisen“ fokussiert.
6.1.2 Elemente der sozialen Einzelhilfe
1. Die ethische Rahmung des Hilfeprozesses
Die Soziale Einzelhilfe nach Hollis betont den Wert und die Würde des Einzelnen Individuums und wird von der Grundvorstellung oder Grundhaltung geleitet, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, sein Leben noch individuellen Vorstellungen zu leben, sofern die Rechte anderer dadurch nicht beschnitten werden (vgl. ebd.: 30). In diesem Sinne muss der Sozialarbeiter unabhängig vom Klienten um ein „wohlwollendes Annehmen“ und die Förderung der Selbstbestimmung des Klienten bemüht sein. Hollis will den Begriff der Selbstbestimmung eher durch den der Selbstverantwortlichkeit ersetzt wissen, da darin die Verantwortlichkeit vor der Wahl subjektiver Entscheidungen besser zum Ausdruck komme. Zusammenfassend gesagt geht es um die Akzeptanz des menschlichen Seins in seinen individuellen Ausformungen, bei einer, sofern es indiziert ist, aktiven Einflussnahme auf den Klienten, um ihn in seiner Selbstverantwortlichkeit zu stärken.
2. Die Phrasierung des Hilfeprozesses
Hollis unterteilt den Hilfeprozess in drei aufeinander bezogene Handlungsschritte, nämlich der psychosozialen Untersuchung (Anamnese), der Diagnose und der Behandlung (ebd.: 184 ff.). Bei der Anamnese geht es nach Hollis im Wesentlichen um die Sammlung von Informationen und Fakten, um die Schwierigkeiten und Probleme des Klienten (meistens zwischenmenschliche, in der Kindheit zurückliegende) zu begreifen (Explorationsphase). Der Klient übernimmt durch die Schilderung seiner „Problematik“ den aktiveren Part. Je nach Fall konzentriert sich die soziale Untersuchung auch auf andere Beteiligte, die möglicherweise ein Problem mit verursachen (z. B. Ehepartner, Kinder, Familie, etc.).
Der Diagnoseprozess stellt „die gedankliche Verarbeitung der Fakten durch den Sozialarbeiter dar“ (ebd.: 187). Der Sozialarbeiter soll die Situation beurteilen und sich dabei zunächst auf äußere Einflüsse konzentrieren, die Druck auf den Klienten ausüben können. Hierbei geht es um das Ordnen von Tatbeständen, eine Festlegung der äußeren Ursachen (Nachbarschaftsverhältnisse, Arbeit, soziale Gruppen, etc) für die Entstehung der äußeren Problematik. Die in der Anamnese gesichteten Daten sollen nun auch Aufschluss geben über die „innere Problematik“ des Klienten, genauer: über „libidinöse und aggressive Züge, Ich- Eigenschaften, Über-Ich-Merkmale und die Symptomatik“ (ebd.: 198). Hollis betont, dass die Festlegung der äußeren Umstände, in der sich der Klient befindet, vor der Benennung der Persönlichkeitsfaktoren zu erfolgen habe, um eine richtige Einschätzung von der Persönlichkeit zu erhalten.
Bei der Beurteilung des Klienten-Verhaltens spielen Normen (Maßstäbe) eine tragende Rolle. Nach Hollis geht es demnach um eine Bewertung der Handlungen und Reaktionen des Klienten. Es geht um ein „angepasstes Reagieren“, wobei der Sozialarbeiter bei der Beurteilung von Verhaltensweisen Geschlecht, Alter, ethnischen Hintergrund und die Schichtzugehörigkeit zu berücksichtigen hat. Ein Auferzwingen eigener Verhaltensnormen auf den Klienten wird strikt abgelehnt. Hollis orientiert sich hier explizit an Verhaltens- und Rollentheorien, sie erwähnt in jeweiligen Fußnoten Talcott Parson (1951), die Arbeiten von Hans Pfaffenberger und Margaret Mead (ebd.: 39, 202, 204).
Beim letzten Schritt, der eigentlichen „Behandlung“ unterscheidet Hollis zwischen direkter und indirekter Behandlung, eine Einteilung, die schon Mary Richmond vorgenommen hat (vgl. ebd.: 91). Bei der ersten Phase geht es primär um die Gespräche und Direkteinwirkungen auf den Klienten. Hollis unterscheidet zwischen sechs Untergruppen (ebd.: 92 ff.), aus denen sich die direkte Behandlung konstituiert. Insgesamt kommen stützende, direktive und reflektierende Techniken zur Anwendung. Sie zielen darauf ab, ein „Verständnis für seine gegenwärtige Lage, für seine Reaktionen auf diese und für die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Faktoren“ (ebd.: 96) zu gewinnen. Bei der indirekten Behandlung geht es hauptsächlich um Einwirkung und Veränderung von Umwelteinflüssen. Der Sozialarbeiter hat dann die Funktion, alle potentiell Beteiligten (z. B. Lehrer, Familie, Arbeitgeber) in den Hilfeprozess mit einzubeziehen, da sie das Problem oder die Anpassungs- schwierigkeiten des Klienten auch mit verursachen können.
6.1.3 Bewertung und Einschätzung
Der psychosoziale Ansatz versteht sich als „system-theoretisch“, wobei Hollis diesen Ansatz aber nicht konsequent weitergeführt hat. „Das Ganze kann mehr sein als seine Teile, aber es darf diese nicht auslöschen“ (ebd.: 210), ist eine Aussage, die einem systemtheoretischen Postulat entspricht, dennoch hat Martin Galuske zu Recht darauf verwiesen, dass system-theoretisch bei Hollis eher im Sinne von Ganzheitlichkeit (Leib- Seele Einheit) verstanden wird (Galuske 1998: 80). Die Interventionen beschränken sich immer auf den Menschen in seiner spezifischen Situation. Hollis orientiert sich sehr stark an der Psychoanalyse; von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der Klient anhand von Über-Ich und Ich Funktionen bewertet wird. Auch erscheint somit der Einbezug der Vorgeschichte (auf Kindheit bezogen) in der Anamnese als logisch und konsequent, wenn auch eine „die Kindheit umfassende Anamnese und Diagnose nicht mehr in jedem Fall für notwendig erachtet wird“ (ebd.). Problematisch sind die Folgen einer übermäßigen Orientierung an der Psychoanalyse. Es werden nur Probleme, Schwierigkeiten, „Störungen“ und andere psychische Auffälligkeiten registriert und als Ausgangspunkt der sozialarbeiterischen Intervention benutzt. Damit werden die Probleme eindeutig im Individuum lokalisiert, nach möglichen Ressourcen und Kompetenzen der Klienten wird kaum oder nur am Rande gefragt. Zwar betont Hollis den Einbezug des situativen Kontexts, aber genau wie im Individuum selbst stellen Umweltfaktoren primär ein Problem, eine mögliche Belastung für den Klienten dar. Gefragt wird also erst gar nicht nach möglichen Ressourcen und „Wachstumsfördernden Kräften“, die die Umwelt bereitstellt. Darüber hinaus werden Umweltfaktoren als „kausale Problemursachen nur insofern wahrgenommen, wie sie innerhalb der definierten Reichweite des Behandlungsprozesses liegen“ (ebd.: 78). Hollis erwähnt in ihren Ausführungen auch Verhaltens- und Rollentheorien, die bei der Beurteilung von Verhaltensweisen zur Anwendung kommen. Sie haben aber nur eine sekundäre, untergeordnete Bedeutung. Somit wird sie meiner Auffassung nach dem Anspruch auf ein ganzheitliches Denken nicht gerecht. Auffällig ist auch, dass sie zwar an mehreren Stellen die Selbstbestimmung des Klienten betont, jedoch der Sozialarbeiter den größeren Stellenwert im Hilfeprozess einnimmt. Abschließend sei noch eines gesagt:
Die soziale Einzelfallhilfe lässt sich generell dem individualistischen- subjektzentrierten Paradigma zuordnen. Nähere Ausführungen dazu erfolgen unter der „Sozialen Arbeit als Handlungswissenschaft“ nach Silvia-Staub-Bernasconi.
6.2 Helen Harris Perlman: Soziale Einzelhilfe als problemlösender Prozess
6.2.1 Allgemeine Einführung
Helen Perlman betrachtet die Methode der Einzelhilfe (Casework) als ein Prozess, der Menschen dazu befähigen soll, ihre Probleme im sozialen Bereich zu bewältigen. Schon zu Beginn ihrer Ausführungen ordnet sie ihr Modell innerhalb der psychoanalytischen und diagnostischen Schule ein: „Durch Erfahrung, berufliche Ausbildung und Überzeugung bin ich psychoanalytisch und diagnostisch orientiert; vielleicht sollte ich noch hinzufügen: auch infolge natürlicher Neigung, denn ich könnte mir kaum vorstellen, anders als in Beziehung zu diesen beiden Systemen zu denken oder zu handeln“(Perlman 1969: 13). Ausgehend von der oben genannten Definition leitet sie die konstitutiven Merkmale und Elemente der Einzelfallhilfe ab, die im Wesentlichen die Person, das Problem, die Stelle / Ort und den Prozess umfassen.
6.2.2 Die Person
Perlman betrachtet die Person als ein lebendiges Wesen, „dass in ständiger Wechselbeziehung mit seiner (ebenfalls lebendigen) Umwelt lebt“ (ebd.: 21). Innerhalb ihres Menschenbildes kommt auch ein Ganzheitsgedanke zum Ausdruck, insofern, als konstitutionelle, psychische und soziale Faktoren auf die Person einwirken. In ihrer Persönlichkeitsanalyse lehnt sie sich offenkundig an der Freudschen und Adlerschen Terminologie an, wobei durch die zahlreicheren Verweise auf Freud erstere eindeutig dominiert. An einer Stelle konstatiert sie: Ziel und Bedeutung des menschlichen Verhaltens sind, Befriedigung zu erlangen, Frustrationen zu vermeiden oder sich ihrer zu entledigen“ (ebd.: 22). Hier kommt meiner Ansicht nach Freuds Homöostase-Modell zum Vorschein, wonach der Mensch den durch die Triebe erzeugten Druck abbauen will, um einen Gleichgewichtszustand herzustellen. An machen Stellen ihrer Ausführungen kommen aber auch die Adlerschen Gedankengänge zum Ausdruck, denn sie geht davon aus, dass der Mensch nicht nur durch vergangene und gegenwärtige Erfahrungen beeinflusst wird, sondern auch „Zukunftshoffnungen“ das Verhalten lenken. Hierin sehe ich einen Anknüpfungspunkt an das finale Denken Adlers. Noch expliziter erscheint die Anlehnung an Adler, wenn sie davon spricht, der Mensch ist bestrebt, ein „Gefühl der Sicherheit und Überlegenheit wiederherzustellen“(ebd.: 23). Kritisch muss ich hier aber einwenden, dass gerade das Freudsche Persönlichkeitsmodell in einem etwas längeren Abschnitt (S. 24 - 33) unreflektiert nacherzählt und als allgemeingültige Erkenntnis angesehen wird, sowie jederzeit im klientenbezogenen Handeln sichtbar ist: „Selbst an so einfachen Entscheidungen, ob man zur Beratungsstelle geht oder nicht, oder ob man die nächste Verabredung mit dem Caseworker einhält, sind das Es, das Über-Ich und das Ich des Klienten beteiligt“ (ebd.: 33). Zumal nach Perlman das Zukünftige auch den Menschen bestimmt, spricht sie auch von einem „Prozess von Sein und Werden“ (ebd.: 34) und geht aus von einer jederzeit möglichen Entwicklung und Veränderung der Persönlichkeit. Rein hypothetisch könnte sie sich anhand solcher Aussagen an Frankl und Rogers orientiert haben: Gerade Frankl ist es doch, der mit seiner Logotherapie individuelles Wachstum und Reifung ermöglichen will und Rogers betonte die Fähigkeit des Menschen zur Selbstaktualisierung, wodurch Wachstum und Entwicklung jederzeit möglich ist. Wie gesagt, sie hat in ihrem Buch abgesehen von Freud keinen der anderen Autoren explizit erwähnt. Durch den Gebrauch bestimmter Termini und Ausdrucksweisen lassen sich aber durchaus Anknüpfungspunkte zu den Autoren ziehen.
6.2.3 Das Problem
Die Fokussierung auf die Probleme der Klienten ist das herausragende Merkmal der Einzelfallhilfe nach Perlman. Sie erwähnt die Vielzahl der möglichen Klientenprobleme (wirtschaftliche, erzieherische, psychische, etc.), betont aber, dass eine Bearbeitung der Probleme nie vollständig erfolgen kann, und der von mir zu Anfang aufkommende Verdacht eines „Pseudo-Ganzheitsgedanken“, der nur ideeller, abstrakter Natur ist, findet seine Bestätigung in folgender Aussage:
„Wie in jeder anderen problemlösenden Tätigkeit, so muss auch im Casework das konkrete Vorgehen partiell, zielgerichtet und folgerichtig sein, wenn auch das intellektuelle Verständnis und der gedankliche Plan das ganze Problem umfassen“ (ebd.: 45). Sicherlich hat sie Recht, dass der Sozialarbeiter mit dem Klienten die Problemvielfalt bewerten muss und zunächst erst die dringlichsten Probleme zu bearbeiten hat. Allerdings darf in der gegenwärtigen Sozialarbeit der Ganzheitsbegriff keine Floskel, kein Abstraktum bleiben, weil sich in der Praxis die Probleme gegenseitig bedingen. Dieser Sachverhalt kommt in Bernasconis Handlungsmodell, das später noch beschrieben wird, besser zum Ausdruck. Positiv bewerte ich allerdings ihr Verhältnis zwischen Sozialarbeiter und Klient. In ihrem Modell kommt im Gegensatz zu Hollis eher „expertokratischen“ Haltung eine demokratisch gesinnte, auf Gleichheit tragende Beziehung zum Ausdruck, in der der Klient mit seinem Problem in den Mittelpunkt gerückt wird und das sozialarbeiterische Handeln einleitet: „Das Problem ist das Problem des Klienten, und sein Wunsch nach Hilfe geht davon aus, wie er es sieht und empfindet“(ebd.: 45). Der Grundsatz oder die sozialarbeiterische Haltung, „der Caseworker muss mit seinen Klienten dort beginnen, wo dieser steht“, unterstreicht nochmals diesen Subjektstatus.
6.2.4 Der Prozess
Perlman betrachtet das menschliche Leben von Geburt an als einen problemlösenden Prozess, der sich durch Bewegung und Veränderung auszeichnet. Sie geht davon aus, dass bei ausreichenden „Ich-Kräften“ (ebd.: 72) jeder imstande ist, durch gründliche Ermittlung und Einordnung des Problems einen Zustand des inneren Gleichgewichts und somit die Anpassungsfähigkeit wieder herzustellen. Menschen, bei denen diese „Ich-Kräfte“ zu schwach sind befinden sich dagegen in einem Zustand physischer oder emotionaler Erschöpfung: „Unter solchen Umständen kann es für den Caseworker notwendig werden, zunächst mit physischer und psychischer Unterstützung das Gleichgewicht des Klienten so weit wieder herzustellen, dass er sein Problem ins Auge fassen und anpacken kann“ (ebd.: 73). Damit benennt sie eine Aufgabe des Sozialarbeiters bzw. Caseworkers.
Eine weitere Aufgabe ist wieder sehr an dem Freudschen Konzept angelehnt, da sie von belastenden Gefühlen der Klienten spricht, die durch das Wiederaufleben früherer Gefühle sogar noch gesteigert werden. Der Caseworker muss also versuchen, zunächst den Klienten von diesen Gefühlen zu befreien, damit er in der Lage ist seine Denkprozesse für seine Problemlösungsfähigkeit zu nutzen.
Im weiteren Verlauf ihrer Ausführungen benennt sie die drei notwendigen Schritte für ein professionelles Problemlösen, die sich im Wesentlichen aus der Fallstudie (Sammeln von Fakten), der Diagnose (Feststellung, Erklärung des Problems) und der Behandlung (weiterführende Maßnahmen) konstituieren (vgl. ebd.: 79 ff.). Dieser auch heute noch oftmals angewandte methodische Dreischritt in der Sozialen Arbeit wird aber auch von ihr kritisiert, insofern, als ihrer Ansicht nach Aspekte wie Kooperation und der Dialog mit dem Klienten häufig ausgehebelt werden und der Sozialarbeiter den Prozess des Problemlösens bestimmt. Eine Kritik an paternalistischen, entmündigenden Vorgehensweisen wird spürbar an folgender Aussage: „Das läuft daraus hinaus, dass der Klient von den Anstrengungen des Caseworkers abhängig wird, anstatt von diesem als aktiver Partner seiner Bemühungen angesehen zu werden“(ebd.: 80). Perlman geht es also um die aktive, auf Kooperation und Dialog aufgebaute Integration des Klienten in den Prozess des Problemlösens. Ähnlich wie bei Hollis unterteilt Perlman den diagnostischen Prozess in eine dynamische, eine klinische und eine ätiologische Diagnose (ebd.: 191 ff.). Während erstere bemüht ist um eine Feststellung der psychologischen, physischen und sozialen Faktoren, die ein Problem mit verursachen können, geht es bei der zweiten um eine präzise Klassifizierung und Darstellung eines klinischen Krankheitsbildes. Diese Aufgabe sollte nach Perlman aber den Psychologen und Psychiatern überlassen bleiben, dennoch betont sie die Notwendigkeit von Kenntnissen in klinischer Diagnostik, um z. B. bei entsprechender Indikation Klienten zu überweisen (vgl. ebd.: 201). Die ätiologische Diagnose soll zuletzt die Ursachen des Problems ermitteln, wobei Perlman keine unmittelbaren Ursachen meint, sondern solche, die lebensgeschichtlich bedingt sind.
6.2.5 Synoptische Nachbemerkung
Genau wie in der „psychosozialen Behandlung“ nach Hollis werden die Probleme nach Perlman überwiegend im Individuum lokalisiert. Der Ansatz folgt dabei auch dem wohlbekannten methodischen Dreischritt, wobei Perlman den Begriff Anamnese durch den der Fallstudie ersetzt, inhaltlich besagt der Begriff aber das gleiche. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in der Orientierung an einem psychologischen, psychotherapeutischen Paradigma. Ein signifikanter Unterschied zu Hollis` Ansatz besteht in dem Ausgangspunkt sozialpädagogischen Handelns. Während nach Hollis sozialpädagogische Interventionen im Wesentlichen durch eine „Psychologie der Krankheit“ bedingt sind, setzt der Sozialarbeiter nach Perlman dort an, wo die Problemlösungsfähigkeit der Klienten beeinträchtigt ist, wobei die Veränderung des Problemlösungsverhaltens im Vordergrund steht. Der Sozialarbeiter ist demzufolge darum bemüht, Klienten zu einer Ressourceerschließung zu befähigen, letztlich soll er die gesunden und starken Anteile des Klienten fördern, wobei die Fähigkeiten (geistige, körperliche, emotionale) klar dominieren und die „kranken“ Anteile in den Hintergrund treten. Diesen Unterschied bei dennoch vielfältigen Gemeinsamkeiten betone ich mit Nachdruck. Michael Galuske konstatiert also zutreffend, dass der Ausgangspunkt eines sozialpädagogischen Ansatzes die Interventionsstrategien insgesamt nachhaltig beeinflusst (vgl. Galuske 1998: 81). Falsch liegt er dabei in der Annahme, dass die Unterschiede auch durch den Einbezug von Familien ersichtlich werden (ebd.). Diese hat Hollis in ihrer individuumbezogenen Arbeit auch berücksichtigt, wenn auch in marginaler Form.
6.2.6 Bewertung und Einschätzung
Mary Richmond brachte 1917 in den USA das Buch „Social Diagnosis“ heraus, in Deutschland veröffentlichte 1926 Alice Salomon in Anlehnung an Richmond das Buch „Soziale Diagnose“. Die Methode der sozialen Einzelhilfe nach Hollis und Perlman kann in diesem Sinne als eine Verarbeitung und Weiterentwicklung der älteren Ansätze verstanden werden. Gerade in Deutschland muss die Rezeption der Einzelhilfe als Importprodukt aus den USA auch historisch betrachtet werden. Der Nationalsozialismus ignorierte das Individuum zugunsten des Volksganzen, ab 1945 geht es „auch im deutschsprachigen Kontext um eine klare Hinwendung zum isolierten Individuum“ (Bernasconi 2007: 141). Die zahlreichen, von mir angeführten Kritikpunkte der sozialen Einzelhilfe (insbesondere der psychoanalytisch orientierten) sollen den Blick für die generelle Bedeutung für die Soziale Arbeit nicht schmälern. Nach Galuske sind es hier im Wesentlichen zwei Punkte, die erwähnt werden müssen (ebd.: 85 ff.):
1. „An der Stelle eines undurchdachten, rein intuitiven Vorgehens betont die soziale Einzelhilfe seit ihrer Entstehung „die Idee einer strukturierten, planbaren und wissensbasierten Intervention, die damit zugleich einer Kontrolle ihrer Effektivität zugänglich gemacht werden kann. Handeln in der Sozialen Arbeit wurde begründungsbedürftig...“(ebd.)
2. Mit der Entwicklung der sozialen Einzelhilfe wurde die Verberuflichung der Sozialen Arbeit vorangetrieben. „Methodische Kompetenz und Verberuflichung gehören zusammen“ (Wendt 1990a: 235, zit. in: Galuske 1998: 85). Innerhalb der Professionalisierungsdiskussion wurde Galuske zufolge Soziale Arbeit einen Platz in der zweiten Reihe verwiesen. Mit anderen Worten erfolgte eine Verberuflichung, aber keine Anerkennung eines erhofften Status, der den klassischen Professionen wie Medizin und Jurisprudenz gleichkommen würde. Die Gründe dafür sind vielfältig und sollen hier nicht näher erörtert werden.
Auch gegenwärtig findet die soziale Einzelhilfe noch ihre Anwendung. Zwar gilt heute in der Sozialen Arbeit die Lebensweltorientierung als allgemeines Leitmotiv, wodurch das Konstrukt der „Problemlage“ abgelöst wurde zugunsten einer systemischen Sichtweise, bei Entscheidungsvorbereitungen für Heimeinweisungen oder einem Entzug des Sorgerechts wird diese klassische Methode u. a. dennoch genutzt (vgl. Arnold/Maelicke 2003: 160, 162).
6.3 Germain; Gitterman: Das „Life Model“ der Sozialen Arbeit
6.3.1 Allgemeine Einführung
Carel B. Germain und Alex Gitterman haben ihr Buch “Das Life Model der Sozialen Arbeit” (1983) als „den Anfang des Versuches, die Dimensionen einer integrierten Methode des sozialpraktischen Arbeitens mit Einzelpersonen, Familien, Gruppen und Organisationen sowie mit ausgewählten Aspekten von Nachbarschafts- und Gemeindestrukturen im Zusammenhang darzustellen“, bewertet (Germain/Gitterman 1983, XII). Sie bezeichnen ihr Modell als eine „integrierte Praxismethode“ und benutzen „Ökologie als Metapher für die Praxis“, mit der die Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihren Umweltbedingungen beleuchtet werden (Germain/Gitterman 1983: 5). Mit dieser ökologischen Perspektive findet gleichzeitig eine Abwendung vom Festhalten am medizinischen Krankheitsmodell statt, da es dazu tendiert, Probleme ausschließlich innerhalb der Person zu lokalisieren. Mit ihrem „Life Model“ gehen sie aber einen bedeutenden Schritt weiter, indem sie auf die Umweltbedingungen eingehen, die den Menschen beeinflussen, die aber umgekehrt auch vom Menschen selbst verändert werden: „Die ökologische Perspektive liefert eine adaptive, evolutionäre Sicht vom Menschen, der sich in ständigem, wechselseitigem Austausch mit allen Elementen seiner Umwelt befindet. Menschen verändern ihre physische und soziale Umwelt und werden von ihr durch kontinuierliche, reziproke Anpassungsprozesse verändert“ (ebd.: 5). Ernst Engelke bringt die dem Model zugrunde liegenden Zielsetzungen genau auf den Punkt: Es geht erstens darum, die Wachstums- und Anpassungspotentiale der Klienten zu fördern, zweitens aber auch darum „die Umwelt zu verändern, um jenen Grad gegenseitiger Abstimmung zu erreichen, der unter ökologischen Gesichtspunkten die Lebensqualität bestimme“ (Engelke 2003: 428). Gelingt diese gegenseitige Abstimmung nicht, so werden die Austauschprozesse (Transaktionen) zwischen Umwelt und Person gestört. Bevor ich den theoretischen Rahmen verlasse und die praktische Methode des „Life Models“ eruiere, möchte ich aber noch kurz die wesentlichen philosophischen und wissenschaftlichen Einsichten zusammenfassen, die diesem Modell zugrunde liegen:
1. Das „Life Model“ wendet sich explizit von einem mechanistischen Menschenbild ab, das ausgehend von den Entdeckungen Newtons sowohl die Biologie als auch die Sozialwissenschaften des 19. Jahrhunderts beeinflusste (vgl. Germain/Gitterman 1983: 2).
2. Innerhalb der Sozialwissenschaften wurde der Mensch noch losgelöst von seiner Umwelt betrachtet, es wurde eine einseitig „lineare Sicht von Zeit, Raum und Kausalität“ (ebd.: 3) entworfen, wobei der Ganzheitsgedanke unberücksichtigt blieb. Dem Model liegt vielmehr ein ganzheitlich-systemisches Weltbild zugrunde, das vereinfachtes Ursache-Wirkungsdenken ablehnt und eher von zirkulären Zusammenhängen ausgeht. Die Autoren erwähnen explizit die Feldtheorien, Gestalttheorien, organismischen Ansätze sowie die allgemeinen Systemtheorien. Es sollte einleuchten, dass das „Life Model“ von diesen Ansätzen beeinflusst wurde.
6.3.2 Elemente des „Life Models“
Die Konzeption des „Life Models“ umfasst folgende Bausteine oder Elemente:
- Problemdefinition
- Rollen von Klient und Sozialarbeiter
- Phasen des Hilfeprozesses
- Die soziale Diagnose
- Professionelle Handlung
1. Problemdefinition:
Das Problem sollte immer im Feld zwischen Person und Umwelt lokalisiert sein. Außerdem wird es als „fehlangepasste Transaktionen innerhalb des Lebensraumes definiert“ (ebd.: 14). Die Autoren führen ein Beispiel an, um die fatalen Konsequenzen bewusst zu machen, wenn Probleme pathologisiert werden: Ein Schulverweigerer wird mit einer Schulphobie etikettiert. Mit dieser Herangehensweise wird Störung einseitig innerhalb der Person selbst lokalisiert, die Umweltbezüge werden somit weitestgehend außer Acht gelassen. Das „Life Model“ versucht nun, mit dem Klienten gemeinsam mögliche innerdynamische, in der Hauptsache aber exogene Faktoren zu ermitteln, die zu seinem Verhalten geführt haben. Das könnten z. B. die internen Familienbeziehungen, die Situation in der Klasse, oder die Transaktionen zwischen Familie und Schule sein. Die Problemdefinition ist nach Germain und Gitterman ein Resultat aus drei miteinander verbundenen, interagierenden Bereichen, die potentiell Stress erzeugen können und mögliche „kumulative“ und „multiple“ Stressfaktoren darstellen:
1. Lebensverändernde Ereignisse: Dieser Bereich schließt entwicklungsbedingte Veränderungen (z. B. durch die Pubertät), Status- und Rollenveränderungen (z. B. durch einen Berufwechsel) und Krisen (z. B. der Verlust geliebter Personen) mit ein. Im Hinblick auf die psychosoziale Entwicklung Heranwachsender orientieren sich die Autoren explizit an Eriksons` Entwicklungsmodell (ebd.: 82 ff.) der Persönlichkeit. Demnach kann jede von Erikson beschriebene Stufe im Falle eines Nichtbewältigens der in ihr beschriebenen Anforderungen Stress erzeugen und für den Klienten stufen- bzw. phasenentsprechend sowohl Gefühle von Misstrauen, als auch Scham- und Minderwertigkeitsgefühle oder Identitätsprobleme dauerhaft in der Person verankern. Germain/Gitterman beschreiben auch die kognitive Entwicklung Heranwachsender (ebd.: 84 ff.), wobei sie sich hier auf Befunde von Jean Piaget und Albert Bandura stützen. Sie erwähnen explizit die auf Piaget zurückgehenden klassischen funktionellen Invarianten, wonach Individuen sich sowohl der Umwelt anpassen (Akkomodation) als auch aktiv und handelnd auf sie einwirken (Assimilation). Auf Bandura wird indirekt rekurriert, insofern, als bei der Entwicklung der Kognition die symbolische Repräsentation eine Rolle spielt. Mögliche Stresserfahrungen können den Autoren zufolge dadurch bedingt sein, dass der Mensch mit zu vielen oder zu wenig Reizen konfrontiert wird (ein Resultat wäre eine sensorische oder intellektuelle Deprivation).
2. Situationen mit besonderem Umweltdruck: Unterschieden wird zwischen einer sozialen, physischen und materiellen Umwelt (ebd.: 134 ff.). Die soziale Umwelt kann sich z. B. aus dem sozialen Netzwerk, in das der Klient eingebettet ist (oder nicht), der sozialen Dienststelle, Nachbarschaften oder der Gesellschaft als Ganzem konstituieren. Typisch für das „Life Model“ ist ein immanenter Dualismus. Damit meine ich, dass auch im Falle der Umwelt in ihr sowohl eine „Kraftquelle“ als auch ein Stresspotential gesehen werden kann. Soziale Netzwerke werden beispielsweise im steigenden Alter brüchiger, alternde Menschen befinden sich oft in einem Zustand der Isolation. Generell besteht die Aufgabe bezogen auf die Umweltproblematik darin, für die Klienten notwendige Umweltressourcen zu erschließen und auch materielle Unterstützungsleistungen anzubieten.
3. Interpersonale Prozesse: Sozialarbeiter sollen dem „Life Model“ entsprechend sowohl in Gruppen als auch in Familien gestörte Kommunikations- und Beziehungsformen aufdecken (vgl. ebd.: 194 ff.). Hier wird explizit auf den systemisch- familientherapeutischen Ansatz von Salvador Minuchin verwiesen (ebd., 194: 211), dessen Grundannahmen im „Life Model“ zum Ausdruck kommen. Folglich wird Familie als ein System interagierender Teile verstanden, die sich aus mehreren Subsystemen zusammensetzt. Der Sozialarbeiter soll die dysfunktionalen Familien oder Gruppenprozesse beheben, indem jedes Mitglied zunächst seine Wahrnehmung und Auffassung des Problems vorträgt. Angestrebt wird eine kommunikative Aushandlung der Konfliktpunkte. Dem Sozialarbeiter kommt dabei die Rolle des Motivators, Lehrers, Förderers und Vermittlers zu. Er soll den Mitgliedern dabei verhelfen, die Botschaften zu analysieren und die mit dem Inhalt verbundenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Dabei können Techniken wie z. B. das Rollenspiel oder die Erstellung eines Genogramms eingesetzt werden.
2. Rollen von Klient und Sozialarbeiter
Die Beziehung zwischen Klient und Sozialarbeiter wird als transaktional aufgefasst. Das „Life Model“ betont den Austausch und die Wechselseitigkeit der persönlichen Begegnung zwischen Klient und Sozialarbeiter. Gerade durch die Hervorhebung der Transaktionen wird eine „expertokratische Haltung“ abgelehnt. Da sich beide wechselseitig beeinflussen kann die Beziehung zwischen Klient und Sozialarbeiter als „bedingt“ symmetrisch bezeichnet werden. Die Autoren machen darauf aufmerksam, dass Sozialarbeiter oft ihre Klienten nach favorisierten Theorien bewerten und von daher die Gefahr bestünde, wichtige Mitteilungen der Klienten zu übersehen. Sie betonen die Notwendigkeit „eines Bewusstseins dieser Voreingenommenheit“ (ebd.: 19). Die Rollen des Sozialarbeiter beschränken sich im Wesentlichen auf die des Motivators, des Lehrers und des Förderers (ebd.: 104 ff.). Zur ersteren ist zu sagen, dass die Klienten befähigt werden sollen, Stresssituationen gezielt anzugehen, die mit lebensverändernden Ereignissen einhergehen. Er soll in diesem Zusammenhang auch vorhandene Fähigkeiten bestätigen und bestärken. In der Rolle des Lehrers und Förderers hat er die Funktion, dem Klienten bestimmte Anpassungsmechanismen zu vermitteln. Dabei geht es auch um die Bereitstellung von notwendigen Informationen und die Verbreitung von Vorschlägen, die der Klient benötigt, um die Stresssituation zu bewältigen. Generell besteht die Aufgabe darin, Individuen, Familien und Gruppen dabei zu helfen, „mit den Anpassungsaufgaben fertig zu werden, die sich aus Stresserzeugenden, lebensverändernden Ereignissen ergeben“ (ebd.: 106).
3. Phasen des Hilfeprozesses
Germain/Gitterman unterteilen den Hilfeprozess in eine Eingangs,- Arbeits- und Ablösungsphase. Allen Phasen ist gemeinsam, dass sie in kooperativer Weise bewältigt werden sollen. Bei der Eingangsphase unterscheiden die Autoren zwischen der Vorbereitung und den einleitenden Kontaktgesprächen (ebd.: 37 ff.). Bei der Vorbereitung geht es darum, anhand vorhandener Daten die Situation des Klienten einfühlend zu verstehen (z. B. durch Akteneinsicht, Telefonate), Germain und Gitterman sprechen auch von einer „antizipatorischen Empathie“. Am Beispiel eines pubertierenden, depressiven Mädchens veranschaulichen die Autoren die Vorbereitungsphase. Nachdem der Sozialarbeiter sich telephonisch mit dem Mädchen in Verbindung gesetzt hat, soll er deren Situation durch vier empathische Schritte nachvollziehen (ebd.: 38):
„1) Identifikation, über die der Sozialarbeiter erfährt, was der Klient fühlt und denkt: Hier sind Kenntnisse über die Situation Heranwachsender von Bedeutung (z. B. die Abhängigkeits-Unabhängigkeitsproblematik in der Pubertät);
2) Inkorporation, über die der Sozialarbeiter die Erfahrungen des Klienten in seinem Inneren fühlt, als ob sie seine eigenen wären;
3) die innere Reaktion, die besagt, dass der Sozialarbeiter eigene Lebenserfahrungen wachruft und seine Reaktionen auf solche Situationen reaktiviert, die ihm das Verständnis des Klienten erleichtern, und schließlich
4) Distanzierung, über die der Sozialarbeiter zu einer rationalen, objektiven Analyse gelangt.“
Die vier empathischen Schritte lassen einen engen Bezug zu Rogers’ geforderten Wert- und Grundhaltungen in der klientenzentrierten Therapie erkennen, nur dass die Terminologie im „Life Model“ eine andere ist. Auch in den einleitenden Kontaktgesprächen (Exploration) tauchen sie wieder auf, die Autoren „verlangen“ ein „wirkliches Interesse“ und „echte Aufgeschlossenheit“ gegenüber den Klienten (ebd.: 75). Nach mehreren Gesprächen soll nun eine gemeinsame, vorläufige Problemdefinition erstellt werden, über die eine wechselseitige Übereinkunft über Zielsetzungen, Aufgaben, Rollenanforderungen und den Arbeitsbedingungen erfolgt (Kontraktabschluss). Es handelt sich um „flexible, dynamische und unabgeschlossene Prozesse“ (ebd.: 77), durch die auch das Machtgefälle zwischen Sozialarbeiter und Klient abgebaut werden soll. Der Sozialarbeiter soll in dieser Phase die Motivation und Kognition des Klienten mobilisieren, damit er sich verantwortlich am Hilfeprozess beteiligen kann. In den Erstgesprächen sind Variablen wie Alter, Geschlecht, kulturelle Normen, der kognitive „Stil“ (z. B. eher visueller oder pragmatischer Typ), das Sozialisationsniveau und die Bedingungen der Dienststelle mit zu berücksichtigen. Auf die Arbeitsphase werde ich nur kurz eingehen. Die Funktionen des Sozialarbeiters ergeben sich aus den möglichen stresserzeugenden drei Bereichen (ebd.: 126 ff.). Je nach Problematik wird ihm die Rolle des Motivators erteilt (z. B. Klienten befähigen, mit Stressfaktoren umzugehen), die des Lehrers (z. B. mit Informationen versorgen, Rat und Vorschläge) oder die des Förderers (z. B. Einübung von Kompetenzen). In der Ablösungsphase soll gemeinsam über den Status Quo reflektiert werden. Die erreichten Ziele, ebenso die nicht erreichten und solche, die zukünftig zu bearbeiten sind, kommen hier zur Sprache. Es geht auch darum, den Klienten (der Gruppe, etc) auf die bevorstehende Trennung behutsam vorzubereiten (Erleichterungsphase). Gemeinsam soll erörtert werden, was für den Klienten nun das Beste ist (z. B. Überweisung an eine andere Dienststelle, Verzicht auf weitere Unterstützung, etc.).
4. Die soziale Diagnose
Mit der Erstellung einer sozialen Diagnose sollen möglichst objektive und subjektive Aussagen über das Problem und dessen Entstehung gemacht werden. Der Sozialarbeiter soll ausgehend von den Klientendaten bestimmte Schlussfolgerungen und Hypothesen bilden, die es gemeinsam mit dem Klienten zu überprüfen gilt. Um die Situation des Klienten zu verstehen, sollte wieder ein gewisser Grad an Einfühlungsvermögen vorhanden sein: „Dieser Prozess erfordert jene mitfühlende Teilnahme und jenen Respekt vor dem menschlichen Erleben und der Einmaligkeit des Individuums, die die Ausübung dieser Praxis auch zu einer Kunst machen“ (ebd.: 22). Als ich diesen Satz gelesen habe, kam mir eine Aussage von Adler in den Sinn, der in seiner therapeutischen Arbeit betonte: „Es ist eine Kunst, jemand zu gewinnen, es ist eine Kunst, ihn in die Stimmung zu bringen, zuzuhören und zu begreifen“ (Ansbacher/Ansbacher 1995: 319). So banal und trivial der Vergleich auf den ersten Blick auch erscheinen mag, die darin enthaltenen Aussagen sind sowohl im therapeutischen als auch im sozialarbeiterischen Setting meiner Wahrnehmung nach konstitutiv. Worauf es den Autoren (Adler mit eingeschlossen) ankommt, ist eine fruchtbare Vernetzung wissenschaftlicher und künstlerisch-humanistischer Werte - „das Ethos eines wissenschaftlich fundierten Praktikers wie das kreativ künstlerische Können des mitleidsvoll Teilnehmenden. Das Verstehen bleibt nicht schematisch, sondern wird konkret und lebendig“ (Germain/Gitterman, 1983: 22).
5. Die Professionelle Handlung
Das „Life Model“ betont, dass bestimmte Techniken und Kompetenzen des Sozialarbeiters eine wichtige Grundlage darstellen, um die Selbstbestimmung und Autonomie des Klienten zu fördern, aber es wird explizit erwähnt, dass „weder irgendeine Technik noch irgendein Können für das Life Model wirklich spezifisch ist“ (ebd.: 23). Des Weiteren lehnen die Autoren eine neutrale, unpersönliche Haltung und Einstellung gegenüber den Klienten ab: „Sozialarbeiter, die bereit sind, ihre Menschlichkeit, ihre Schwächen, ihre Spontaneität und ihren Humor zu zeigen, werden von den Klienten als hilfreich und fürsorgend erlebt“ (ebd.: 24). Beide Prämissen und Überzeugungen sind fast kongruent mit denen Frankls. Frankl legte in seinen psychotherapeutischen Begegnungen weitaus mehr Wert auf die zwischenmenschliche Begegnung an sich und lehnte eine neutrale Einstellung zu seinen Klienten vehement ab. Rein hypothetisch wäre es somit auch möglich, innerhalb des „Life Models“ logotherapeutische Elemente zu integrieren und die Sinnfrage in den Blick zu nehmen.
6.3.3 Bewertung und Einschätzung
Das „Life Modell“ stellt den Versuch dar, die Kompetenzen, Ressourcen und Stärken von Einzelnen, Gruppen oder Gemeinwesen zu fördern. Entsprechend finden sowohl die soziale Einzelhilfe, soziale Gruppenarbeit und die Gemeinwesenarbeit im „Life Modell“ ihre Anwendung. Dabei rückt der Blick auf den gesamten Lebensraum der Betroffenen, der sowohl persönliche Kompetenzen, die Anforderungen, die die Umwelt an einen stellt, als auch soziale, ökonomische, politische und physikalische Bedingtheiten mit berücksichtigt. Die Autoren betonen keine spezifische Technik, die im „Life Modell“ ihre Anwendung findet, somit wird die Option eröffnet für die Integration unterschiedliche Techniken (z. B. ein Einsatz logotherapeutischer Elemente). Der Mensch wird in seiner Komplexität als ein biologisches, sensorisches, kognitives, emotionales und soziales „System“ umfassend erfasst. Anpassung wird als aktiver Prozess verstanden, nach der Menschen nicht nur passiv auf Umweltreize reagieren, sondern sie auch aktiv verändern; diese Sichtweise entspricht den Vorstellungen sozial- kognitiver Theoretiker, die Menschen als proaktiv betrachten (Pervin/Cervone/John 2005: 549). Somit können im „Life Model“ auch sozial-kognitive Erkenntnisse integriert werden. Auch die von Rogers hervorgehobenen, im Kontext der Selbstaktualisierung stattfindenden Transaktionen mit der Umgebung ermöglichen direkte Anschlussstellen an das „Life Model“. Psychoanalytische Erkenntnisse spielen im „Life Model“ nur dann eine Rolle, wenn sich in Krisen befindende Personen durch Abwehrmechanismen (z. B. Verleugnung, Regression, Projektion)schützen wollen. Diese müssen nach Germain/Gitterman aufgedeckt werden, da sie langfristig eine effektive Problembewältigung beeinträchtigen (ebd.: 127) Der Begriff der Transaktionen hat bei Germain/Gitterman eine andere Konnotation als bei Hollis und Perlman. Nach Hollis stellen Transaktionen lediglich eine wechselseitige Beeinflussung zweier Personen dar (vgl. Hollis ebd.: 207), wobei der Fokus auf unilateralen Ursache- Wirkungsmechanismen liegt. Germain/Gitterman verstehen Transaktionen dagegen als ein komplexes Bedingungsgefüge von biologischen, psychischen und sozialen Prozessen in Verbindung mit der materiellen und sozialen Umwelt. Soviel zu den positiven Aspekten. Meiner Auffassung nach sind die Ausführungen der Autoren dogmatischer Natur, da Problemursachen immer nur als „gestörte“ Transaktionen zwischen Person und Umgebung verstanden werden. Andere Problemursachen (z. B. nur innerhalb der Person) gibt es demnach gar nicht. Damit einher geht der Anspruch auf ein universelles, global einsetzbares Konzept, wobei weltweit gesehen Probleme als Transaktionsprobleme aufgefasst werden. Meiner Ansicht nach darf Soziale Arbeit für sich keine Universalität beanspruchen, sie wird den komplexen Problemlagen der Klienten nicht gerecht und entspricht auch nicht der interdisziplinären wissenschaftlichen Ausbildung an Universitäten und Fachhochschulen. In der Praxis bestünde die Gefahr, dass unreflektierte HelferInnen einseitig Problemlagen den Methoden anpassen und nicht umgekehrt. Das „Life Modell“ orientiert sich sehr stark an Eriksons Entwicklungsmodell. Man hat den Eindruck, dass die Autoren unkritisch ein Modell übernommen haben und lediglich Eriksons beschriebene Konflikte und Krisen in den acht Stufen vereinfacht mit „Stress“ übersetzt haben. Irene Hiebinger favorisiert für die Praxis das „Life Modell“, ohne auch nur im Ansatz auf die kritischen Aspekte einzugehen (Hiebinger, in: Gehrmann/Müller 2007: 41 -83). Es werden überwiegend die theoretischen Bausteine des „Life Models“ unreflektiert nacherzählt, Eriksons Entwicklungsmodell nicht weiter kritisch analysiert (ebd.: 51 ff.). Dabei ist eine invariante, universale Stufentheorie problematisch, da die Lebensbedingungen sich in den Kulturen unterscheiden (vgl. Neugarten 1979, in: Flammer 2005: 97). Hinzu kommt, dass Hiebinger im „Life Model“ Anknüpfungspunkte für eine aktivierende Soziale Arbeit in der Arbeit mit unmotivierten Klienten sieht. Sie reiht es somit relativ kritiklos in die aktuelle fachliche und politische Diskussion vom „aktivierenden Staat“ (Stichwort: „Fördern und Fordern“) ein (Hiebinger, in: ebd.: 10, 11, 41 ff.). Der im Kontext der „Hartz-Reformen“ auf die Beschäftigungsfähigkeit zielende sozialstaatliche Umbau, wonach staatliche Leistungen prinzipiell nur durch Gegenleistungen (z. B. gemeinnützige Arbeit) erbracht werden, hat Auswirkungen auf die Soziale Arbeit, sie soll sich die „sozialstaatliche Programmatik zu eigen machen“ (Dahme, Wohlfahrt 2005: 1). Die in der Programmatik enthaltenen Prinzipien der Eigenverantwortlichkeit und Eigenvorsorge werden in der Sozialen Arbeit bei individuellem Fehlverhalten nun zu einer „Politik der Lebensführung“ (Giddens), wodurch bewährte Handlungsprinzipien (z. B. diskursive Lösungsstrategien) tendenziell ersetzt werden durch die Selbstdisziplinierung des Klientels (ebd., 1f.). Benedikt Sturzenhecker ist der Auffassung, dass sich die offene Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGBVIII) zunächst aufgrund ihrer strukturellen Bedingungen (Freiwilligkeit, Offenheit, Diskursivität, fehlende formale Machtmittel) von der repressiven Aktivierungsstrategie unterscheidet, dennoch konstatiert er eine zunehmende Implementation dieser Strategien im Kontext der offenen Jugendarbeit (Sturzenhecker: 134-150, in: Dahme/Wohlfahrt 2005). Dabei verweist er u. a. auf die staatlich auf erzwungenen Kurse zum „Sozialen Lernen“, die letztlich eine „Verhaltensoptimierung“ (ebd.: 140), eine Einübung in vorgegebene Verhaltensmuster darstellen, worin sich auch die „Fantasie einer pädagogischen Sozialtechnik“ (ebd.: 141) wiederspiegelt. Von diesem Standpunkt aus betrachtet gewinnt das auf noch näher einzugehende Modell von Rössner in unheilvoller Weise wieder an Bedeutung. Wenn Soziale Arbeit zukünftig ihr Leitmotiv der dialogisch ausgerichteten Lebensweltorientierung behalten will, muss sie sich kritisch mit den sozialstaatlichen Veränderungen auseinandersetzen, ansonsten bestünde im Sinne von Sturzenhecker die Gefahr der Erosion eines spezifischen und eigenständigen Sozialisationsfeldes (vgl. ebd.: 148).
6.4 Silvia Staub-Bernasconi: Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft
6.4.1 Jane Addams (1860 - 1935) - Systemtheoretikerin der ersten Stunde
Am Beispiel von Jane Addams illustriert Silvia Staub-Bernasconi, inwieweit diese Person einen bedeutenden Beitrag zur Professionalisierung der sozialen Arbeit leistete. Zudem betrachtet sie Addams als eine „Vorläuferin einer systemischen Konzeption Sozialer Arbeit“ (Bernasconi 2007: 15), die, wie sich noch zeigen wird, auf Bernasconis Entwurf einer theoretischen und praktischen Sozialen Arbeit insgesamt einen nicht unerheblichen Einfluss ausübte, so dass im folgenden auf ihre Arbeit näher eingegangen wird. Jane Addams, zu ihrer Zeit Sozialarbeiterin und Soziologin in Chicago, erstellte Problemlisten, um die Situation der Slumbewohner zu analysieren. Dabei griff sie alle nur erdenklichen, von den Folgen der Industrialisierung gebeutelten Slumbewohner und deren Probleme auf. Diese reichten von gesundheitlichen (verdorbene Nahrung, giftiges Abwasser), über arbeitsmarktbedingte (hohe Arbeitslosigkeit, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen), bis hin zu wohnraumbedingten (unerträglicher Rauch im Wohndistrikt) Problemen, um nur einige aufzuzählen. Für diese Probleme (besser: Verelendungsprozesse) führt sie im Wesentlichen zwei Erklärungsansätze an (vgl. ebd.: 58 ff.): zum einen führten soziale Segregationsprozesse zur „Aufrechterhaltung einer feudalen, das heißt mobilitätsundurchlässigen Gesellschaftsstruktur“ (ebd.: 58). Somit wurde den Slumbewohnern soziale Teilhabe durch Vorenthaltung sozialer und kultureller Güter (Bildung, Eigentum, etc.) nicht ermöglicht. Der Prozess der Marginalisierung würde zum anderen durch ein diskreditierendes, überholtes Bild der höheren Schichten vom Slumbewohner beschleunigt, demzufolge sie als apathisch, bildungsunfähig- und interesselos charakterisiert bzw. etikettiert wurden. Addams verurteilt nun dieses dahinter stehende Menschenbild, da es eine am Feudalismus orientierte Politik fortsetzt, mit anderen Worten, es diene der Legitimation an einer „repressiven Regulierung“ und Kontrolle der Bevölkerung“ (ebd.: 61). Addams formulierte für die Soziale Arbeit 1893 drei ihrer Ansicht nach konstitutive Ziele:
„1. solidarische Teilhabe am Leben der Menschen, die ein Teilen der Ressourcen und menschlichen Errungenschaften mit sich bringt (Teilen von und mit Teilhabe an materiellen und symbolischen Gütern wie Bildung, Wissen, Vermögen usw.);
2. integrale Demokratie als Ausweitung der Demokratie auf alle gesellschaftlichen Lebensbereiche bzw. Teilsysteme, insbesondere die Demokratisierung des Bildungsund Wirtschaftssystems (Abbau von Ausbeutung und Herrschaft durch neue soziale Anordnung von Menschen), und schließlich
3. Erneuerung („Renaissance“) eines christlichen Humanismus, das heißt die Hinwendung zum Menschen und seiner individuellen Würde anstelle einer herablassenden Barmherzigkeit.“ (ebd.: 62)
1889 gründete Addams das „Hull House“ in Chicago, welches Mittelpunkt und Sammelbecken sozialer, kultureller, politischer und Stadtteilbezogener Aktivitäten war.
Die vielen Menschen, die dort verkehrten, waren Hilfesuchende, Mitglieder von Selbsthilfegruppen und Einbürgerungskursen, Mitwirkende bei kulturellen Veranstaltungen, politisch Verfolgte, Arbeitslose, um nur einige aufzuzählen. Insgesamt betrachtet wurden Probleme behandelt, die sowohl auf der Mikro- und Mesoebene als auch auf der nationalen und internationalen Makroebene angesiedelt waren (vgl. ebd.: 64). Für letztere steht u. a. ihre Friedensarbeit im Rahmen der Women`s International League for Peace and Freedom (WILPF) sowie ihr unerbittlicher Kampf für die Gründung eines internationalen Gerichtshofes, „von dem sie größte friedens- und weltpolitische Bedeutung erhoffte“ (ebd.). Verkürzt gesagt können wir hier festhalten, dass ihre Arbeit lokal auf die Bewältigung der sozialen Probleme der Slumbewohner gerichtet war, international zielten ihre Bemühungen auf eine interkulturelle Verständigung der Nationen in Richtung auf friedvolle (Welt)- Gesellschaft.
6.4.2 Auffassung von Wissenschaft
Addams Auffassung von Wissenschaft stand in diametral entgegengesetzter Richtung zu dem um 1900 sukzessiv etablierenden „humanökologischen Paradigma“, das sowohl sozialdarwinistische und ökonomische Vorstellungen in sich vereinte. Diese Orientierung verdrängte Addams systemisch orientierte Sozialökologie an der Universität von Chicago. Und nicht nur das, sie verlor damit auch ihre Lehrbefugnis. Worin liegen nun die genauen Unterschiede beider Wissenschaftsauffassungen und wodurch wurde die Verdrängung aus der Universität verursacht? Nun, Addams stellte sich den damaligen Überzeugungen einer „modernen Wissenschaft“ entgegen, indem in ihrer praktischen Tätigkeit und in ihren Schriften das „Schisma zwischen Denken und Handeln, Theorie und Praxis, zwischen Philosophie, Ethik und Politik“ (Kleve 2003: 108) nicht stattgefunden hatte. „Das, was für sie eng zusammengehörte, nämlich Individuum und Gesellschaft, Gefühl, soziale Empathie und Rationalität, Empirie, Theorie, Wissenschaft und Praxis auf allen sozialen Ebenen einer Gesellschaft musste domestiziert und unschädlich gemacht werden“ (Bernasconi 2007: 95). Das „humanökologische Paradigma“ mit dem darin implementierten Wissenschaftsver- ständnis hatte, wie Bernasconi präzise schildert, im Wesentlichen zwei folgenreiche Konsequenzen (ebd.:95 ff.):
1. Patriarchalische Machtstrukturen führten zu einer geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung, mit anderen Worten war die Wissenschaft für die Männer bestimmt, die Frauen sollten dagegen die praktische Arbeit machen.
2. Wissenschaft musste strikt trennen zwischen Theorie und Praxis.
3. Insgesamt begann um 1900 eine „Apartheidspolitik“, die manifest wurde in einer zu dieser Zeit geforderten „gesonderte Ausbildung“ für Männer und Frauen an Universitäten.
6.4.3 Addams als Systemtheoretikerin
Addams umfassende, und hier nur stark verkürzt dargestellte sozialarbeiterische Tätigkeit ist insofern systemtheoretisch ausgerichtet, als sie und ihre Mitarbeiter auf der Mikro- Meso- und Makroebene tätig waren und diese Ebenen miteinander verbanden. Konkreter: Individuelle Hilfe wurde unmittelbar an Einzelne geleistet (Mikroebene), die Bedürfnisse der marginalisierten wurden an den Gewerkschaften, Parteien, an Universitäten u. a. vorgetragen (Mesoebene) und schließlich auch international zum Ausdruck gebracht (z. B. in Gestalt der WILPF: internationale Makroebene). Verallgemeinert formuliert bringt Bernasconi diesen Sachverhalt so zum Ausdruck:
„Gesellschaft wird hier nicht als den Individuen übergeordnete oder gar von ihnen abgetrennte Totalität, sondern als komplexes Gebilde mit vielen sozial differenzierten Teilsystemen und damit sozialen Ebenen beschrieben, denen Menschen angehören oder aus denen sie ausgeschlossen sind. Entsprechend bewegt sich soziale Praxis auch auf allen Ebenen der Gesellschaft“ (ebd.: 78).
6.4.4 Soziale Arbeit als handlungswissenschaftliche Disziplin
Zunächst stellt Bernasconi fest, dass bei „einer Theorie Sozialer Arbeit als normative Handlungswissenschaft“ (ebd.: 158) Wissen auf fünf Ebenen notwendig ist. Sie benennt nun folgende fünf Ebenen:
1. eine metatheoretische oder philosophische Ebene: Auf dieser Ebene werden vor allem Antworten auf die Fragen „Was ist Wirklichkeit?“, „Was ist Erkenntnis?“ gegeben.
2. eine objektheoretische Ebene: Auf dieser Ebene wird die Frage beantwortet, welche Theorien für soziale Probleme als Gegenstand Sozialer Arbeit gewählt werden unter Einbezug der Menschen und Gesellschaftsbilder
3. eine ethische Ebene: sie soll die Werte und Normen, die der Theorie zugrunde liegen, herausarbeiten
4. eine normative handlungstheoretische Ebene: Hier geht es insbesondere um die kognitiven Operationen, die bei der Bearbeitung sozialer Probleme durchgeführt werden.
5. eine Ebene spezieller Handlungstheorien zur Lösung praktischer Probleme
Eine detaillierte Schilderung aller Wissensebenen wäre meiner Ansicht nach zu ausführlich, auch nicht nötig. Wichtig erscheint mir folgendes: Bernasconi beginnt ihre Ausführungen auf der ersten Ebene mit der Feststellung, dass bei philosophischen Fragestellungen über Wirklichkeit und Erkenntnis sich drei Positionen konstituiert haben:
1. atomistische / individualistische Wirklichkeitsvorstellung: Grundannahme dieser Position ist die Unterstellung, „dass alles Existierende aus isolierten, unverbundenen Einheiten (Atomen) besteht“, und die Entwicklung dieser Einheiten autonom, d. h. ohne Umwelteinflüsse stattgefunden hat.
2. Holismus oder Ganzheitsphilosophie: Hinter dieser Sichtweise steht die Vermutung, dass die Wirklichkeit „aus undifferenzierten, unzerlegbaren und damit auch unanalysierbaren Ganzheiten besteht,...die selbstreferentiell existieren und sich entwickeln“. Komponenten, die sich den Ganzheiten unter- oder zuordnen, dienen allein dem Zweck der Bestandserhaltung der Ganzheiten und werden hinsichtlich ihrer dysfunktionalen Leistung für sie untersucht.
3. Systemismus: Mit dieser Position wird alles Existierende als ein System oder Interaktionsfeld betrachtet, indem sich mehrere Komponenten zusammensetzen und eine interne Struktur bilden und sich somit gegenüber der Umwelt abgrenzen und ausdifferenzieren (System-Umwelt-Differenz).
Ausgehend von diesen drei „allgemeinsten Hypothesen“ über Erkenntnis und Wirklichkeit haben sich dann im Laufe der Geschichte drei Paradigmen Sozialer Arbeit konstituiert:
1. Individuum- oder Subjektzentriertes Paradigma:
Dieses Paradigma, entstanden aus der Position des Atomismus oder Individualismus, betrachtet Menschen als „individuelle Sinn-, Freiheits- und / oder Nutzenmaximierer“ (ebd.: 169). Der Mensch wird dabei als frei handelndes, autonomes Individuum gesehen, für das die Gesellschaft lediglich ein „Ressourcenreservoir zur Selbstverwirklichungs- oder Nutzenmaximierung“ (ebd.: 174) darstellt. Theorien in der Sozialen Arbeit, die diesem Paradigma folgen, stützen ihre Erkenntnisse auf Bezugsdisziplinen, die insbesondere die biologische und psychische Ausstattung des Menschen zum Kern haben. „In der Sozialen Arbeit findet sich dieses Paradigma in den zahlreichen (tiefen-) psychologisch fundierten Ansätzen der Sozialen Arbeit, die sich mehrheitlich auf die Arbeit mit Individuen beschränken“ (ebd.: 178 ff.). In diesem Sinne können die Soziale Einzelhilfe nach Hollis und Perlman diesem Paradigma problemlos untergeordnet werden.
2. Soziozentriertes Paradigma
Das soziozentrierte Paradigma, das auf der Holismus oder Ganzheitsphilosophie aufbaut, betrachtet Menschen als „Funktionsträger“, nach der sie Schutz und Orientierung, soziale Teilhabe und positive Sanktionen insofern erhalten, „solange sie sich den Werten, Normen und Kontrollinstanzen der Ganzheit unterordnen und damit durch Erwartungsinternalisierung und Rollenübernahme funktional einordnen“ (ebd.: 170). Der Mensch nimmt in dieser „sozialen Totalität“ als eher einflussloses Mitglied der Gesellschaft keine individuelle Rolle wahr. Ausgangspunkt sind immer soziale Kollektive. Vertreter dieses Paradigmas stützen sich bei der Theoriebildung auf soziologische, sozialpsychologische oder auch ethnologische Ansätze. In der Sozialen Arbeit finden wir dieses Paradigma in Ansätzen, „in denen soziale Kontrolle und abweichendes Verhalten den Ausgangspunkt bilden“ (ebd.: 179). Der Entwurf einer Sozialen Arbeit nach Rössner lässt sich somit diesem Paradigma eindeutig zuordnen.
3. Systemisches Paradigma
Das systemische Paradigma geht davon aus, dass Individuen für ihre Bedürfnis- befriedigung „sowie als Mitglieder von Interaktionsfeldern und unterschiedlichster sozialräumlicher wie funktional differenzierter sozialer Systeme flüchtige bis stabile Austauschbeziehungen eingehen“ (ebd.: 175). Hier liegt eine äußerst komplexe Theorie vor, die sowohl individuumsbezogene als auch gesellschaftsbezogene Aspekt vereint, so dass die ihr zugrunde liegenden Bezugsdisziplinen zahlreich sind und von der Biologie, Psychologie, Soziologie, Ökonomie, Chemie bis zur Sozialpsychologie reichen. Solchen Paradigmen begegnen wir in sozialarbeiterischen Ansätzen, die sich „auf die Analyse von Kommunikationsproblemen- und Prozessen zwischen den Mitgliedern spezialisiert haben“ (ebd.: 180). An dieser Stelle kann auf den im nächsten Kapitel systemisch ausgerichteten Ansatz von Heiko Kleve hingewiesen werden.
Bernasconi orientiert sich bei einer Sozialen Arbeit als Handlungswissenschaft nun am systemischen Paradigma, das dazu imstande sei, beide Grundausrichtungen der beiden anderen Paradigmen in sich zu vereinen (vgl. ebd.).
6.4.5 Soziale Probleme als Gegenstand der Sozialen Arbeit
Bernasconi diskutiert im nächsten Schritt die von der Sozialen Arbeit als normative Handlungswissenschaft zu bearbeitenden sozialen Probleme. Dabei orientiert sie sich wieder an den drei Paradigmen, d. h. sie erörtert, inwiefern diese drei Muster oder Beispiele soziale Probleme interpretieren und welche Ursachen bezüglich ihrer Entstehung analog der Paradigmen ihr zugrunde liegen.
Sie konstatiert, dass soziale Probleme nach dem individualistischen Paradigma primär Selbstverwirklichungsprobleme sind, wonach es dem Individuum an psychischen und kognitiven Kompetenzen zur Bewältigung eines gelingenden Lebens mangelt. Beim soziozentrischen Paradigma stellen soziale Probleme dagegen in erster Linie Versagensmomente „von Sozialisation als Erlernen moralischer Normen- bzw. Pflichterfüllung gegenüber...sozialer Ganzheiten...auf die...mit Sanktionen, Ausschluss (Exklusion) oder verweigerten Einschluss (Inklusion)“ (ebd.: 182) reagiert wird. Als Vertreterin des prozessual - systemischen Paradigma beschreibt Bernasconi soziale Probleme als „...Probleme von Individuen als auch Probleme einer Sozialstruktur und Kultur in ihrer Beziehung zueinander“ (ebd.: 182). Ausgehend vom Individuum können z. B. Nöte und Leiden entstehen durch eine mangelhafte „individuelle Ausstattung“ (z. Fettleibigkeit, fehlende Bildung, keine Erwerbsarbeit). Dadurch bedingt können aber auch die Austauschbeziehungen in sozialen Interaktionsfeldern (z. B. unbefriedigende sexuell-erotische Beziehungen, kulturelle Verständigungsprobleme) beeinträchtigt sein. Diese Problematiken auf der individuellen Ebene können auch als „fehlende Machtquellen“ bezeichnet werden, so dass eine Befreiung der Betroffenen aus dieser Situation ohne Hilfe schwierig ist. Auf der Ebene sozialer Systeme können die Betroffenen „problematische Regeln der Sozial- bzw. Machtstruktur“ (ebd.: 185) ausgeliefert sein (z. B. die repressiven Sanktionsmittel, denen Hartz IV Empfänger ausgeliefert sind!). Alles in allem sollte die mit dem systemischen Paradigma verbundene komplexe Sichtweise menschlicher Probleme deutlich erkennbar sein.
6.4.6 Entstehung sozialer Probleme
Bernasconi ordnet das individualistische und soziozentristische Paradigma unter „Ein- Niveau-Theorien“ ein. Sie interpretieren und erklären soziale Probleme wenn überhaupt nur sehr einseitig und bleiben dabei meistens auf einem Wirklichkeitsniveau stehen. So wird bei der Genese sozialer Probleme im individualistischen Paradigma das Individuum selbst als Verursacher angesehen, die Erklärung einseitig über biologische oder psychoanalytische (s. Perlman/Hollis) Deutungen vollzogen. Beim Soziozentrismus wird die Entstehung der Ganzheiten (Familie, Staat, etc.) nicht erklärt, vielmehr werden sie einfach vorausgesetzt (vgl. ebd.: 187). Wie nun Individuen sozialisiertes oder dissozialisiertes Verhalten erlernen (s. Rössner) wird nicht weiter erklärt, es sei denn man ist Befürworter simplifizierter Konditionierungsvorgänge. Darüber hinaus setzt dieser Ansatz ausschließlich auf der Makroebene an, um soziale Probleme zu erklären. Beim systemischen Paradigma werden dagegen soziale Probleme sowohl vom Individuum, als auch von der Gesellschaft ausgehend erklärt. (Makroebene). Es ist ein interdisziplinärer, mehrniveaunaler Ansatz, so dass Bernasconi zu Recht konstatiert:
„Eine Erklärung sozialer Probleme auf dem Hintergrund des systemischen Paradigmas muss einerseits die Entstehung problematischer Gesellschaftsstrukturen aufgrund von Merkmalen und Interaktionsmustern von Individuen erklären (Bottom-up-Erklärungen). Anderseits muss sie den Einfluss von Merkmalen und Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaftsstruktur und- kultur von sozialen Systemen- auf die strukturelle Lage, das Wohlbefinden und Verhalten von Individuen (Top-down-Erklärungen) ermitteln“ (ebd.: 189).
6.4.7 Werte und Ethik anhand der drei Paradigmen
Das individualistisch - egozentrische Paradigma verfolgt jene Werte, die auf Freiheit und Autonomie ausgerichtet sind. Die Konzepte nach Hollis und Perlman bedienen sich diesem Postulat, indem beide Autoren explizit in den Zielformulierungen die Wiederherstellung der Selbstbestimmung betonen. Demgegenüber betont dass soziozentrische Paradigma Werte, die auf Solidarität, die gesellschaftliche Stabilität insgesamt gerichtet sind. „Primärer sozialer Wert ist die Unterordnung aller individuellen Strebungen und Fähigkeiten unter das Gemeinwohl im Dienste des Gesamtinteresses“ (ebd.: 191). Im systemischen Paradigma werden sowohl individuelle Freiheitswerte als auch Solidar- und Gerechtigkeitswerte gleichrangig und reziprok ausgelegt. Bernasconi führt in diesem Zusammenhang die UNO- Menschenrechtsdeklaration von 1948 an, die beide Wertsysteme zu vereinen versucht.
6.4.8 Die Funktionen sozialer Arbeit anhand der Paradigmen
Aus dem subjektzentrierten Paradigma ergibt sich für die Soziale Arbeit die Aufgabe, Hilfen „für das Wohlergehen, die Entwicklung und Selbstverwirklichung ihrer individuellen Adressat(in)en“ (ebd.: 197) bereitzustellen. Obwohl noch andere als Problemverursacher (Familie, Nachbarn, etc.) hinzukommen können, ist dieser Sichtweise nach der Adressat selber der Hauptverursacher. Im soziozentrierten Paradigma erfüllt Soziale Arbeit „die Funktion der „sanften“ bis repressiven sozialen Normen- und Verhaltenskontrolle sowie der Wiederherstellung von funktionsfähigen Individuen für das Familien-, Bildungs-, Wirtschafts- und Rechtssystem“ (ebd.: 197). Auch hier wird der Adressat eher als Hauptverursacher seiner prekären Situation betrachtet. Im systemischen Paradigma hat Soziale Arbeit zunächst die Funktion, „...Menschen zu befähigen, ihre Bedürfnisse so weit wie möglich aus eigener Kraft...zu befriedigen (ebd.: 198). Außerdem soll sie „behindernde Machtstrukturen in begrenzende Machtstrukturen transformieren (ebd.). Darüber hinaus bekommt die Soziale Arbeit auch eine sozialpolitische Funktion, denn sie soll „soziale Probleme für die öffentlichen Entscheidungsträger zugänglich machen und sich in den (sozial-) politischen Policybildungs- und Entscheidungsprozess über Problemlösungen einmischen“ (ebd.).
Bernasconi fügt dann noch hinzu, dass nur im systemischen Paradigma Professionalität wirklich Platz hat, aber sie ergänzt diese Feststellung mit dem Einwand, der Anspruch der Sozialen Arbeit auf eine Profession sei nur dann möglich, wenn sie ihr Doppelmandat erweitert in Richtung eines Tripelmandats (vgl. ebd.: 200). Das bedeutet konkret, dass die Janusgestalt von Hilfe für den Adressaten einerseits und die Erfüllung des staatlichen Auftrags andererseits (Doppelmandat) um folgende Perspektive ergänzt werden müsste:
1. Soziale Arbeit muss ihren Gegenstand (Soziale Probleme) auf Wissenschaftsbegründete Arbeitsweisen und Methoden ausrichten
2. Die Mitwirkenden im Sozialwesen müssen sich jederzeit auf eine ethische Basis (Berufkodex) berufen können
3. Die im Berufskodex erwähnten Menschenrechte sollten keine Leerformel sein, sondern im Gegenteil eine regulierende Funktion im Hilfeprozess einnehmen
Diese drei Kriterien sind es nun, die nach Bernasconi das dritte Mandat ausmachen. Es soll letztlich dazu dienen, dass sich die Soziale Arbeit und die darin Tätigen von Entmündigungs- und Bevormundungsprozessen befreien können und auch Anschlussstellen in öffentlichen Diskursen finden und diese mitgestalten (vgl. ebd.: 200 ff.).
6.4.9 Das W-Fragen Modell und der transformative Dreischritt als zwei Komponenten einer normativen Handlungswissenschaft
1. Das W-Fragen Modell
Handlungswissenschaften sind und müssen interdisziplinär sein, stellt Bernasconi fest (ebd. 246), denn soziale Probleme seien so vielfältig und komplex, dass die alleinige Fokussierung auf eine Disziplin zur Bearbeitung eben dieser Probleme unzureichend ist. Und sie müssen Wege zu einer Veränderung aufzeigen, d. h. „mit welchen Ressourcen und welchen Verfahren man - nicht zufällig, sondern mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit - von einem Ist-Zustand zu einem wünschbaren Soll-Zustand gelangt“ (ebd.). Analog zu dieser Zwecksetzung legt sie ein Handlungsmodell vor, das sich aus folgenden Handlungsschritten konstituiert (ebd.: 204 ff., Engelke 2003: 429 ff.):
- Was ist los?
Empirische Beschreibung des sozialen Problems (Daten / Bilder)
- Warum ist diese Problematik entstanden?
Erklärung des sozialen Problems durch wissenschaftliche Theorien
- Wohin tendiert die Situation, falls nicht interveniert wird? Die Antwort sind Trendaussagen
- Was ist (nicht) gut? Was sollte sein?
Dies unter Bezug auf die Ausgangsproblematik; zukünftig erwünschten Sachverhalte müssen ermittelt werden, was Werturteile mit einschließt.
- Wer soll was verändern, wer sind die Akteure der Veränderung?
Produkt ist die Bestimmung und mithin das Bild eines Akteursystems
- Womit, d. h. mit welchen Ressourcen soll die Veränderung erreicht werden?
Produkt ist ein Bild über die individuellen und gesellschaftlichen Ressourcen.
- Was muss auf der Grundlage der erhobenen Wissensgrundlagen entschieden werden? Produkt sind Pläne / Maßnahmen
- Wie, mit welchen speziellen Methoden und Handlungstheorien soll die Veränderung herbeigeführt werden?
Produkt sind Teilpläne, Handlungsleitlinien und Methoden.
- Wurden die Ziele erreicht? Mit welchem Aufwand? Auswertung und Erfolgskontrollen
Bernasconi sieht in diesen mentalen Operationen ein unverzichtbares Element innerhalb der Profession Soziale Arbeit, sie spricht auch von „kognitiven Schlüsselkompetenzen“.
2. Der „transformative Dreischritt“
Mit dem „transformativen Dreischritt“ beschreitet Bernasconi einen Weg, der in erster Linie das Theorie - Praxis Problem in der Sozialen Arbeit bewältigen soll. Die von einigen Wissenschaftlern immer noch vertretende Ansicht einer prinzipiellen Unvereinbarkeit zwischen Theorie und Praxis lehnt sie strikt ab, und nicht nur das, Soziale Arbeit, die für sich beansprucht eine Profession zu sein, muss sich auf wissenschaftliches Beschreibungs- und Erklärungswissen beziehen (vgl. ebd.: 207, 245). Und ähnlich wie beim W-Fragen Modell zielt dieser gedankliche Dreischritt auf eine Veränderung der sozialen Realität, indem er nach Bernasconi „die Transformation von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten (nomologischen Aussagen) über handlungsbezogene, teleonome Gesetzmäßigkeiten (nomopragmatische Aussagen) in Handlungsleitlinien und -regeln (Handlungsimperative als Aufforderungen) zu leisten vermag“ (ebd.: 207). Bernasconi erläutert diesen Dreischritt nun an einem Beispiel (Gewaltausübende Individuen), auf das ich in verkürzter Form eingehe (ebd.: 252 ff.):
Erster Schritt: Problembeschreibung und nomologische Aussagen bzw. Theorien
In diesem Schritt sollen nun unter Anwendung interdisziplinären Wissens „Erklärungen“ für die Gewaltbereitschaft geliefert werden. Setzt man hier auf der Mikroebene an, können z. B. die gewaltbereiten Jugendlichen selbst befragt werden, deren Aussagen dann wissenschaftlich verwertet werden. Subjektive Aussagen wie „Ich glaube, die meisten Lehrer haben mich aufgegeben“ könnten eine psychologische Erklärung des Verhaltens darstellen; Konkurrenz unter den Schülern eine sozialpsychologische. Analog dazu werden dann die anderen Meso- und Makrosozialen Ebenen, mit denen die Jugendlichen interagieren, untersucht (z. B. Familiensystem: restriktives Erziehungsklima entdeckt = kulturelle, soziologische Erklärung). Bernasconi weist auch hier wieder darauf hin, dass es sich nicht um vereinfachte „wenn- dann-Aussagen“ handelt, sondern um eine komplexe Verbindung der drei Ebenen (Prinzip der Mehrniveaunalität).
Zweiter Schritt: Formulierung nomopragmatischer Hypothesen
Dieser Schritt baut unmittelbar auf den ersten auf, es handelt sich auch um nomologische Aussagen, bei denen aber nun „ein handelndes Subjekt zur (zusätzlichen) Einflussgröße wird“ (ebd.: 255). So kann bezogen auf das Beispiel für den Bereich Familie folgende nomopragmatische Hypothese formuliert werden: „Wenn „man“ versucht, die Umgangsregeln in repressiven, bedürfnisfrustrierenden Familien zu verändern, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die dadurch verursachte Aggression abnimmt und sich nicht auf die Schulsituation auswirkt“. Das „man“ soll verdeutlichen, dass noch offen bleibt, welche Akteure für die Bewältigung des sozialen Problems hinzugezogen werden.
Dritter Schritt: Formulierung von wissenschaftlich begründeten Handlungsleitlinien
Hier geht es um die Frage „Wer soll was womit (Ressourcen) und wie (Verfahren/Methoden oder Arbeitsweisen) tun oder verhindern, um in unserem Fall ein bestimmtes, tieferes Gewaltniveau herbeizuführen oder Gewalt zu verhindern?“ (ebd.: 258) Durch die Beantwortung der Frage sollen schließlich Handlungsleitlinien entwickelt werden, die es dann umzusetzen gilt. Eine mögliche Handlungsleitlinie kann z. B. lauten (auf der Mikroebene): „Um die Abnahme des Gewaltverhaltens eines Jugendlichen (B) zu bewirken, ermutige ihn, über seine wahrgenommene und reale Außenseiterposition zu sprechen (A1) und mache jedes Gewaltereignis zum Thema (A2)!
Bei der Kenntnisnahme dieses Modells kamen mir bezüglich seiner Wirksamkeit zunächst erhebliche Zweifel, erinnert es doch sehr an die vereinfachten, sehr technisch anmutenden Ausführungen Rössners. Aber Bernasconi kennt natürlich diese Einwände und will dieses Modell erst gar nicht als ein „unfehlbares Rezept“ bewerten, betrachtet es eher als ein äußerst schöpferischen Vorgang, der nicht linear gedacht werden kann. Es ist vielmehr eine „Transformationskompetenz“ der Sozial-Tätigen, ein Versuch, das Theorie - Praxis Problem zu bewältigen und sich von entmündigenden, fremdbestimmten „Ober- oder Metainterpreten“ zu entfesseln (vgl. ebd.: 261 ff.).
6.4.10 Soziale Arbeit auf dem Weg zur Weltgesellschaft
Ausgangspunkt von Bernasconis Überlegungen ist die These, dass Soziale Arbeit und ihre zu bearbeitenden sozialen Problemlagen immer auch „unter dem Gesichtspunkt ihrer globalen Bedingtheit und als Produkt des Transfers von Spannungen zwischen sozialen Ebenen und Systemen aufgefasst werden“ (ebd.: 420). Den Begriff der Globalisierung will sie aber durch den der Weltgesellschaft ersetzt wissen, da ersterer häufig nur ökonomische Dimensionen mit einschließt, letzterer dagegen umfassender verstanden wird, d. h. mehrere Teilsysteme mit berücksichtigt (vgl. ebd.: 419 ff). Anhand von Jane Addams zeigte sie u. a. sehr eindrucksvoll, dass Soziale Arbeit seit den Anfängen ihrer Professionalisierung auch international ausgerichtet war. Ein älteres, 1930 von Alice Salomon stammendes Zitat, hat auch heute noch nichts von seiner Aktualität eingebüßt:
„Es gibt im Kulturkreis der heutigen Menschheit kein Land mehr, das sich selbst genügt und ohne Beziehungen zu anderen bestehen kann. Die Länder sind voneinander abhängig, in wirtschaftlicher, sozialer, geistig-sittlicher Beziehung...(Die Menschen) können gegeneinander kämpfen oder gemeinsam Armut, Unwissenheit, Krankheit und Tod bekämpfen. (...) Denn die Ursachen der Not liegen oft außerhalb der Grenzen und Länder, in denen sie auftreten, wie auch die Wirkung der Not über die Landesgrenzen hinausreicht. Deshalb hat jedes Land ein Interesse daran, dass auch die anderen Länder ein geordnetes Fürsorgewesen entwickeln und deshalb sind gemeinsame internationale Maßnahmen zur Bekämpfung von Notständen unentbehrlich“ (Salomon 1930: 532, in: Kuhlmann 2000: 322, zit. nach Bernasconi, 424).
Dieses Zitat belegt nun eindeutig, dass die Notwendigkeit einer internationalen Sozialen Arbeit, die soziale Probleme nicht nur lokal behandelt, sondern auch über den Tellerrand rausschaut, schon sehr früh erkannt wurde. Und so führt Bernasconi zahlreiche Organisationen wie z. B. die „International Federation of Social Workers“ (seit 1928) oder die „Inter-University Consortium for International Social Development“ (ab 1980) an, deren gemeinsamer Nenner in den Bestrebungen der „Überwindung der Dichotomie zwischen Global und Lokal“ (ebd.: 431) begründet liegt. In einem eigenen Kapitel (ebd.: 431 ff.) zeigt Bernasconi auf, inwieweit die sozialarbeiterischen Methoden und die ihr zugrunde liegenden Paradigmen im Hinblick auf diese Überwindung geradezu kontraproduktiv war. So behinderte der in den 60er - 70er Jahren beginnende Therapieboom in der Sozialen Arbeit diese von ihr geforderte Weitsicht, denn der sozialarbeiterische Blick war nun sehr auf die soziale Mikroebene von Individuen gelenkt (vgl. ebd.). Dieser Sachverhalt setzt sich nun ihrer Ansicht nach bis heute fort, d. h. auch die Modernisierung des Sozialstaats und der damit verbundene Einsatz von betriebswirtschaftlichen Konzepten im Sozialwesen versperre diese Weitsicht. Die Sicht reiche von der Mikroebene, manifest in Form der Kategorie der „personenbezogenen Dienstleistung“, bis zur Mesoebene (Wettbewerb unter den Trägern), so dass sie letztlich zu der Feststellung kommt: „Die Behandlung globaler Aspekte Sozialer Arbeit findet zur Zeit fast ausschließlich an internationalen Konferenzen statt...“ (ebd.: 434). Abschließend bleibt hier festzuhalten, dass Bernasconi eine Soziale Arbeit mit einem weltgesellschaftsbezogenen Wahrnehmungshorizont einklagt. Dabei muss an der lokalen Ebene angesetzt werden, indem z. B. aktuelle gesellschaftliche, internationale Themen wie die Migrationspolitik an Fachhochschulen thematisiert, mehr noch: als Pflichtfach eingeführt werden!
6.4.11 Bewertung und Einschätzun
Die Ausführungen zu Bernasconis konzipierter Sozialen Arbeit sind in dieser Arbeit am ausführlichsten, meine Bewertung und Einschätzung wird im Vergleich dazu recht knapp ausfallen. Das liegt daran, dass es ihr gelungen ist, Soziale Arbeit sowohl als Wissenschaft, als auch als Praxis umfassend zu reflektieren.
Wenn Engelke feststellt, ihre prozessual-systemische Theorie wird zunehmend in wissenschaftlichen Aufsätzen rezitiert und auch in der Praxis wird bei der Bearbeitung konkreter Problemlagen auf ihre Theorie zurückgegriffen, so kann dies als Indiz einer generellen Wertschätzung und Beachtung ihres Werkes gelten (vgl. Engelke 1999: 376 ff.).
Da Bernasconi sich an einem prozessual-systemischen Paradigma orientiert, ist die Option für eine Integration unterschiedlicher Wissensgebiete jederzeit offen. Von daher können auch Erkenntnisse der Persönlichkeitspsychologie herangezogen werden, um einer defizitären Bedürfniserfüllung der Klienten entgegenzusteuern und somit auch soziale Probleme zu bearbeiten. Im Folgenden möchte ich abschließend anhand von drei Beispielen aufzeigen, inwiefern es mögliche Berührungspunkte zu den Persönlichkeitstheorien gibt:
Adlers utopisches Ideal war eine friedvolle Weltgesellschaft, in der jeder mit jedem kooperiert. Werte und Ziele wie Nächstenliebe, Kooperation und menschliche sowie gesellschaftliche Teilnahme stehen in seinen Werken im Vordergrund. Bernasconis anzustrebende Werte und Ziele in der Sozialen Arbeit ergeben sich vor dem Hintergrund diverser Problemkategorien (vgl. Engelke 1999: 374). Gerade die Problemkategorie „Austauschprobleme“ enthält nun genau jene Werte, die Adler einklagt. Obwohl sie die naive Sichtweise von Adler nicht teilen würde, fragt sie dennoch danach, ob die sozialen Netzwerke der Menschen so beschaffen sind, dass sie Werte wie Nächstenliebe, Kooperation und Teilnahme zulassen. Wenn dies nicht der Fall wäre, so hätte der Sozialarbeiter die Aufgabe, Machtstrukturen zu begrenzen und zu schmälern. In diesem Punkt zeigen sich Gemeinsamkeiten.
Frankl betonte in seinen Werken die geistige Dimension des Menschen. Da der Mensch im prozessual-systemischen Paradigma in all seinen Dimensionen erfasst wird, kann es auch die geistige Dimension mit einbeziehen und die Sinnfrage in den Blick nehmen. Die alleinige Fokussierung auf die geistige Dimension käme für Bernasconi nicht in Frage, da sie sich sonst an „Ein-Niveau-Theorien“ orientieren würde. Bandura und Mischel, stellvertretend für die sozial-kognitive Theorie, sind bei der Erforschung der menschlichen Natur interdisziplinär ausgerichtet (vgl. Pervine/Cervone/John 2005: 516).
Indem sie dabei Wissensbestände aus unterschiedlichen Gebieten der Psychologie und Disziplinen darüber hinaus heranziehen, kann ihr Ansatz entsprechend der Terminologie von Bernasconi als „mehrniveaunal“ bezeichnet werden. Mit anderen Worten wird die sozial-kognitive Theorie dem prozessual- systemischen Paradigma am ehesten gerecht.
6.5 Heiko Kleve: Postmoderne Sozialarbeit
6.5.1 Ausgangspunkt
Heiko Kleve bewertet Soziale Arbeit vor dem Hintergrund systemtheoretischer (insbesondere Luhmann) und postmoderner Überlegungen (Lyotard) als postmoderne Profession (Praxis) und Disziplin (Theorie). Seine These lautet, dass die Verwissenschaftlichung und Professionalisierung der Sozialen Arbeit durch systemtheoretisch-konstruktivistische Ansätze vorangetrieben werden kann (Kleve 2003), da systemtheoretische Begriffe wie Autopoiesis, Selbstreferenz und Kontingenz für die sozialarbeiterische Praxis äußerst fruchtbar seien. Nach Kleve darf und kann sich die Soziale Arbeit nicht mehr länger an überkommene Orientierungen und Paradigmen wie der Differenz von Norm und Abweichung festhalten, da sie Stigmatisierungen und Problemkarrieren fördern würden. Daher sind systemtheoretisch-konstruktivistisch orientierte Ansätze eher dazu geeignet, um der „Pluralisierung und Differenz von Lebenswelten sowie sozialer Wirklichkeitskonstruktionen im praktischen Handeln“ (ebd.: 32) gerecht zu werden, eine, wie Kleve betont, postmoderne Haltung im philosophischen Sinne.
Exkurs: Systemtheorien
Der Begriff „System“ ist bereits älteren Datums und wurde bereits in der Antike verwendet. In semantisch, etymologischer Hinsicht geht der Begriff ursprünglich auf das griechische Wort „systema“ (aus Teilen zusammengesetztes) zurück. In der Antike steht er „für ein gegliedertes, geordnetes Ganzes, zum Beispiel für den Kosmos, aber auch für organische, soziale und intellektuelle Gebilde“ (Engelke 2003: 397).
Der gegenwärtige Begriff „Systemtheorie“ ist durch semantische Uneindeutigkeit geprägt. Er kann auch als ein Konglomerat divergierender Konzeptionen in Zielsetzung, Reichweite, etc. verstanden werden (vgl. ebd.: 397), wobei der gemeinsame Nenner darin besteht, dass unterschiedliche Bereiche als System definiert werden können und mit der Außenwelt in spezifischer Weise gekoppelt sind. Die Soziologen Talcott Parsons (1902 - 1979) und Niklas Luhmann haben u. a. systemtheoretisches Denken in der Soziologie etabliert.
Um die Mitte des 20. Jahrhunderts kam man zu der Erkenntnis, dass Systemtheorie und Soziale Arbeit wechselseitig aufeinander bezogen werden können, denn „...social workers possess an in-depth understanding of the relationship of the individual to various environments and the synergistic relationship that each entity has to the other. It is this contextual understanding of the holistic nature of human functioning that is unique to social work practice as opposed to most other helping professions, which tend to adopt a more individual-centered perspective to treatment. Social workers are taught to recognize that all parts of any system are interrelated, interconnected, and interdependent and therefore it is imperative to take into account the influence of various systems and subsystems on client functioning” (Andrae 1996: 601, zit. in: ebd.: 398 ff.).
Heiko Kleve favorisiert nun für die Praxis und Theorie der Sozialen Arbeit einen systemtheoretisch-konstruktivistischen Ansatz, der sich im Wesentlichen aus systemtheoretischen Überlegungen Luhmannscher Prägung gepaart mit anderen „systemtheoretischen Spielarten des Konstruktivismus“ (Kleve 2003: 37) konstituiert. Hier greift er nun auf die Kommunikationstheorie Paul Watzlawicks (1969), sowie auf die Kybernetik zweiter Ordnung von Heinz von Foerster (1993), die Kognitionstheorie von Humberto Maturana und Francisco Valera (1984) als auch die Differenztheorie von Georg Spencer-Brown / Gregory Bateson (1979) zurück (s. Kleve 2003: 37-41, 1996: 39 ff.). Im Folgenden erläutere ich kurz die einzelnen Theoriefragmente, da sie für das konzeptionelle Verständnis Kleves sozialarbeiterischen Ansatzes insgesamt von Bedeutung sind.
1. Pragmatische Kommunikationstheorie
Der Kommunikationstheoretiker Paul Watzlawick vertritt die These, „dass die sogenannte Wirklichkeit das Ergebnis von Kommunikation ist“ (Watzlawick 1976: 7, zit. in: Kleve 2003: 37). Er führte auch den konstruktivistischen Begriff des Umdeutens (Refraiming) in Therapie und Beratung ein, wonach ein bestimmtes Phänomen, ein Problem oder auch Sinnzusammenhang immer in einem anderen Licht erscheint, wenn die Perspektive verändert, d. h umgedeutet wird. Ein Witz aus dem Ha-Handbuch der Psychotherapie (Trenkle 1994: 130, in: ebd.: 201) veranschaulicht das Refraiming: „Ein heruntergekommener und hungriger Bettler klingelt an einem Haus, und eine alte Frau schaut daraufhin oben zum Fenster hinaus. „Gute alte Frau“, jammert der Bettler nach oben, „drei Tage habe ich schon nichts mehr gegessen.“ Die Oma antwortet ihm: „Musst Dich halt zwingen`“.
Der Bettler wird von der alten Frau nicht als armer Mann wahrgenommen, der aus finanziellen Gründen nichts zum Essen hat, sondern als Kranker, der nichts essen kann. Kleve zufolge hat sie „eine ausgeblendete Bedeutung eingeblendet und damit einen neuen Kontext für nachfolgende Unterscheidungen generiert“ (ebd.: 202)
2. Kybernetik zweiter Ordnung
Die Kybernetik erster Ordnung versteht sich als Steuerungstechnik, „die sich mit der Betrachtung von Rückkoppelungsprozessen beschäftigt, welche sie objektiv beschreiben will“ (ebd.: 37 ff.). Die Kybernetik zweiter Ordnung geht dagegen vom Beobachtenden selbst aus, der die Wirklichkeit subjektiv wahrnimmt und seine eigenen Handlungen eigenständig, reflexiv nachvollzieht.
3. Kognitionstheorie
Maturana / Valera (Neurobiologen des 20. Jh.) betrachten das Nervensystem als „ein geschlossenes System, das keinen unmittelbaren (direkten) Kontakt zu seiner Umwelt hat, sondern ausschließlich auf seine eigenen Zustände Bezug nehmen kann, also selbstbezüglich operiert“ (ebd.: 38). Ein zentraler Begriff ihrer Theorie ist der der Autopoiesis, wonach das Nervensystem ein autopoietisches System darstellt, dass „informell geschlossen, aber energetisch und materiell ihrer Umwelt gegenüber offen ist“ (ebd.).
Folgt man ihren Annahmen, so kann die Umwelt das Nervensystem lediglich verstören (perturbieren), wobei alle notwendigen Informationen für eine Orientierung in der Umwelt selbst konstruiert werden.
4. Differenztheorie
Nach der Differenztheorie von Brown / Bateson nimmt das Individuum nicht einfach passiv Informationen aus der Umwelt auf, sondern konstruiert seine Wirklichkeit, indem es unterscheidet. Dabei generiert das Setzen von Unterscheidungen „eine Zwei- Seiten-Form (System / Umwelt, Subjekt / Objekt), die notwendig ist, damit systemintern überhaupt etwas beobachtet (erkannt) werden kann...“ (ebd.: 39).
5. Soziologische Systemtheorie
Kleve betont nun, dass es Niklas Luhmann gelungen ist, die unterschiedlichen theoretischen Strömungen in eine einheitliche Theorie integriert zu haben. Er setzt sich für die soziologische Systemtheorie ein, wenn er behauptet: „Für die Soziale Arbeit erscheint mir die konstruktivistische Systemtheorie Luhmanns vor allem deshalb am brauchbarsten, weil sie die „Ganzheitlichkeit“ und Transdisziplinarität sozialen Handelns am ehesten erfasst“ (ebd.: 39).
Aus den knapp umrissenen Ausführungen leitet Kleve nun bestimmte Konsequenzen für die Praxis der Sozialen Arbeit ab (ebd.: 41 ff.):
1. Erkenntnisse über Klienten können nicht objektiviert werden, da Wirklichkeit ein Konstrukt ist. Somit müssen Problemdefinitionen gemeinsam mit den Klienten konstruiert werden (z. B. Hilfeplangespräch nach § 36 SGB VIII). 2. Die Wirklichkeiten von Helfern und Klienten unterscheiden sich, müssen ausgehandelt, „konkretisiert und kontextualisiert werden“. 3. Sozialarbeiterische Interventionen stoßen aufgrund der „Selbstreferenz“ der biologischen, psychischen und sozialen Phänomene an ihre Grenzen. Der Klient kann nicht direkt beeinflusst werden.
Bisher wurden Kleves systemtheoretische Überlegungen kurz skizziert. Nun werde ich erläutern, inwiefern Kleve die systemtheoretischen Ausführungen um postmoderne Überlegungen ergänzt bzw. erweitert und ausgehend von beiden „Theoriebausteinen“ den Entwurf einer postmodernen Sozialarbeit vorlegt.
6.5.2 Die philosophischen Überlegungen Jean Francois Lyotards (1924 - 1998)
Kleve bezieht sich bei seinem Entwurf insbesondere auf die philosophischen Überlegungen Lyotards (Kleve 2003: 63 ff.), die u. a. in „Das postmoderne Wissen“ (Lyotard 1979) und „Der Widerstreit“ (Lyotard 1983) zum Ausdruck kommen. Die Postmoderne ist in semantischer Hinsicht mehrdeutig, sie kann sowohl als „Philosophie, Geistes- und Sozialwissenschaft oder als kultureller Ausdruck und künstlerische Haltung“ (ebd.: 63) betrachtet werden. In seinem 1979 erschienen Buch „Das postmoderne Wissen“ (Lyotard 1979) führt Lyotard seine „zentrale These vom Ende der großen Meta-Erzählungen der Moderne“ (Dialektik des Geistes, Hermeneutik des Sinns, Emanzipation des vernünftigen und arbeitenden Subjekts) ein. Diese drei Metaerzählungen haben eine Gemeinsamkeit; sie streben nach absoluten Wahrheiten, nach objektiven Zielen und Erkenntnissen, die nach Lyotard in einer postmodernen Gesellschaft aber verloren gegangen sind. So macht er mit der Hermeneutik des Sinns z.
B. darauf aufmerksam, dass historisch gesehen Hermeneutiker der Theologie oder der Philosophie immer wieder versuchten, aus Texten eine abschließbare, endgültige Botschaft zu entnehmen. Für Lyotard eine nicht zu bewerkstelligende Aufgabe, da jedes Sinnverstehen ex post immer wieder neu interpretiert werden kann. Die postmodernen Überlegungen als „Gemüts- und Geisteszustand“ (Lyotard 1981: 97, in: ebd.) fasst Kleve folgendermaßen zusammen: Sie stehen „erstens für die Erfahrung und Anerkennung der Konstrukthaftigkeit der Wirklichkeit, zweitens für die Erfahrung und Anerkennung von unüberwindlichen Differenzen in der Welt des Persönlichen und Sozialen und drittens für den experimentellen Umgang mit den Wirklichkeitskonstruktionen und Differenzen innerhalb unserer Wirklichkeiten“ (ebd.: 69).
Kleve behauptet nun, dass diese drei Elemente auch für die Soziale Arbeit konstitutiv sind, gerade in lebensweltorientierten und systemisch-konstruktivistisch orientierten Ansätzen tauchen diese Bestimmungsmerkmale seiner Ansicht nach auf (vgl. ebd.: 69). Genau wie die Postmoderne zeichnet sich die Soziale Arbeit durch Aushandlungsprozesse, ergo durch den Dialog aus, die in den Bestimmungsmerkmalen als Folgerung zur Sprache kommen und die die Pluralität, Vielfalt und Ambivalenz zu akzeptieren haben, was sowohl für die Praxis als auch die Theorie gelte.
6.5.3 Auffassung von Sozialen Arbeit und deren Wissenschaft
Ausgehend von Kleves Tätigkeit als sozialpsychiatrischer Einzelfallhelfer, in der er um die Wiedereingliederung „psychisch kranker Menschen“ bemüht war, versucht er den eigentlichen Kern Sozialer Arbeit zu beschreiben (Kleve 2003: 90 ff.). Kleve erwähnt das Helfer-Modell von Kurt Ludewig (Ludewig 1993: 123), der helfende Tätigkeiten in den Dimensionen Anleitung, Beratung, Begleitung und Therapie aufteilte. Dabei umfasste seine Tätigkeit alle diese Elemente und ging über diese Bereiche sogar noch hinaus. Kleve führt in diesem Zusammenhang das Konzept des „doppelten Generalismus“ ein, nach der Soziale Arbeit sowohl als „spezialisiert generalistisch“ als auch „universell generalistisch“ betrachtet wird. Unter einem „spezialisierten Generalismus“ versteht er dabei folgendes: Die Soziale Arbeit setzt ausgehend von den drei Methodenklassikern Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit auf jeweils unterschiedlichen Ebenen an, der Ebene des Individuums, der der Gruppe oder aber auf der sozialstrukturellen Ebene (von daher spezialisiert). Auf allen drei Ebenen kommt aber eine ganzheitliche Sichtweise zum Tragen, in der die Sozialarbeiter sowohl die biologischen, psychischen und sozialen Bedürfnisse und Probleme der Klienten bearbeiten. „Der universelle Generalismus bezieht sich auf die Heterogenität des sozialarbeiterischen Gesellschaftsbezugs, auf die Vielfalt der Aufgaben des gesellschaftlichen Funktions- und Berufssystems Soziale Arbeit“ (Kleve 2003: 96). Demnach vollzieht sich Soziale Arbeit in vielfältigen Arbeitsfeldern (Suchthilfe, Sozialhilfe, Behindertenhilfe, etc.), in denen prinzipiell alle Bevölkerungsgruppen sowohl präventiv, interventiv und postventiv erfasst werden. Kleve folgert nun aus diesem der Sozialen Arbeit anhaftenden „doppelten Generalismus“, dass sowohl die
Praxis als auch die Theorie ihre Bemühungen um eine eindeutige Identität aufgeben müssten, stattdessen fordert er, diese „Vielfältigkeit und Diffusität“ als „funktionale Normalität“ (ebd.: 124) zu bewerten: „In der Schwäche, sich als Sozialarbeiter nicht klar identifizieren zu können, liegt die Stärke, die eigentliche Professionalität sozialarbeiterischer Praxis“ (ebd.: 124 ff.). Er postuliert in diesem Sinne einen postmodernen Umgang in der praxisbezogenen Tätigkeit. Für die Wissenschaft ergibt sich dadurch eine inter und transdisziplinäre Ausrichtung, d. h. Soziale Arbeit muss sich Kenntnisse aus den Bezugswissenschaften (Psychologie, Pädagogik, Soziologie, etc.) aneignen und aus den „unterschiedlichen Human- und Sozialwissenschaften Wissen integrieren“ (ebd.: 112).
6.5.4 Konsequenzen und Anwendungen in der Praxis: Mediation und Casemanagement
1. Mediation
Bei der Mediation handelt es sich um ein außergerichtliches Verfahren zur Konflikt- Vermittlung mehrerer Parteien, bei der u. a. Konflikte infolge einer Trennung oder Scheidung oder auch Teamkonflikte bearbeitet werden. Kleve ordnet dieses Verfahren nun entsprechend seinen von mir vorab erarbeiteten Auffassungen ein und konstatiert, dass es sowohl generalistische, lebensweltliche und systemische Elemente enthält (vgl. Kleve 2003: 172 ff.). Als generalistisch bewertet er es, da sowohl sachbezogene als auch psycho-soziale Dimensionen fokussiert werden. Das Paradigma der Lebenswelt kommt dort zum Ausdruck, wo es um die Heranführung der Lebenswelten der Konfliktparteien geht. Dies soll erreicht werden, indem in der Mediation „verständigungs- beziehungsweise aushandlungsorientiert, kurz: dialogisch kommuniziert wird“ (ebd.: 176). Die systemisch-konstruktivistische Ausrichtung zeigt sich gerade in den Interaktionen zwischen Klient(en) und Mediator, in der vor allem die Axiome von Watzlawick zur Geltung kommen und somit auch eine „Vielfalt von möglichen Wirklichkeitssichten“ (ebd.: 180) postuliert wird. Der Sozialarbeiter, der in der Rolle des Mediators fungiert, hat demnach eine allparteiliche Haltung einzunehmen, innerhalb der er in allen Phasen der Mediation primär den Prozess strukturiert. Er soll lediglich den Konfliktparteien dabei helfen und unterstützen, „angemessene Werte und Normen für ein gelingendes Leben eigenverantwortlich zu konstruieren“ (ebd.: 191).
2. Casemanagement
Casemanagement, eine in den 70er Jahren in den USA auf die Soziale Einzelhilfe (Social Case Work) aufbauende Methode versucht, „informelle (nicht-professionelle, lebensweltliche) und formelle (professionelle) Hilfen so effektiv und effizient wie möglich zu verkoppeln“ (Kleve 2006: 46). In dieser Definition kommen nun nach Kleve zwei für die Soziale Arbeit sehr angesagte Orientierungen zum Vorschein, nämlich die Lebensweltorientierung und die Ökonomisierung. Gerade die mit der Ökonomisierung transportierten Begriffe der Effektivität und Effizienz in Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit hält er für problematisch (Kleve 2006: 42 ff., 2003: 51 ff., 1996: 64 ff.). Effizienz umfasst eine Zeitdimension, wonach Soziale Arbeit bei möglichst wenig Aufwand einen maximalen Nutzen erreichen soll, der Begriff der Effektivität zielt auf eine outputorientierte Steuerung ab, nach der die Soziale Arbeit sich „an konkreten Zielvereinbarungen ausrichtet, mit denen dann die tatsächlich erreichten Ergebnisse verglichen werden können“ (Kleve 2006: 41). Seine Kritik läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass jede sozialarbeiterische Handlung nur begrenzt steuer- und kontrollierbar ist, wofür er insbesondere zwei Argumentationen anführt:
1. Die dienstleistungstheoretische Argumentation, wonach der Klient als „Koproduzent“ fungiert and aktiv am Prozess der Leistungserstellung beteiligt ist. Anders ausgedrückt ist somit das Ergebnis jeder sozialarbeiterischen Handlung immer auch abhängig von der Mitwirkungsbereitschaft der Klienten.
2. Die systemtheoretisch-konstruktivistische Argumentation, wonach „biologische, psychische und soziale Systeme, kurz: autopoietische Systeme, interagieren, die niemals direkt beeinflusst, sondern immer nur zur Selbstveränderung angeregt werden können“ (Kleve 2006: 43).
Trotz dieser Kritik erlaubt nach Kleve das Casemanagement eine verträgliche, beiderseitige Ausrichtung der beiden Orientierungen. Aufgabe des Case Managers ist es, in einem dialogischen Verfahren mit den Klienten und unter Einbeziehung Externer (Psychologen, Ärzte, etc.) „die jeweiligen persönlichen Ressourcen und die lebensweltlichen Netzwerke zu erschließen, zu aktivieren sowie langfristig und stabil nutzbar zu machen“ (ebd.: 46). Nach Kleve setzt es direkt am Prinzip der Subsidiarität an, insofern, als professionelle Hilfen erst dann zur Anwendung kommen, wenn lebensweltliche Unterstützungen nicht mehr möglich sind. Die positiven ökonomischen Effekte deutet er so (ebd.: 55 ff.):
1) Der Case Manager stimmt seine Interventionen direkt auf die lebensweltliche Situation des Klienten ab.
2) Persönliche und lebensweltliche Selbsthilfepotenziale werden gezielt aktiviert.
3) Im Unterschied zur Sozialen Einzelhilfe ist die Beziehung zu den Klienten weniger intensiv. Klientenkontakte werden zeitlich beschränkt, die formellen und informellen Netzwerke werden eher koordiniert und moderiert, wodurch eine potentielle Abhängigkeit zum Case Manager verringert wird.
6.5.5 Bewertung und Einschätzung
Soziale Arbeit als postmoderne Disziplin und Profession gekoppelt mit systemtheoretisch-konstruktivistischen Überzeugungen liefert Kleve den Beweis dafür, dass Soziale Arbeit keine eindeutige Identität haben kann. Somit sind Wissensbestände aus unterschiedlichen Human- und Sozialwissenschaften potentiell auf greifbar, folglich kann Soziale Arbeit (muss aber nicht) auch Erkenntnisse aus der Psychologie heranziehen. Die von mir erarbeiteten Persönlichkeitstheorien können dann der Sozialen Arbeit dazu verhelfen, soziale Probleme zu bewältigen und den Inklusionsauftrag zu erfüllen, indem Entwicklungsverzögerungen und Beeinträchtigungen erkannt werden, immer vor dem gedanklichen Hintergrund, „dass diesbezüglich Vorhandenes als kontingent, als auch anders möglich betrachtet und Verschiedenes als vergleichbar wird“ (Kleve 2003: 116). Als Kritikpunkt möchte ich hier anführen, dass Kleves Sichtweise von Sozialarbeit bzw. Sozialarbeitswissenschaft der Anerkennung einer eigenständigen Profession und Disziplin sicherlich nicht förderlich ist. Den Vorwurf der Förderung eines Beliebigkeitsdenkens, wonach Soziale Arbeit in unschöpferischer Art und Weise auf fremde Theorien zurückgreift, ein Eklektizismus, wenn man so will, muss er sich gefallen lassen. Engelke weist auf die Gefahr hin, dass der radikal- konstruktivistische Ansatz dazu tendiert, Individuen in ihrer Menschenwürde zu verletzen. Am Beispiel einer vergewaltigten Frau verdeutlicht er dies. Dem zufolge entspricht die Vergewaltigung einer Wirklichkeit, die die Frau „nur“ konstruiert habe und der Sozialarbeiter mit ihr lediglich nur eine neue Wirklichkeit zu konstruieren braucht, um ihr zu helfen. Umgekehrt bestünde die Gefahr, dass Sozialarbeiter für ein bestimmtes Klientel ein Toleranzbewusstsein entwickeln (z. B. bei Pädophilen), das nicht angebracht ist. Zudem macht Engelke auf das widersprüchliche Moment im konstruktivistischen Ansatz aufmerksam. „Wenn man nichts über die Welt sagen könne, dann kann man auch nicht sagen, dass sie ein autopoietisches System sei“ (Engelke 2003: 396, 476). Für Engelke hat der Ansatz nichts mit Wissenschaftlichkeit zu tun: „Vorhandene Realitäten verschwinden zu lassen und neue hervorzaubern (das Kaninchen wird in eine weiße Taube verzaubert) ist die Kunst der Magier und gehört ins Variete`, aber nicht in die Wissenschaft“ (ebd.).
Obschon die negativen Kritikpunkte reichlich sind, muss man Kleve eines in Rechnung stellen:
Sein Entwurf untermauert, dass sozialpädagogische Interventionen immer an ihre Grenzen stoßen (Technologiedefizit). Am Osnabrücker Fall wird dies deutlich (Kleve 2003: 56 ff.). Eine Sozialarbeiterin vom ASD betreute eine allein erziehende Mutter, deren sechs Monate altes Kind trotz fachlich korrekter Arbeit an Unterernährung verstarb.
6.6 Lutz Rössner: Ein kritisch-rationalistisches Modell
6.6.1 Ausgangspunkt
Rössner beginnt seine Ausführungen in den siebziger Jahren mit einer generellen Kritik an die Pädagogik, indem er ihren Wissenschaftscharakter anzweifelt, insofern, als wissenschaftliche Aussagen nicht präzise zwischen Tatsachenerkenntnissen und Werten bzw. Normenvorstellungen trennen. Da er Sozialpädagogik und Sozialarbeit als Teil- Theorien der Pädagogik, folglich auch den Entwurf einer Sozialarbeitswissenschaft als „partielle Erziehungswissenschaft“ betrachtet (Rössner 1973: 18, 1977: 12), gelten die folgenden Aussagen immer auch für die Sozialarbeit bzw. Sozialpädagogik. Seine generelle Kritik an allen vorliegenden Theorien der Sozialpädagogik bzw. Sozialarbeit formuliert er so: „Wir gehen von der Tatsache aus, dass uns bisher keine hinreichend umfassende wissenschaftliche Theorie der Sozialarbeit, beziehungsweise eine „Sozialarbeitswissenschaft“ vorliegt“ (Rössner 1973: 15). Diese Feststellung versuchte er nun durch vier angeführte Kritikpunkte zu untermauern, indem bei vorhandenen Theorien der Sozialarbeit auf eine zureichende methodologische Basis, die sorgfältige Trennung von Tatsachenerkenntnissen und Wert- bzw. Normenvorstellungen und konsistente Begriffe und präzise Begriffssysteme verzichtet wird. Somit berücksichtigt sein Entwurf einer „Sozialarbeitswissenschaft“ die genanten Kritikpunkte, da er für sich beansprucht, eine gute methodologische Basis zu schaffen, die Begriffe eindeutig festzulegen, ein logisches Begriffssystem aufzubauen und werturteilsfrei „den Realitätsausschnitt, auf den sich Sozialarbeit bezieht, zu ordnen, begreifbar, ja, wenn man will, beobachtbar bzw. erfahrbar zu machen“ (ebd.: 55).
6.6.2 Wissenschaftsverständnis
Die wissenschaftstheoretische Basis für seine Theorie stellt der von K. R. Popper, H. Albert und E. Topitsch vertretende „Kritische Rationalismus“ dar. Rössner ist der Auffassung, „dass allein die methodologische Basis des Kritischen Rationalismus es ermöglicht, uns zu brauchbaren wissenschaftlichen Theorien auch für den Bereich der Sozialarbeit zu verhelfen, dass von dieser Basis aus die Probleme der Erziehung in unserer Gesellschaft bewältigt werden können“ (ebd.: 20). Obwohl der „Kritische Rationalismus“ Werturteile (normative bzw. präskriptive Aussagen) möglichst vermeidet, erwähnt Rössner explizit, dass seine Wahl und Anlehnung an den „Kritischen Rationalismus“ eine normative und damit auch subjektive Entscheidung darstellt, die nicht wissenschaftlich begründet werden kann, somit „auf ein irrationales Moment zurückgeht“ (ebd.: 21). Somit ist Theorie und Wissenschaft für Rössner niemals völlig wertfrei, da jede Entscheidung für eine Theorie immer auch mit subjektiven Idealen, Wert- und Normenvorstellungen einhergeht (vgl. Rössner 1973, 22 ff., 1977: 25 ff.).
Abgesehen von dieser Einschränkung hält Rössner bei seinem Entwurf einer Sozialarbeitswissenschaft unbeirrt an den Forderungen des „kritischen Rationalismus fest, so dass auch sie und deren wissenschaftliche Sätze und Aussagensysteme objektiv, d. h. intersubjektiv überprüfbar und wertneutral sein müssen. Konsequent und logisch zugleich erscheinen damit auch zwei Attribute, so dass die Rede von einer „empirischen Erziehungswissenschaft (bzw. Sozialarbeitswissenschaft) positivistischen Stils“ ist. Die Sozialarbeitswissenschaft stellt nach Rössner eine technologische Disziplin dar. Sie „informiert nur über die Mittel und Wege zu bestimmten Zielen, sie legt aber weder die Ziele selbst noch etwa die Anwendung oder Vermeidung gewisser Mittel nahe“ (Rössner 1973: 40). Von daher haben Rössner zufolge wissenschaftliche Theorien eine prognostische Verwendung, niemals aber eine belehrende und empfehlende. Sie sollen den in der Praxis tätigen lediglich darüber informieren, wie man eine bestimmte Wirkung erzielen kann. Da der gemeinsame Nenner der Teildisziplinen der Sozial- wissenschaften (Erziehungswissenschaft, Soziologie, Sozialarbeitswissenschaft, etc.) nach Rössner im Objektbereich zu finden ist und somit die Erörterung menschlichen Verhaltens und soziale Beziehungen (auf jeweils spezifische Art) fokussiert, gilt für die Erziehungs- bzw. Sozialarbeitswissenschaft: „Durch erziehungswissenschaftliche Theorien soll darüber informiert werden, wie (potentielle) Erzieher das Lernen von Zu- Erziehenden so beeinflussen können, dass die Zu- Erziehenden Verhalten realisieren, das vom Erzieher (und / oder seinem Auftraggeber) erwünscht ist, und Verhalten nicht realisieren, das vom Erzieher (und / oder seinem Auftraggeber) nicht erwünscht ist“ (Rössner 1977: 27). Die bisherigen Ausführungen liefern meines Erachtens bereits enge Bezüge zu den Vorstellungen des radikalen Behaviorismus. Die erziehungswissen- schaftlichen Theorien sollen den Praktikern eine „Erziehungs-Technologie“ ermöglichen, wobei erwünschtes Verhalten verstärkt bzw. unerwünschtes Verhalten abgebaut oder gelöscht (Extinktion) werden soll. Dabei geht es im Kern analog Watsons und Skinners Auffassung um die Kontrolle, Beeinflussung und Prognose menschlichen Verhaltens. Mittels Hypothesen (Wenn-Dann-Sätze) sollen Erzieher darüber informiert werden, „unter welchen Bedingungen bestimmte Ereignisse (Verhaltensweisen) realisiert bzw. nicht realisiert sein werden...“ (ebd.: 44).
Zum Schluss sei in diesem Abschnitt noch darauf hingewiesen, dass Rössner unter Verweis auf H. Roth eine interdisziplinäre Ausrichtung der Erziehungs- bzw. Sozialarbeitswissenschaft befürwortet, denn „jeder pädagogische Sachverhalt hat noch bis zur letzten Verfeinerung seines Inhalts eine biologische, psychologische und soziologische Seite“ (Roth 1967, 123, zit. in: ebd.: 32).
6.6.3 Theorie der Sozialarbeit
Rössner zieht den Begriff der „Sozialarbeit“ dem Terminus „Sozialpädagogik“ vor, wofür er mehrere Gründe anführt. Der Begriff der „Sozialpädagogik“ ist im deutschen Sprachraum nicht zuletzt aufgrund des Stammwortes „Pädagogik“ ein wesentlich mehrdeutigerer Begriff. Außerdem vertritt Rössner die Auffassung, dass der Terminus „Sozialarbeit“ an der internationalen Fachsprache angelehnt und darüber hinaus weiter gefasst ist. Unter ihn lassen sich somit auch Maßnahmen und Vorstellungen subsumieren, die nicht im eigentlichen Sinne erzieherischer Natur sind. Der wesentliche Vorteil bei dem Gebrauch des Terminus „Sozialarbeit“ liegt nach Rössner in einer differenzierteren, konsistenteren Begrifflichkeit begründet, wonach nur „Sozialarbeit“ zwischen Theorie und Praxis der Sozialarbeit unterscheidet. Da er ansonsten viele Gemeinsamkeiten postuliert (gleiche wissenschaftlichen Disziplinen, Forschungen, Theoreme), schließt die Theorie der Sozialarbeit die Theorie der Sozialpädagogik mit ein (Rössner 1973: 120-124).
Rössner unterscheidet bei seinen Ausführungen streng zwischen einer Theorie der Sozialarbeit (Sozialarbeitswissenschaft) und einer Praxis der Sozialarbeit, wodurch zwei verschiedene Problem- und Gegenstandsbereiche in den Blick genommen werden:
1) Die Theorie der Sozialarbeit als Gegenstandsbereich greift im Wesentlichen die nach einer sozialen Diagnose folgenden prophylaktischen, kompensierenden und korrigierenden Maßnahmen auf, die im Hinblick „auf ein von der diagnostizierenden Instanz befürchtetes nicht tolerierbares dissozialisiertes oder übersozialisiertes Verhalten... durchgeführt werden“ (Rössner 1973: 183). Aufgrund des Wissenschaftsverständnisses kann und darf die Theorie dem Sozialarbeiter keine konkreten Maßnahmen therapeutischer Art vorschlagen.
2) Die „Sozialarbeit als Praxis ist das von einer Sozialität (Gesellschaft) institutio- nalisierte soziale Verhalten der Registrierung von auffälligem Verhalten“ (ebd.: 199f.). Die Sozialarbeit hat demnach nicht-normalisiertes Verhalten zu registrieren, diagnostizieren und schließlich auch zu kontrollieren, „um eine begründete soziale Therapie einleiten zu können“ (ebd.: 202). Rössner fügt dem noch hinzu, dass Interventionen und Maßnahmen nicht nur einseitig vom Sozialarbeiter festzulegen sind und von ihm veranlasst werden: „Nicht der „Notleidende“ als solcher, nicht der Kranke als solcher, sondern eben der Dissozialisierte, also derjenige, der in der Sozialität störend, belastend usf. wirksam ist, stellt dem Sozialarbeiter Aufgaben; er ist es, der dem Sozialarbeiter die Aufgabe stellt, durch transitive oder intransitive Maßnahmen einer Dissozialität (Übersozialität) vorzubeugen bzw. diese in Richtung auf Normalität zu korrigieren“ (ebd.: 203).
6.6.4 Ausgangsüberlegungen für die Theorie und Praxis einer Sozialarbeit
Rössners Entwurf einer Sozialarbeit fordert dem Leser einiges an Aufmerksamkeit ab. Das liegt an dem recht ungewöhnlichen Aufbau seiner Ausführungen; so konstituiert sich seine Theorie der Sozialarbeit aus insgesamt 48 Sätzen (Axiomen), aus denen wiederum Thesen abgeleitet werden, die dann noch nach dem Dezimalsystem geordnet sind. Über die Aussage (Axiom): „Es gibt sozialisiertes Verhalten.“ (Rössner 1973: 85) erfolgen die für seinen Theorie-Entwurf wichtigen Begriffe. Rössner geht davon aus, dass Sozialisation nie symmetrisch verläuft, da jeder Mensch seinen eigenen Körper hat und sich als Individuum von anderen differenziert. Daraus folgert er: „Es gibt nur asymmetrische Sozialisation“ (ebd.: 86 ff.). Jede Gesellschaft erwartet somit von ihren Mitgliedern eine asymmetrische Sozialisation, aber nur innerhalb bestimmter Grenzen. Stimmt ein Verhalten nicht mit den Normen einer Gruppe überein, liegt dissozialisiertes Verhalten und damit eine Dissozialisation vor. Die Wertung oder Diagnose für dissozialisiertes Verhalten ist nun aber abhängig von der Perspektive, d. h. das gleiche Verhalten kann von einer Gruppe als sozialisiert, von einer anderen wiederum als dissozialisiert interpretiert werden. Insgesamt betrachtet kann menschliches Verhalten variieren und unterschiedlich diagnostiziert werden, nämlich als „sozialisiert“ („normal“), „auffällig“, „gefährdet“, „dissozialisiert“, „übersozialisiert“ und „asozialisiert“ (ebd.: 103 ff.). Dissozialität unterscheidet sich von Assozialität dadurch, dass erstere von einer Gruppe, letztere von der Gesellschaft diagnostiziert wird. „Assozialität ist eine von allen Gruppen diagnostizierte Dissozialität. Dissozialität unterscheidet sich von Asozialität nur dadurch, dass jene nicht von allen (gesellschaftlichen Gruppen) diagnostiziert wird“ (ebd.: 106). Von „Übersozialität“ spricht Rössner, wenn ein Individuum den von der diagnostizierenden Instanz erwarteten Asymmetrie-Spielraum nicht (aus-)nutzt, dann weist das Individuum aus der Sicht der diagnostizierenden Instanz einen Asymmetrie-Mangel, eine „nicht normale Asymmetrie“ auf. Unter Normalität versteht Rössner ein Verhalten des Individuums (einer Gruppe), das sich innerhalb des erwarteten Asymmetrie-Spielraums bewegt.
Die hier dargestellten Ausführungen verdeutlichen, dass Rössners theoretischer Entwurf einer Sozialarbeit das Verhältnis von abweichendem und normalem Verhalten untersucht. Es sollte aus den Begriffserklärungen deutlich hervorgehen, dass es sich bei abweichendem Verhalten um eine relative Kategorie handelt. Johannes Schillling stellt in diesem Zusammenhang fest: „Wenn sozialer Wandel gewünscht wird, ist dissozialisiertes Verhalten notwendig und wünschenswert. Es wird nicht nur zu tolerieren, sondern zu fördern sein, und diese Aufgabe hat die Sozialpädagogik. Ziel einer Sozialpädagogik sollte nicht (Über-) Funktionalität sondern Disfunktionalität sein (Schilling 2005: 99).
6.6.5 Folgerungen für die Praxis
Wenn nun eine bestimmte oder mehrere Instanzen bei einem Klienten dissoziales Verhalten diagnostizieren, so ist die Soziale Arbeit um eine „tertiäre Sozialisation“ bemüht. Diesen Begriff stellt er mit „tertiärem Erziehen“ gleich (mit Einschränkung auch der Begriff „Resozialisation“), d. h. es geht darum, „Effekte von Dissozialisationen aufzuheben, verkürzend formuliert: den dissozialisierten Menschen zu einem sozialisierten zu machen“ (Rössner 1977: 131). Um es noch einmal zu betonen: Der Begriff „tertiäres Erziehen“ umschreibt nach Rössner genau den Aufgaben- und Tätigkeitsbereich, für den der Sozialarbeiter zuständig ist.
Er ist demnach Erzieher in einem spezifischen Bereich, der diesen nicht überschreiten sollte, ein Spezialist für allgemeine tertiäre Sozialisation und für die Koordination im Bereiche des tertiären Erziehens im Rahmen einer gegebenen Sozialität“ (ebd.: 160).
6.6.6 Ein kritisch-rationalistisches Modell: Eine kurze Erläuterung
Unter „kritisch-rational“ versteht Rössner ein absichtsbezogenes und planvolles Einsetzen von Hypothesen (Theorien). Der Handelnde (Erzieher) soll sein rational- technologisch orientiertes Handeln konkret auf eine Person anwenden, damit diese zukünftig solche Verhaltensweisen annimmt, die den Erwartungen der diagnostizierenden Person entsprechen (ebd.: 68-81). Das Absichtshandeln „stellt ein reflektiertes Abwägen eines Mitteleinsatzes, ein exaktes Beachten der Störvariablen, eine reflektierte Antizipation der Neben- und Folgewirkungen des sozialen Beeinflussens...“ (Engelke 1999: 306) dar. Das „kritische Moment“ bezieht sich aber auch noch auf drei andere Aspekte. Auf einen davon weist Engelke im Hinblick auf den Technokratie-Vorwurf bzgl. Rössners Modell hin (ebd.: 307 ff.): Rössner weist den Technokratie-Vorwurf zurück, da er in seinem Technologie-Konzept den Praktiker als „Sozialtechniker“ nicht mit reinen mechanisch anzuwendenden Mitteln ausstattet, bei der Mittelanwendung sollen somit immer auch Werte und Normen zur Erreichung eines gewünschten Soll-Zustandes einfließen. Ein weiterer Aspekt tangiert die Erzieher und die Sozialarbeitswissenschaft gleichermaßen. Die Sozialarbeitswissenschaft kann aufgrund Rössners Betonung auf erzieherisches Handeln niemals auf die Formulierung genauer Ziele, Werte und Ideale verzichten (vgl. Rössner 1973: 35 ff.). Mit anderen Worten muss sie „pseudo-normative Leerformeln“ unterbinden, die nur gehaltlose Worthülsen sind und einen großen Interpretationsspielraum zulassen. So ist z. B. ein allgemeines Ziel der Sozialarbeit wie „allen Bürgern einen angemessenen Lebensstandard zu sichern“ für die Praxis unbefriedigend, da keine genaue Richtung angegeben wird. Auch der Begriff „Selbstverwirklichung“ stellt einen leeren, gehaltlosen Begriff dar, der erst durch die Umschreibung und präzise Angabe dessen, was „Selbstverwirklichung“ ausmacht, einen Sinn bekommt. Somit fordert Rössner auch den kritischen Umgang mit solchen Begriffen. Der dritte Aspekt basiert auf dem Wissenschaftsprogramm in Relation zu den gesellschaftlichen Bedingungen (vgl. Rössner 1977: 47 ff.). Da Rössner sich am „Kritischen Rationalismus“ orientiert, stellt Wissenschaft einen Prozess dar, insofern als dessen Ergebnisse ständig Korrekturen bedürfen. Daraus folgert Rössner, dass das Wissenschaftsprogramm niemals darauf abziele, die Gesellschaft als Ganzes zu verändern im Hinblick auf weit in eine ferne Zukunft gerichtete Ideale. Primär geht es also um ganz konkrete Veränderungen im “Hier und Jetzt“. In diesem Sinne zitiert er Popper: „Arbeite lieber für die Beseitigung von konkreten Missständen als für die Verwirklichung abstrakter Ideale. Versuche es nicht, mit politischen Mitteln die Menschheit zu beglücken. Setze dich stattdessen für die Behebung konkreter Missstände ein...“ (Popper 1975, 311, zit. in: ebd.: 52).
6.6.7 Bewertung und Einschätzung
Lutz Rössner galt in den sechziger und siebziger Jahren sicherlich als eine unorthodoxe, exzentrische Person, die durch die Orientierung am „Kritischen Rationalismus“ in der Pädagogik eine absolute Minderheit darstellte, denn die überwiegende Mehrheit folgte der „Kritischen Theorie“ mit ihrem „emanzipatorischen Erkenntnisinteresse“. Neu und für damals ungewöhnlich ist sicherlich auch der auf ihn zurückgehende Begriff „Sozialarbeitswissenschaft“, da an deutschen Universitäten nur von „Sozialpädagogik“ gesprochen wurde (vgl. Engelke 1999: 298 ff.). Engelke würdigt Rössners Theorie- Entwurf, da er zu den ausformulierten Theorien der Sozialarbeit gehöre. Auch die heftigen kritischen Reaktionen zu seinem „technologischen Ansatz“ weisen Engelke zufolge darauf hin, dass sein Ansatz von Bedeutung ist (ebd.: 308 ff.). Rössners Ansatz brachte in den Siebziger und Achtziger Jahren eine janusköpfige Gestalt hervor: Von den meisten Wissenschaftlern abgelehnt (u. a. aufgrund der Festlegung von Klienten als Dissozialisierte), von den Praktikern dagegen wohlwollend angenommen. Der Wunsch nach einer technologischen Hilfe für die Praxis sprach die „Sozialingenieure“ an (s. Dewe/Ferchhoff 1986: 152 ff., in: ebd.: 309). Engelke versteht nicht, warum der Ansatz seit Mitte der Achtziger von einer größeren Öffentlichkeit ignoriert wurde. Meiner Meinung nach wirkt Rössners Modell aus heutiger Sicht nahezu anachronistisch. Die vielen Kritikpunkte habe ich bereits unter Bernasconis Erläuterungen angeführt und sollten hier zur Vermeidung eines tautologischen Effekts nicht nochmals erwähnt werden. Zusätzlich zu den bekannten Kritikpunkten kommt noch hinzu, dass Rössners Vorstellungen von Sozialarbeit den gegenwärtigen sozialpädagogischen Denkmustern bei weitem nicht gerecht werden. Soziale Arbeit ist für mich eine dialogische, kommunikative Koproduktion. Am Beispiel der Jugendhilfe mit ihren rechtlichen Normierungen (geregelt im KJHG, SGB VIII) wird dies deutlich. Joachim Merchel weist darauf hin, dass der § 36 KJHG (Hilfeplan) „das zentrale Schlüsselelement in der Gestaltung der Jugendhilfe“ darstellt (Merchel 2006: 15). Die Hilfeplanung kann dabei als zentrales Verfahren für eine Entscheidung über eine Hilfe zur Erziehung angesehen werden. Ein zwingender Rechtsanspruch auf eine „Hilfe zur Erziehung“ (z. B. Erziehungsberatung § 28 SGB VIII) ergibt sich folgendermaßen (ebd.: 37 ff.): „Wenn aufgrund einer entsprechenden Artikulation der Adressaten die generelle Notwendigkeit einer Hilfe zur Erziehung festgestellt wurde (§ 27 Abs. 1 KJHG) und wenn dann in einem fachlichen Abwägungsprozess gemeinsam mit den Adressaten (§ 36 KJHG) die Geeignetheit und die Notwendigkeit einer bestimmten Hilfeart festgestellt wurde (§ 27 Abs. 2 KJHG), dann besteht ein zwingender Rechtsanspruch auf die nach fachlichen Kriterien mit den Adressaten abgesprochene Hilfeart“ (ebd.: 38). Was in diesem Zitat zum Ausdruck kommt, ist zum einen der Subjektstatus des Klienten und zum anderen die sozialpädagogische Leitkategorie der „Aushandlung“, die Merchel anstelle der Hilfeplanung als Vorgang der Diagnose favorisiert (ebd.: 50). Merchel zufolge wird Hilfeplanung, interpretiert als Aushandlungskonzept, den sozialpädagogischen Prozessen eher gerecht. Der Klient wird dieser Sichtweise nach zum „Koproduzent“, wobei die Komplexität sozialpädagogischer Entscheidungen und die vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten der Problemlagen des Klienten gemeinsam eruiert, ausgehandelt werden (ebd.: 19 ff.).
Es dürfte klar sein, dass Rössners Modell der Leitkategorie der „Aushandlung“ nicht gerecht wird. Die von den Sozialarbeitern zu erstellende soziale Diagnose nimmt lediglich Verhaltensabweichungen in den Blick, wobei gesellschaftliche Normalitätsvorstellungen nicht kritisch analysiert werden (vgl. Bernasconi 2007: 123).
Mit dem Fokus auf menschliches, beobachtbares Verhalten wird der Bezug zum Behaviorismus deutlich. Der Behaviorismus, der sich am „Kritischen Rationalismus“ orientiert, war (oder ist) keine Seltenheit (vgl. Engelke 1999: 299, 2003: 405).
Die Analogien werden bei Kenntnisnahme der wissenschaftlichen Technik und deren Umsetzung noch offensichtlicher. Behavioristen entwickeln im Labor eine wissenschaftliche Technik, die von „Sozialingenieuren“ umgesetzt werden soll (Pervin/Cervone/John 2005: 464). Der Verhaltensforscher stellt nach der Rössnerschen Terminologie den „Metapraktiker“ (Sozialingenieur) dar, der den Sozialarbeiter (Sozialtechniker) mit Techniken ausstattet, die in der Praxis umgesetzt werden sollen (vgl. Engelke 1999: 308).
7. Ausblick
Ziel meiner Untersuchung war es, zunächst Persönlichkeitstheorien auf die vier Analyseeinheiten zu überprüfen. Dabei konnten sowohl Gemeinsamkeiten als auch wesentliche Gegensätze herausgestellt werden. Während Freud, Adler und Jung die Determinanten des Verhaltens innerhalb der Person ansiedeln, behaupten die lerntheoretischen Ansätze (Watson, Skinner), dass umweltbedingte Determinanten das Verhalten bestimmen und dass das Verhalten variabel oder situationsspezifisch ist. Die sozial-kognitiven Theorien (Bandura, Mischel) erörtern dagegen, wie personale und situative Faktoren zusammenwirken. Die humanistischen Ansätze (Rogers, Frankl) postulieren sowohl Determinanten des Verhaltens innerhalb der Person, betonen aber auch die Austauschprozesse mit der Umwelt. Die von Rogers angenommene Selbstaktualisierungstendenz leitet Transaktionen mit der Umgebung ein, nach Frankl befinden sich Individuen aufgrund der Selbsttranszendenz im Austausch mit der Umwelt.
Mit den unterschiedlichen, oft konfliktbeladenen theoretischen Ansichten wurde wissenschaftlicher Fortschritt ermöglicht. Indem zum Beispiel der radikale Behaviorismus in seinen Forschungsarbeiten sich mehr auf das äußere, durch Umweltvariabeln gelenktes Verhalten konzentrierte, wurde darauf entsprechend reagiert. Die somit eingeleitete „kognitive Wende“ führte nun zu einer Berücksichtigung intrapsychischer Prozesse mit einer deutlichen Akzentuierung auf die kognitiven Operationen von Individuen, die sowohl in der psychoanalytischen Ich- Psychologie (Hartmann) als auch in der sozial-kognitiven Theorie zum Forschungsgegenstand erklärt wurde (vgl. Pervin/Cervone/John 2005: 661). Derzeitige Persönlichkeitsforscher konzentrieren sich in ihren Forschungen vor allem auf die kognitiven Aspekte der Persönlichkeit, wonach der Mensch als handelndes Individuum sich in wechselseitigen Austauschprozessen mit seiner Umwelt befindet (interaktionistischer Ansatz). Dieser Ansatz innerhalb der sozial-kognitiven Theorie ist noch relativ neu (ebd.: 664). Die Beschäftigung mit den gegensätzlichen Ansichten über die menschliche Natur kann für den Menschen von Nutzen sein. Er ist „ein besser informierter Bürger und Entscheidungsträger in dieser Welt“ (ebd.: 660)
Im zweiten Teil meiner Arbeit habe ich aufgezeigt, wie persönlichkeitstheoretische Erkenntnisse in Methoden und Konzepte der Sozialen Arbeit integriert wurden. Während aufgrund der Implementation eines psychoanalytischen Paradigmas in der sozialen Einzelhilfe nach Hollis und Perlman individuelle Probleme einseitig im Individuum lokalisiert wurden, ist es im Rössnerschen Ansatz genau umgekehrt: Der Klient wird als Individuum kaum wahrgenommen, sondern vor dem Hintergrund seiner Funktionalität innerhalb eines sozialen Kollektivs bewertet. Der Rössnersche Ansatz ist ein ausgezeichneter Beleg für die problematischen Folgewirkungen in der praktischen Sozialarbeit, die eine Orientierung an einem behavioristischen Paradigma auszulösen vermag. In erster Linie entscheidet immer eine höhere Instanz über den Verlauf des Hilfeprozesses, wodurch der Aushandlungsprozess zwischen Klient und Sozialarbeiter auf ein Minimum reduziert wird. Als sozialpädagogisches Denkmuster tauchen Aushandlungsprozesse insbesondere in den systemisch-lebensweltlich orientierten Ansätzen nach Germain/Gitterman, Kleve und Bernasconi auf. Alle drei Ansätze haben gemeinsam, dass sie Menschen als lernfähige, deutende und in komplexen Interaktionen eingebettete Individuen betrachten. Ferner weisen sie auf die Notwendigkeit hin, dass sozialarbeiterisches Handeln ein Handeln auf mehreren sozialen Ebenen in verschiedenen sozialen Systemen erfordert. Dies konnte ich vor allem am Beispiel von Addams` Arbeit in Chicago geschichtlich belegen. Die systemisch ausgerichteten Ansätze erlauben aufgrund der Integration der individuumzentrierten und soziozentrierten Paradigmen (siehe Bernasconi) einen vielfältigen und flexiblen Einsatz persönlichkeitstheoretischer Erkenntnisse. Meine Erläuterungen unterstreichen, dass sie die häufigsten Schnittstellen und Berührungspunkte zu den Persönlichkeitstheorien zulassen. Was kann nun abschließend als Fazit gesagt werden? Ich konnte die Notwendigkeit der Orientierung an der Leitkategorie der Aushandlung multiperspektivisch begründen:
- Die zeithistorische Begründung, wonach Addams Arbeit in Chicago immer auch ein „Aushandeln von Vereinbarungen, Verträgen und Bündnissen“ (Engelke 1999: 153) darstellte.
- Die systemtheoretisch-konstruktivistische Begründung (Bernasconi, Kleve, Germain/Gitterman), die die gemeinsame Erarbeitung von Problemdefinitionen erklärt.
- Die dienstleistungstheoretische Begründung, wonach der Klient ein Koproduzent ist.
- Die Verfahrentheoretische Begründung, die Aushandlungen innerhalb der Mediation und des Casemanagement notwendig macht.
- Die rechtliche Begründung, wonach Aushandlungen im § 36 SGB VIII zur Sprache kommen.
Alle fünf Argumentationen bestätigen mich in der Auffassung, dass Soziale Arbeit eine dialogische, kommunikative Koproduktion sein muss. Diese vorläufige Arbeitshypothese gilt es nun anhand einer genauen Analyse der unterschiedlichen Arbeitsfelder zu bestätigen, zu ergänzen oder zu verwerfen. Dabei müssen auch die sozialstaatlichen Veränderungen und ihre möglichen Folgen für die Soziale Arbeit berücksichtigt werden (siehe offene Jugendarbeit). Dies kann nun nicht mehr Aufgabe im Rahmen meiner Fragestellung sein. Dennoch bewerte ich die Erörterung der Fragestellung insofern als positiv, als sie mir zu neuen, vorläufigen Ergebnissen und Einsichten verhelfen konnte und weitere Forschungen ermöglicht.
Literaturverzeichnis
Adler, Alfred: Studie über Minderwertigkeit von Organen, Frankfurt am Main: Fischer, 1977
Adler, Alfred: Über den nervösen Charakter, Frankfurt am Main: Fischer, 1976; ungekürzte Ausg., 41-45 Tsd.
Adler, Alfred, Furtmüller, Carl, Wexberg, Erwin: Heilen und Bilden, Frankfurt am Main: Fischer, 1973
Adler, Alfred: Individualpsychologie in der Schule, Frankfurt am Main: Fischer, 1973; ungekürzte Ausg., 46.- 48. Tsd.
Adler, Alfred: Der Sinn des Lebens, Frankfurt am Main: Fischer, 1973, 21. Aufl.
Adler, Alfred/Jahn, Ernst: Religion und Individualpsychologie, Frankfurt am Main: Fischer, 1975
Adler, Alfred: Das Problem der Homosexualität und anderer sexueller Perversionen, Frankfurt am Main: Fischer, 1988, 21.- 22. Tsd.
Ansbacher, L. Heinz/Ansbacher, R. Rowena: Alfred Adlers Individualpsychologie; München; Basel: E. Reinhardt, 4., erg. Aufl., 1995
Arnold, Ulli/Maelicke, Bernd: Lehrbuch der Sozialwirtschaft, 2. Aufl. 2003, Nomos Verlag, Baden- Baden
Böhringer, Hannes: Kompensation und Common Sense- zur Lebensphilosophie Alfred Adler, Königstein/TS.: Hein bei Athenäum, 1985
Bandura, Albert: Sozial- kognitive Lerntheorie, 1. Aufl., Stuttgart: Klett- Cotta, 1979
Brinkmann, Doris: Pädagogische Texte/Interaktion/Lernen, 1. Aufl., Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1980
Bernasconi- Staub, Silvia: Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft, 1. Aufl.: 2007, Haupt Verlag Bern, Stuttgart- Wien, 2007
Correll, Werner: Persönlichkeits-Psychologie: Eine Einf. in d. Persönlichkeitssysteme von Freud bis Skinner, Donauwörth: Auer, 1976
Dahme, Jürgen-Heinz, Wohlfahrt, Norbert: Aktivierende Soziale Arbeit, Bd. 12, Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler, 2005
Engelke, Ernst: Die Wissenschaft Soziale Arbeit, 1. Aufl. 2003; Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau
Engelke, Ernst: Theorien der Sozialen Arbeit, 2. Aufl.1999, Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau
Frankl, E. Viktor: Theorie und Therapie der Neurosen- Eine Einführung in Logotherapie und Existenzanalyse, München: Reinhardt, 1975, 4. Aufl.
Frankl, E. Viktor: Ärztliche Seelsorge, München: Kindler, 1975, 8. Aufl.
Frankl, E. Viktor: Das Leiden am sinnlosen Leben: Freiburg im Breisgau, Basel, Wien: Herder, 1977, Originalausg.
Frankl, E. Viktor: Trotzdem Ja zum Leben sagen, München: Kösel, 1977, Aufl. [1.- 6. Tsd.]
Frankl, E. Viktor: Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn: Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk, München [u. a.] : Piper, 1979
Frankl, E. Viktor: Psychotherapie für den Laien, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau, 9. Aufl., 1981
Frankl, E. Viktor: Der Leidende Mensch, Verlag Hans Huber, Bern, 1990
Freud, Sigmund: Abriß der Psychoanalyse- Das Unbehagen in der Kultur, Fischer, Frankfurt/M., 1972
Freud, Sigmund: Fragen der Gesellschaft, Ursprünge der Religion Bd. IX, Fischer, Frankfurt/M., 1974
Freud, Sigmund: Psychologie des Unbewussten Bd. III, Fischer, Frankfurt/M., 1975
Flammer, August: Entwicklungstheorien, Verlag Hans Huber, Bern; 3. Aufl., 2005
Fischer, Wolfgang, Löwisch, Jürgen- Dieter, Ruhloff, Jörg: Arbeitsbuch Pädagogik I; Verlag Schwann Düsseldorf, Aufl. 81 80/ 7 6 5; 1975
Galuske, Michael: Methoden der Sozialen Arbeit- Eine Einführung, Juventa Verlag, Weinheim-München, 1998
Germain, Carel B., Gitterman, Alex: Praktische Sozialarbeit- Das “Life Model” d. Sozialen Arbeit, Stuttgart: Erke, 1983
Gehrmann, Gerd, Müller, D. Klaus: Aktivierende Soziale Arbeit mit nicht- motivierten Klienten, 2. Aufl., Walhalla u. Praetoria Verlag, Regensburg/Berlin, 2007
Herkner, Werner: Psychologie, 2. Aufl., Wien; New York: Springer, 1992
Hollis, Florence: Soziale Einzelhilfe als psychosoziale Behandlung, Lambertus- Verlag, Freiburg im Breisgau, 1971
Jacobi, Jolande: Die Psychologie von C. G. Jung, Rascher Verlag; Zürich- Stuttgart, 5. Aufl., 1959
Jung, G. C.: Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, WalterVerlag, Olten, 1991
Jung, G., C.: Psychologische Typen, Solothurn [u. a.]: Walter, 1. Aufl., 1995
Alt, Franz: Das C. G. Jung Lesebuch, Verlag Ullstein, Frankfurt/M.- Berlin, 1986
Jacobi, Henry: Alfred Adlers Individualpsychologie und dialektische Charakterkunde, Fischer, F./M., 1974
Kleve, Heiko: Konstruktivismus und Soziale Arbeit, Aachen: Kersting, 1996
Kleve, Heiko: Sozialarbeitswissenschaft, Systemtheorie und Postmoderne, LambertusVerlag, Freiburg im Breisgau, 2003
Kleve, Heiko, Haye, Britta, Grosser-Hampe, Andreas, Müller, Matthias: Systemisches Case- Management- Falleinschätzung in Hilfeplanung in der Sozialen Arbeit, CarlAuer Systeme, Heidelberg, 2006
Merchel, Joachim: Hilfeplanung bei den Hilfen zur Erziehung- §36 SGBVIII, Stuttgart [u. a.]: Borberg, 2. Aufl., 2006
Nolting, Paulus: Psychologie lernen- Eine Einführung und Anleitung, Psychologie Verlags Union, Weinheim; 6. Aufl., 1996
Perlman, Helen, Harris: Soziale Einzelhilfe als problemlösender Prozess, Freiburg im Breisgau: Lambertus- Verlag, 1969
Pervin, Cervone, John: Persönlichkeitstheorien, Ernst Reinhardt Verlag, München; 5. Aufl., 2005
Rössner, Lutz: Theorie der Sozialarbeit; Ernst Reinhardt Verlag, München, 1973
Rössner, Lutz: Erziehungs- und Sozialarbeitswissenschaft, Ernst Reinhardt Verlag, München; 1. Aufl.; 1977
Richter- Hoffmann, Ulrike: Freuds Seelenapparat; Psychiatrie-Verlag, Bonn, 1994
Röhlein, K. H.: Sinnorientierte Seelsorge, München 1986
Rogers, R. Carl: Entwicklung der Persönlichkeit; Stuttgart: Klett-Cotta, 1973
Rogers, R. Carl: Der neue Mensch, Stuttgart: Klett-Cotta, 1981
Roger, R. Carl: Eine Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen Beziehungen; Verlag GwG Köln, 3. Aufl. 1991
Steden, Peter- Hans: Psychologie- Eine Einführung für soziale Berufe, LambertusVerlag, Freiburg im Breisgau; 2. Aufl., 2004
Skinner, F. B.: Wissenschaft und menschliches Verhalten; Kindler Verlag, München, 1973
Schilling, Johannes: Soziale Arbeit: Geschichte- Theorie- Profession, Ernst Reinhardt Verlag, München, 2. Aufl., 2005
Urban, Adrian: Das große Buch der Menschenkenntnis und Charakterkunde; Verlagsgruppe Weltbild, Augsburg; 2. Aufl., 2004
Wehr, Gehrhard: Die großen Psychoanalytiker- Profile - Ideen - Schicksale; Artemis und Winkler Verlag, Zürich; 1996
Watson, B. John: Behaviorismus; Verlag Abt., Frankfurt am Main; 2. Aufl., 1976
Internetquelle
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Inhaltsverzeichnis des Textes?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst eine Einleitung, psychodynamische Persönlichkeitstheorien (Freud, Adler, Jung), lerntheoretische Persönlichkeitstheorien (Watson, Skinner), sozial-kognitive Lerntheorien (Bandura, Mischel), humanistische Persönlichkeitstheorien (Rogers, Frankl), ausgewählte Methoden, Konzepte und Handlungsmodelle (Hollis, Perlman, Germain/Gitterman, Staub-Bernasconi, Kleve, Rössner), einen Ausblick und ein Literaturverzeichnis.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen umfassen die vergleichende Analyse verschiedener Persönlichkeitstheorien und deren Anwendbarkeit in der Sozialen Arbeit, sowie die Vorstellung ausgewählter Methoden und Handlungsmodelle der Sozialen Arbeit.
Welche psychodynamischen Persönlichkeitstheorien werden behandelt?
Die analysierten psychodynamischen Persönlichkeitstheorien sind die von Sigmund Freud, Alfred Adler und C. G. Jung.
Welche lerntheoretischen Persönlichkeitstheorien werden behandelt?
Die analysierten lerntheoretischen Persönlichkeitstheorien sind die von John B. Watson und B. F. Skinner.
Welche sozial-kognitiven Lerntheorien werden behandelt?
Die analysierten sozial-kognitiven Lerntheorien sind die von Albert Bandura und Walter Mischel.
Welche humanistischen Persönlichkeitstheorien werden behandelt?
Die analysierten humanistischen Persönlichkeitstheorien sind die von Carl R. Rogers und Viktor E. Frankl.
Welche Methoden, Konzepte und Handlungsmodelle der Sozialen Arbeit werden im Text dargestellt?
Der Text stellt soziale Einzelhilfe als psychosoziale Behandlung (Florence Hollis), soziale Einzelhilfe als problemlösender Prozess (Helen Harris Perlman), das „Life Model“ der Sozialen Arbeit (Germain; Gitterman), Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft (Silvia Staub-Bernasconi), Postmoderne Sozialarbeit (Heiko Kleve), und ein kritisch-rationalistisches Modell (Lutz Rössner) vor.
Was ist das Menschenbild nach Sigmund Freud?
Freuds Menschenbild ist sowohl mechanistisch, thermodynamisch als auch topologisch, wobei ein pessimistischer Grundton in seinen soziologischen Abhandlungen erkennbar ist.
Was ist das Menschenbild nach Alfred Adler?
Adlers Menschenbild ist geprägt von der Annahme eines angeborenen Gemeinschaftsgefühls, der Einmaligkeit der Persönlichkeit, Zielgerichtetheit und der Fähigkeit zur Selbstgestaltung.
Was ist das Menschenbild nach C.G. Jung?
Jungs Menschenbild ist philosophisch relativistisch und bewertet menschliche Prozesse als ambivalent und eingebettet in Gegensatzpaare, wobei auch geistige und religiöse Bedürfnisse berücksichtigt werden.
Was ist das Menschenbild nach B.F. Skinner?
Skinners Menschenbild ist sowohl optimistisch, da Verhalten jederzeit veränderbar ist, als auch fatalistisch, da jedes Verhalten durch vorausgegangenes Verhalten determiniert ist.
Welche Kritikpunkte werden bezüglich der psychoanalytischen Theorien genannt?
Es wird kritisiert, dass viele Annahmen falsifiziert wurden, Begriffe metaphorischer Natur sind und sich einer wissenschaftlichen Operationalisierung entziehen, und dass die Konzentration mehr auf Defizite als auf Kompetenzen der Klienten liegt.
Welche Kritikpunkte werden bezüglich Adlers Individualpsychologie genannt?
Kritisiert wird, dass Adler das menschliche Handeln auf Organminderwertigkeiten ableitet, was die Erklärung menschlichen Verhaltens in extremer Weise vereinfacht.
Welche Kritikpunkte werden bezüglich des "Life Model" der Sozialen Arbeit genannt?
Es wird bemängelt, dass das Modell dogmatisch ist, Problemursachen immer nur als "gestörte" Transaktionen zwischen Person und Umgebung verstanden werden, und der Anspruch auf ein universelles, global einsetzbares Konzept nicht gerechtfertigt ist.
Was ist das Ziel der psychoanalytischen Therapie nach Freud?
Die psychoanalytische Therapie will mittels der Technik der freien Assoziation die retrospektiven Konflikte verbal und emotional aufarbeiten und Traumanalyse nutzen, um unbewusste Konflikte aufzudecken.
Was ist das Ziel der Individualpsychologie nach Adler?
Die Individualpsychologie will fehlgeleitete Leitlinien im Leben eines Menschen aufdecken und modifizieren im Hinblick auf ein gemeinschaftliches Handeln.
Details
- Titel
- Die Bedeutung von Persönlichkeitstheorien für die soziale Arbeit
- Hochschule
- Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (Evg. FH Bochum RWL)
- Note
- 1.0
- Autor
- Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge Christian Klein (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 128
- Katalognummer
- V111291
- ISBN (eBook)
- 9783640093717
- Dateigröße
- 840 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Bedeutung Persönlichkeitstheorien Arbeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Arbeit zitieren
- Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge Christian Klein (Autor:in), 2007, Die Bedeutung von Persönlichkeitstheorien für die soziale Arbeit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/111291
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-