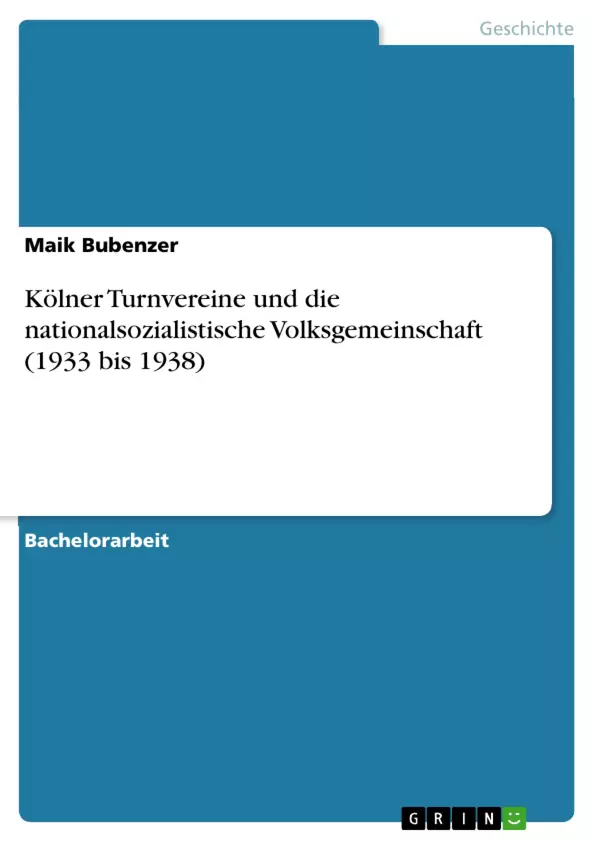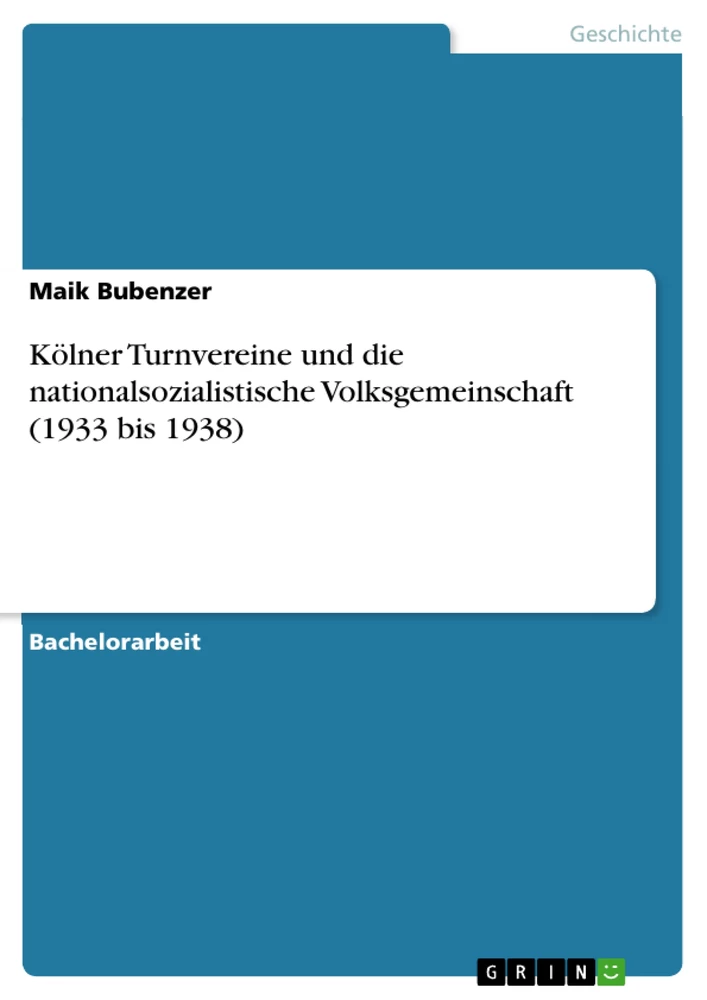
Kölner Turnvereine und die nationalsozialistische Volksgemeinschaft (1933 bis 1938)
Bachelorarbeit, 2016
39 Seiten, Note: 2,0
Geschichte Deutschlands - Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Welche organisatorischen Veränderungen prägten die Turnvereine nach 1933?
- Angebot der Turnvereine
- Zugehörigkeit zu Verbänden und Organisationen
- Anzahl der Vereine und Mitgliederzahlen
- Welchen Anteil hatten die Kölner Turnvereine an der nationalsozialistischen Machteroberung und -konsolidierung?
- Reaktionen auf die Maßnahmen der Gleichschaltung
- Exklusion aus der Volksgemeinschaft: die jüdischen Mitglieder
- Jugendarbeit
- Arbeitersport und konfessionelle Verbände
- Welche sozialisierenden Funktionen hatten die Turnvereine im Alltag der NS-Volksgemeinschaft?
- Traditionen und Brüche
- Neue Festkultur?
- Beteiligung an Veranstaltungen des Staates
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Dietarbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle der bürgerlichen Turnvereine in Köln während der Zeit des Nationalsozialismus, genauer gesagt in den Jahren 1933 bis 1938. Der Fokus liegt auf der Frage, wie diese Vereine sich an die veränderten politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse anpassten, welche organisatorischen Veränderungen sie durchliefen und welchen Einfluss die Ideologie der "Volksgemeinschaft" auf ihr Vereinsleben hatte.
- Organisatorische Veränderungen der Turnvereine nach 1933
- Beteiligung der Kölner Turnvereine an der nationalsozialistischen Machteroberung und -konsolidierung
- Sozialisierende Funktionen der Turnvereine im Alltag der NS-Volksgemeinschaft
- Die Rolle des Konzepts "Volksgemeinschaft" im Kontext der Turnvereine
- Die Quellenlage und die Herausforderungen der Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Situation des Turnverbandes Köln und stellt die Relevanz des Themas für die Erforschung des Alltags der NS-Diktatur heraus. Kapitel 2 widmet sich den organisatorischen Veränderungen der Turnvereine nach 1933, betrachtet die Anpassung des Angebots, die Zugehörigkeit zu Verbänden und Organisationen sowie die Entwicklung der Mitgliederzahlen. In Kapitel 3 wird der Frage nachgegangen, inwiefern die Kölner Turnvereine an der nationalsozialistischen Machteroberung und -konsolidierung beteiligt waren, wobei die Reaktionen auf die Gleichschaltungsmaßnahmen, die Exklusion jüdischer Mitglieder und die Jugendarbeit im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenfeldern des Turnens und der Turnvereine im Nationalsozialismus, insbesondere im Kontext der Stadt Köln. Sie analysiert die Anpassungsmechanismen der Vereine an die NS-Diktatur, die Auswirkungen der "Volksgemeinschaft" auf das Vereinsleben und die Veränderungen in der Vereinsstruktur und -organisation. Die Arbeit berücksichtigt auch die schwierige Quellenlage und die Herausforderungen der Forschung in diesem Bereich.
Details
- Titel
- Kölner Turnvereine und die nationalsozialistische Volksgemeinschaft (1933 bis 1938)
- Hochschule
- Ruhr-Universität Bochum (Fakultät für Geschichtswissenschaft)
- Veranstaltung
- -
- Note
- 2,0
- Autor
- Maik Bubenzer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 39
- Katalognummer
- V1119012
- ISBN (eBook)
- 9783346480804
- ISBN (Buch)
- 9783346480811
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Sportgeschichte Nationalsozialismus Volksgemeinschaft Vereine Köln Turnen Turnvereine 1933 Dietwesen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Maik Bubenzer (Autor:in), 2016, Kölner Turnvereine und die nationalsozialistische Volksgemeinschaft (1933 bis 1938), München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1119012
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-