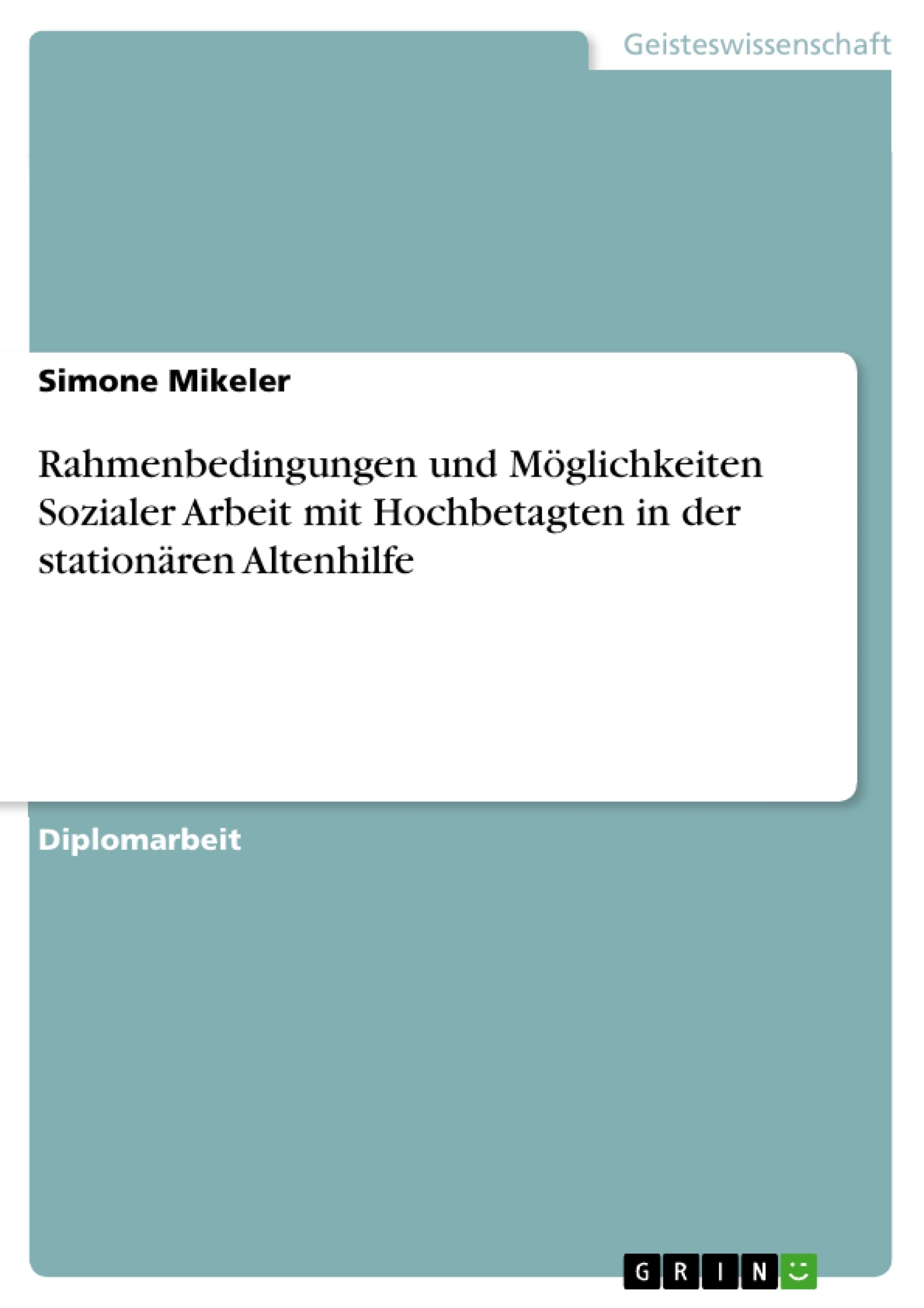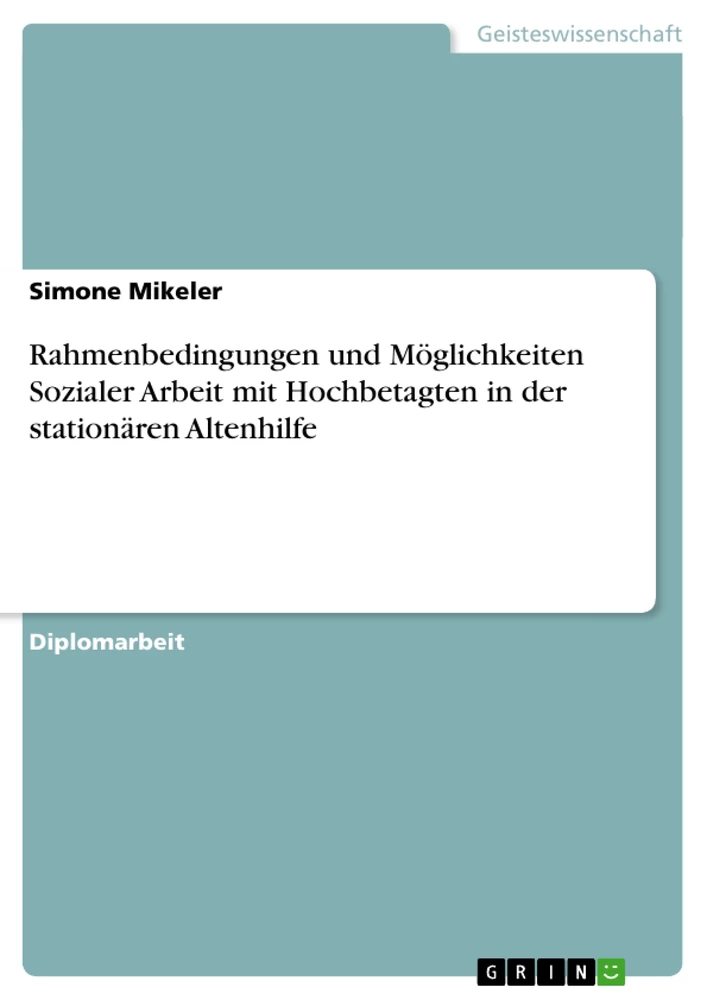
Rahmenbedingungen und Möglichkeiten Sozialer Arbeit mit Hochbetagten in der stationären Altenhilfe
Diplomarbeit, 2003
129 Seiten, Note: sehr gut
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das vierte Lebensalter
- Die Soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit
- Die Pflegeversicherung
- Die Funktion der Sozialhilfe
- Die Zukunft der Pflegeversicherung
- Arbeiten und Leben im Alten- und Pflegeheim
- Die Qualitätssicherung in der Altenpflege
- Die Finanzierung von Alten- und Pflegeheimen
- Die Anforderungen an die Pflege
- Die Pflege zwischen Anspruch und Möglichkeiten
- Das Leben im Alten- und Pflegeheim
- Alternative Heimkonzepte
- Lebensweltorientierte Heimkonzepte
- Wohngruppen/ Hausgemeinschaften
- Die besondere stationäre Dementenbetreuung
- Das 'Drei-Welten-Modell'
- Die Soziale Arbeit in der stationären Altenhilfe
- Die Bewohnerzentrierte Ebene
- Die Gemeinwesenorientierte Ebene
- Die Institutions- und Mitarbeiterbezogene Ebene
- Die rechtliche Verankerung Sozialer Arbeit im Heim
- Konzeptentwicklung für das Aufgabenfeld Soziale Arbeit im Seniorenheim Nordstadt
- Das Seniorenheim Nordstadt
- Die Bewohner
- Die Personalausstattung im September 2003
- Der Alltag der Heimbewohner
- Die Aufgabenbereiche Sozialer Arbeit im Seniorenheim Nordstadt
- Die Bewohnerzentrierten Aufgaben
- Biographiearbeit
- Einzelförderung für gerontopsychiatrisch veränderte alte Menschen
- Erinnerungsarbeit
- 'Snoezelen' (Basale Stimulation)
- Vorfeld- und Integrationsarbeit mit neuen Heimbewohnern
- Psychosoziale Begleitung/ Krisenintervention
- Die Stärkung des Heimbeirats
- Zeitstrukturierende Angebote
- Teilhabe der Bewohner am Heimalltag
- Struktur für Menschen mit Demenz
- Sozialpädagogische Gruppenangebote
- Hausinterne Veranstaltungen
- Die Gemeinwesenarbeit
- Die Stadtteilarbeit
- Die Angehörigenarbeit
- Bürgerschaftliches Engagement
- Die Öffentlichkeitsarbeit
- Die Institutions-und Mitarbeiterbezogene Ebene
- Die Milieugestaltung
- Die Mitwirkung an der Organisationsentwicklung
- Die Einführung von ‘Fingerfood’
- Die Kooperation mit den Altenpflegern
- Die Begleitung von Altenpflegeschülern, Praktikanten, FSJ-, Honorarkräften
- Die Bewohnerzentrierten Aufgaben
- Resümee
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit den Rahmenbedingungen und Möglichkeiten Sozialer Arbeit mit Hochbetagten in der stationären Altenhilfe. Sie analysiert die spezifischen Herausforderungen und Chancen, die sich im Kontext der alternden Gesellschaft und der steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen ergeben. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten Sozialer Arbeit in diesem Bereich zu entwickeln und konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis zu formulieren.
- Die soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit
- Die Qualitätssicherung in der Altenpflege
- Die Lebenswelt und Bedürfnisse von Hochbetagten in stationären Einrichtungen
- Die Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten Sozialer Arbeit in der stationären Altenhilfe
- Konzeptentwicklung für die Soziale Arbeit in einem konkreten Seniorenheim
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Sozialen Arbeit mit Hochbetagten in der stationären Altenhilfe ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der demografischen Entwicklung. Sie stellt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit dar.
Das Kapitel "Das vierte Lebensalter" beleuchtet die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen, die sich im hohen Alter stellen. Es werden die körperlichen, psychischen und sozialen Veränderungen im Alter sowie die damit verbundenen Risiken und Chancen diskutiert.
Das Kapitel "Die Soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit" analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Finanzierung der Pflegebedürftigkeit. Es werden die Leistungen der Pflegeversicherung, der Sozialhilfe und die zukünftigen Herausforderungen im Bereich der Pflegefinanzierung beleuchtet.
Das Kapitel "Arbeiten und Leben im Alten- und Pflegeheim" befasst sich mit den verschiedenen Aspekten des Lebens in einem Alten- und Pflegeheim. Es werden die Qualitätssicherung in der Altenpflege, die Finanzierung von Heimen, die Anforderungen an die Pflege und die verschiedenen Heimkonzepte, wie z.B. lebensweltorientierte Heimkonzepte, Wohngruppen und die besondere stationäre Dementenbetreuung, vorgestellt.
Das Kapitel "Die Soziale Arbeit in der stationären Altenhilfe" analysiert die Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten Sozialer Arbeit in diesem Bereich. Es werden die drei Ebenen der Bewohnerzentrierten, Gemeinwesenorientierten und Institutions- und Mitarbeiterbezogenen Arbeit sowie die rechtliche Verankerung Sozialer Arbeit im Heim erläutert.
Das Kapitel "Konzeptentwicklung für das Aufgabenfeld Soziale Arbeit im Seniorenheim Nordstadt" stellt ein konkretes Beispiel für die Anwendung der theoretischen Erkenntnisse in der Praxis dar. Es werden die Besonderheiten des Seniorenheims Nordstadt, die Aufgabenbereiche Sozialer Arbeit in diesem Heim und konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Soziale Arbeit mit Hochbetagten, die stationäre Altenhilfe, die Pflegebedürftigkeit, die Qualitätssicherung in der Altenpflege, die Lebenswelt von Hochbetagten, die Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten Sozialer Arbeit, die Konzeptentwicklung für die Soziale Arbeit in einem Seniorenheim, die Bewohnerzentrierte Arbeit, die Gemeinwesenorientierte Arbeit, die Institutions- und Mitarbeiterbezogene Arbeit, die rechtliche Verankerung Sozialer Arbeit im Heim, die demografische Entwicklung und die Herausforderungen der alternden Gesellschaft.
- Das Seniorenheim Nordstadt
Details
- Titel
- Rahmenbedingungen und Möglichkeiten Sozialer Arbeit mit Hochbetagten in der stationären Altenhilfe
- Hochschule
- Universität Kassel
- Note
- sehr gut
- Autor
- Simone Mikeler (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 129
- Katalognummer
- V112607
- ISBN (eBook)
- 9783640139330
- ISBN (Buch)
- 9783640860302
- Dateigröße
- 1023 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Rahmenbedingungen Möglichkeiten Sozialer Arbeit Hochbetagten Altenhilfe
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 51,99
- Arbeit zitieren
- Simone Mikeler (Autor:in), 2003, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten Sozialer Arbeit mit Hochbetagten in der stationären Altenhilfe, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/112607
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-