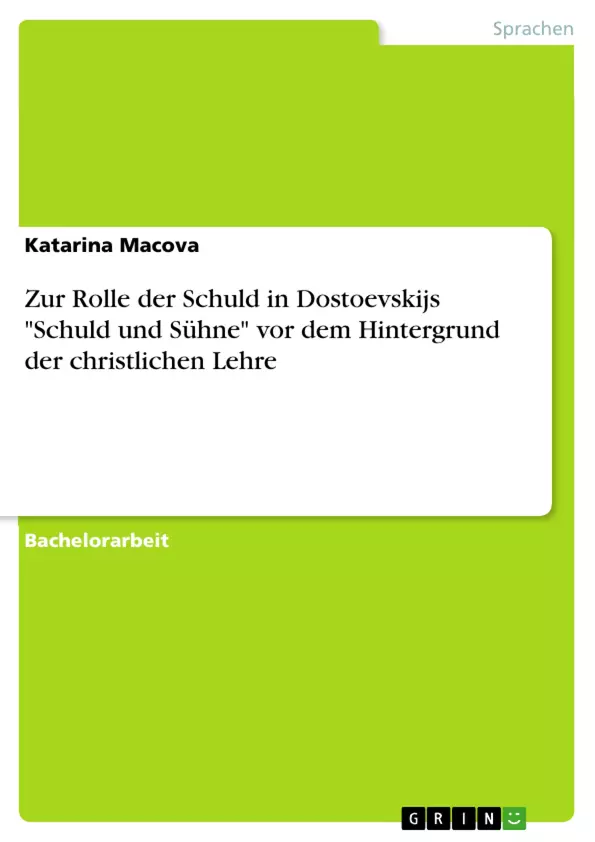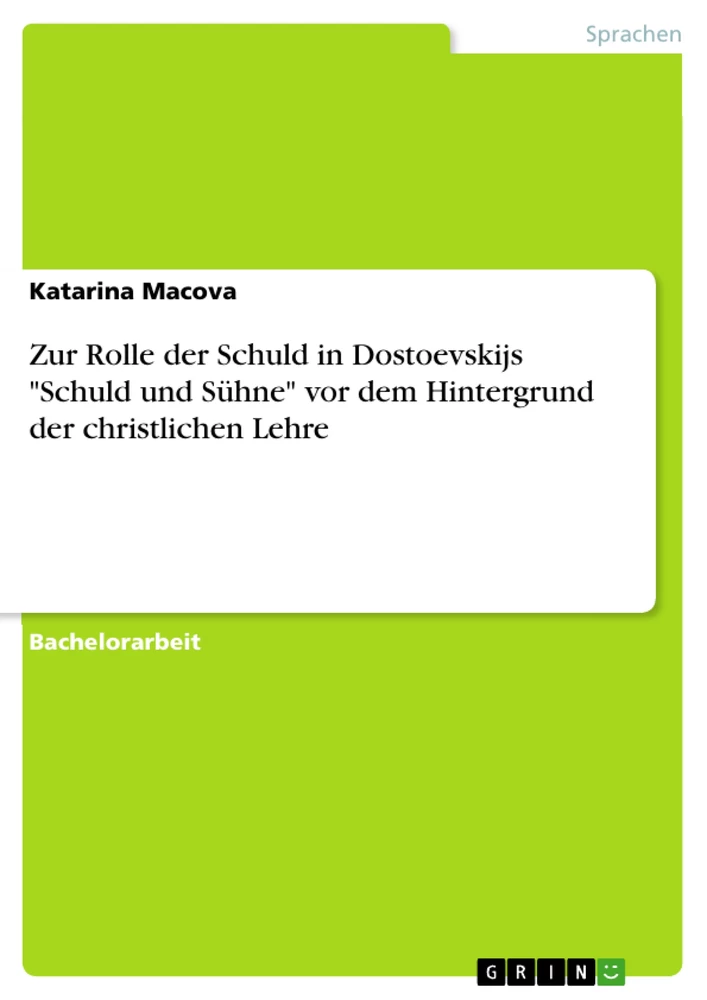
Zur Rolle der Schuld in Dostoevskijs "Schuld und Sühne" vor dem Hintergrund der christlichen Lehre
Bachelorarbeit, 2021
34 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gottesgericht
- Todessünde und Offenbarungsgesetz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rolle der Schuld in Dostoevskijs "Schuld und Sühne" im Kontext der christlichen Lehre. Der Fokus liegt auf der inneren Entwicklung des Protagonisten Rodion Raskolnikov und dem Vergleich mit christlicher Praxis, basierend auf der eschatologischen Theorie von Thurneysen und Barth.
- Raskolnikovs Schuld und seine daraus resultierende Krise
- Das Sakrament der Beichte (Bekehrung, Buße, Absolution) im Roman
- Die Darstellung der Auferstehung in Raskolnikovs Entwicklung
- Der Vergleich zwischen Raskolnikovs Entwicklung und der christlichen Lehre
- Die Reflexion der christlichen Lehre in Dostoevskijs Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse der Schuld aus christlicher Perspektive anhand von Raskolnikovs Entwicklung in Dostoevskijs "Schuld und Sühne". Es wird der Vergleich mit traditioneller christlicher Praxis angekündigt und die methodische Grundlage in der eschatologischen Theorie von Thurneysen und Barth erläutert. Die zentralen Fragen nach Raskolnikovs Umgang mit Schuld, den Parallelen zu christlicher Lehre und der Reflexion der Lehre im Roman werden formuliert. Die Arbeit konzentriert sich auf die Aspekte Schuld, Beichte und Auferstehung im Kontext der Gott-Mensch-Beziehung.
Gottesgericht: Dieses Kapitel erörtert die eschatologische Perspektive auf das menschliche Leben, basierend auf den Theorien von Thurneysen und Barth. Es wird zwischen Gottes Gericht und Gottes Verheißung unterschieden, wobei das Gottesgericht als eine Krise dargestellt wird, die den Menschen zu seinen Sünden führt und gleichzeitig den Weg zur metaphysischen Transformation ebnet. Die Gottesgerechtigkeit und die Menschengerechtigkeit werden gegenübergestellt, wobei die Gottesgerechtigkeit als Erlösungswille und die Menschengerechtigkeit als sündenverfallene Natur des Menschen definiert werden. Das Kapitel betont, dass Gottes Gericht nicht Vernichtung, sondern Aufrichtung des menschlichen Lebens bedeutet und letztendlich zur Liebe führt.
Todessünde und Offenbarungsgesetz: Dieses Kapitel definiert Sünde nach Barth als Abwendung von Gott und Zerstörung der Verbindung zu ihm. Es analysiert die Rolle des Hochmuts als Wurzel aller Sünden, die zum Verfallen des Daseins führt. Das Offenbarungsgesetz wird als Ausweg aus dieser Situation gesehen, als ein Ort, an dem der Mensch durch ein höheres Bewusstsein seine Sünde erkennt. Das Johannes-Evangelium wird zitiert, um das Licht als Symbol für die Wahrheit und die Erkenntnis der Sünde zu verdeutlichen, während die Finsternis die sündhafte Natur des Menschen symbolisiert. Der Fokus liegt auf dem Prozess der Erkenntnis und der Möglichkeit der Erlösung, trotz der Sünde.
Schlüsselwörter
Schuld, Dostojewski, Schuld und Sühne, Christliche Lehre, Raskolnikov, Eschatologie, Gottesgericht, Todessünde, Offenbarungsgesetz, Beichte, Buße, Absolution, Auferstehung, Gottesgerechtigkeit, Menschengerechtigkeit, Thurneysen, Barth.
Häufig gestellte Fragen zu "Schuld und Sühne" - Dostojewskij im Kontext christlicher Lehre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Dostojewskijs Roman "Schuld und Sühne" unter dem Aspekt der christlichen Lehre. Im Mittelpunkt steht die innere Entwicklung des Protagonisten Rodion Raskolnikov und deren Vergleich mit christlicher Praxis, insbesondere im Hinblick auf Schuld, Beichte, Buße, Absolution und Auferstehung. Die eschatologische Theorie von Thurneysen und Barth dient als methodische Grundlage.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der Schuld in Raskolnikovs Leben, seine daraus resultierende Krise und den möglichen Weg zur Erlösung. Es wird der Vergleich zwischen Raskolnikovs Entwicklung und der christlichen Lehre gezogen, insbesondere im Kontext des Gottesgerichts, der Todsünde, des Offenbarungsgesetzes, und der Sakramente der Beichte und Buße. Die Darstellung der Auferstehung in Raskolnikovs Entwicklung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche methodische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die eschatologische Theorie von Eduard Thurneysen und Karl Barth, um die Konzepte von Gottesgericht, Gottesgerechtigkeit und Menschengerechtigkeit zu verstehen und auf Raskolnikovs Entwicklung anzuwenden. Die Interpretation von Sünde und Erlösung erfolgt im Kontext dieser Theorie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, die die Zielsetzung und den methodischen Ansatz beschreibt. Es folgen Kapitel zu den Themen Gottesgericht, Todsünde und Offenbarungsgesetz. Jedes Kapitel analysiert spezifische Aspekte des Romans im Lichte der christlichen Lehre und der eschatologischen Theorie. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Schlüsselbegriffen.
Welche Rolle spielt das Gottesgericht?
Das Gottesgericht wird als eine existenzielle Krise dargestellt, die Raskolnikov mit seinen Sünden konfrontiert. Es wird jedoch nicht als bloße Vernichtung, sondern als Möglichkeit zur metaphysischen Transformation und letztendlich zur Liebe verstanden. Die Arbeit differenziert zwischen Gottes Gericht und Gottes Verheißung.
Wie wird Sünde definiert?
Sünde wird nach Barth als Abwendung von Gott und Zerstörung der Verbindung zu ihm definiert. Hochmut wird als Wurzel aller Sünden betrachtet. Das Offenbarungsgesetz wird als Möglichkeit dargestellt, diese Sünde zu erkennen und einen Weg zur Erlösung zu finden.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Schuld, Dostojewskij, Schuld und Sühne, Christliche Lehre, Raskolnikov, Eschatologie, Gottesgericht, Todsünde, Offenbarungsgesetz, Beichte, Buße, Absolution, Auferstehung, Gottesgerechtigkeit, Menschengerechtigkeit, Thurneysen, und Barth.
Welche Rolle spielt die Beichte im Roman?
Die Arbeit untersucht das Sakrament der Beichte (inklusive Bekehrung, Buße und Absolution) im Roman "Schuld und Sühne" und analysiert, wie es sich in Raskolnikovs Entwicklung manifestiert und mit der christlichen Lehre korreliert.
Welche Parallelen werden zwischen Raskolnikovs Entwicklung und der christlichen Lehre gezogen?
Die Arbeit zieht umfassende Parallelen zwischen Raskolnikovs innerer Entwicklung, seinem Umgang mit Schuld und Reue, und den zentralen Konzepten der christlichen Lehre über Sünde, Buße, Vergebung und Erlösung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit Dostojewskijs Werk und dessen theologischen Implikationen auseinandersetzen möchte. Sie ist insbesondere für Studierende der Literaturwissenschaft, Theologie und Philosophie relevant.
Details
- Titel
- Zur Rolle der Schuld in Dostoevskijs "Schuld und Sühne" vor dem Hintergrund der christlichen Lehre
- Hochschule
- Universität Hamburg (Slawistik)
- Note
- 1,3
- Autor
- Katarina Macova (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 34
- Katalognummer
- V1128814
- ISBN (eBook)
- 9783346488732
- ISBN (Buch)
- 9783346488749
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Dostoevskij Schuld Christentum Beichte
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Katarina Macova (Autor:in), 2021, Zur Rolle der Schuld in Dostoevskijs "Schuld und Sühne" vor dem Hintergrund der christlichen Lehre, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1128814
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-