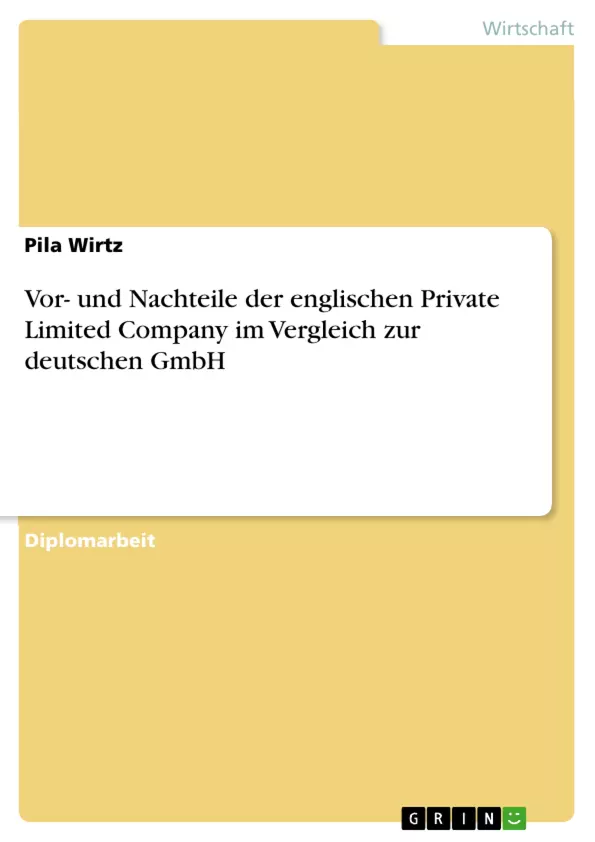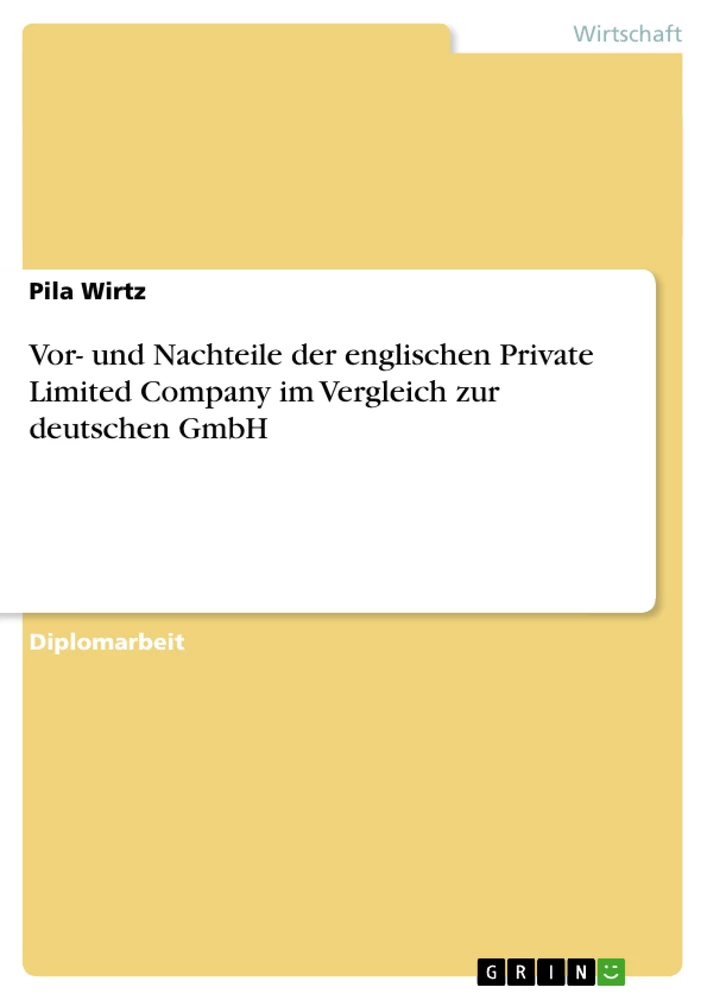
Vor- und Nachteile der englischen Private Limited Company im Vergleich zur deutschen GmbH
Diplomarbeit, 2004
83 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- A. Problemstellung
- B. Deutsches Gesellschaftsrecht vs. Europäisches Gemeinschaftsrecht
- I. Die Niederlassungsfreiheit
- 1. Allgemeines
- 2. Ausübungsformen der Niederlassungsfreiheit
- II. Sitztheorie
- III. Gründungstheorie
- VI. Die Rechtsprechung des EuGH zur Niederlassungsfreiheit
- 1. Daily Mail (1988)
- 2. Centros (1999)
- 3. Überseering (2002)
- 4. Inspire Art (2003)
- I. Die Niederlassungsfreiheit
- C. Die rechtlichen Grundlagen der zu vergleichenden Gesellschaftsformen
- I. Deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- 1. Die Rechtsnatur der GmbH
- 2. Die Kapitalausstattung
- 3. Der Gründungsvorgang
- 4. Der Gesellschaftsvertrag
- 5. Die Rechts- und Haftungsverhältnisse vor Entstehung der Gesellschaft
- a) Die Vorgründungsgesellschaft
- b) Die Vorgesellschaft
- c) Die GmbH als juristische Person
- 6. Die Organisationsverfassung
- a) Die Geschäftsführer
- b) Die Gesellschafter
- c) Der Aufsichtsrat
- d) Der Abschlussprüfer
- 7. Die Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung
- a) Kapitalaufbringung
- b) Kapitalerhaltung
- aa) Keine Auszahlung des Gesellschaftsvermögens
- bb) Rückgewähr eigenkapitalersetzender Gesellschafterdarlehen
- cc) Erstattung zurückgezahlter Darlehen
- dd) Erwerb eigener Geschäftsanteile
- ee) Kapitalherabsetzung
- 8. Die steuerliche Behandlung
- a) Persönliche Steuerpflicht
- b) Sachliche Steuerpflicht
- 9. Die Haftung
- a) Die Haftung der Geschäftsführer
- b) Haftung der Gesellschafter
- 10. Die Auflösung der Gesellschaft/ Insolvenzverfahren
- II. Die englische Private Limited Company
- 1. Die Rechtsnatur der Private Limited Company
- 2. Die Kapitalausstattung
- 3. Der Gründungsvorgang
- 4. Der Gesellschaftsvertrag
- a) Das „memorandum of association“
- b) Die „articles of association“
- 5. Die Rechts- und Haftungsverhältnisse vor Entstehung der Gesellschaft
- 6. Die Organisationsverfassung
- a) Das Direktorium („board of directors“)
- b) Die Gesellschafter/ Hauptversammlung („general meeting“)
- c) Der Sekretär („company secretary“)
- d) Der Abschlussprüfer („auditor“)
- e) Die staatliche Kontrolle
- aa) Untersuchung durch Inspektoren
- bb) Untersuchung von Dokumenten der Gesellschaft
- 7. Die Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung
- a) Kapitalaufbringung
- b) Kapitalerhaltung
- aa) Kapitalherabsetzung
- bb) Erwerb eigener Anteile
- cc) „financial assistance“
- dd) Gewinnausschüttung
- 8. Die steuerliche Behandlung
- a) Persönliche Steuerpflicht
- b) Sachliche Steuerpflicht
- 9. Die Haftung der „directors“
- 10. Die Auflösung der Gesellschaft
- D. Vergleich der Unterschiede beider Rechtsformen unter Einbeziehung ökonomischer Gesichtspunkte
- I. Vorteile bei der Verwendung einer Private Limited Company
- 1. Keine Mindeststammkapitalaufbringung
- 2. Keine Mitbestimmung
- 3. Keine notarielle Beurkundung bei Anteilsübertragungen
- II. Risiken und Nachteile bei der Verwendung einer Private Limited Company
- 1. Anerkennung der Rechtsform im Geschäftsverkehr
- 2. Sprachliches Verständnis
- 3. Handlungsfähigkeit vor Eintragung ins Handelsregister
- 4. Gründungsvorgang /Kosten der Gründung und der laufenden Verwaltung
- 5. Zusätzlicher Aufwand bei Errichtung einer Zweigniederlassung
- 6. Organisationsverfassung und rechtliche Komplexität
- 7. Kapitalaufbringung /Kapitalerhaltung
- 8. Haftung der Geschäftsführer
- 9. Insolvenz
- 10. Besteuerung der Körperschaften
- 11. Haftungsrisiken für Rechts- und Steuerberater
- I. Vorteile bei der Verwendung einer Private Limited Company
- E. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Vergleich der englischen Private Limited Company und der deutschen GmbH. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile beider Rechtsformen aufzuzeigen und somit Entscheidungshilfe für Unternehmen zu bieten, die sich für eine internationale Expansion entscheiden. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen beider Gesellschaftsformen und beleuchtet die Unterschiede in Bezug auf Gründung, Organisation, Kapitalaufbringung, Haftung und Steuerrecht. Darüber hinaus werden ökonomische Gesichtspunkte berücksichtigt, um die praktische Relevanz des Vergleichs zu unterstreichen.
- Niederlassungsfreiheit im europäischen Gemeinschaftsrecht
- Rechtliche Grundlagen der GmbH und der Private Limited Company
- Vergleich der Organisationsstrukturen und der Kapitalaufbringung
- Unterschiede in der Haftung und der steuerlichen Behandlung
- Ökonomische Aspekte und praktische Relevanz des Vergleichs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problemstellung und erläutert die Bedeutung des Vergleichs zwischen der deutschen GmbH und der englischen Private Limited Company im Kontext der internationalen Expansion. Anschließend wird das deutsche Gesellschaftsrecht im Verhältnis zum europäischen Gemeinschaftsrecht beleuchtet, wobei die Niederlassungsfreiheit und die Rechtsprechung des EuGH im Fokus stehen.
Im nächsten Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen der GmbH und der Private Limited Company detailliert dargestellt. Hierbei werden die Rechtsnatur, die Kapitalausstattung, der Gründungsvorgang, der Gesellschaftsvertrag, die Rechts- und Haftungsverhältnisse vor Entstehung der Gesellschaft, die Organisationsverfassung, die Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung, die steuerliche Behandlung, die Haftung und die Auflösung der Gesellschaft/ Insolvenzverfahren analysiert.
Im darauffolgenden Kapitel werden die Unterschiede beider Rechtsformen unter Einbeziehung ökonomischer Gesichtspunkte verglichen. Dabei werden die Vorteile und Nachteile der Private Limited Company im Vergleich zur GmbH herausgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Private Limited Company, die GmbH, die Niederlassungsfreiheit, das Gesellschaftsrecht, die Kapitalaufbringung, die Haftung, die steuerliche Behandlung, die internationale Expansion und die ökonomischen Gesichtspunkte. Die Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile beider Rechtsformen und bietet Entscheidungshilfe für Unternehmen, die sich für eine internationale Expansion entscheiden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptvorteil einer englischen Private Limited Company (Ltd.)?
Ein wesentlicher Vorteil ist das Fehlen einer gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitalaufbringung, im Gegensatz zum Stammkapital der deutschen GmbH.
Wie beeinflusst die EU-Niederlassungsfreiheit die Wahl der Rechtsform?
Durch Urteile des EuGH (z.B. Inspire Art) können EU-Gesellschaften ihren Verwaltungssitz in Deutschland haben, ohne die deutsche Rechtsform annehmen zu müssen.
Welche Nachteile hat eine Ltd. bei einer Tätigkeit in Deutschland?
Nachteile sind die geringere Akzeptanz im deutschen Geschäftsverkehr, sprachliche Barrieren und die Komplexität des englischen Gesellschaftsrechts.
Unterscheiden sich GmbH und Ltd. in der steuerlichen Behandlung?
Beide unterliegen der Körperschaftsteuer, wobei die Details je nach Sitz der tatsächlichen Verwaltung und Doppelbesteuerungsabkommen variieren.
Was sind die Risiken für Geschäftsführer einer Ltd.?
Die Haftungsregeln für "directors" sind komplex und können bei Insolvenz oder Pflichtverletzungen zu persönlicher Haftung führen.
- I. Deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Details
- Titel
- Vor- und Nachteile der englischen Private Limited Company im Vergleich zur deutschen GmbH
- Hochschule
- Fachhochschule Gießen-Friedberg; Standort Gießen (Fachbereich Wirtschaft/ Gesellschaftsrecht)
- Veranstaltung
- Diplomabschlussarbeit
- Note
- 1,3
- Autor
- Diplom-Betriebswirtin Pila Wirtz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 83
- Katalognummer
- V113030
- ISBN (eBook)
- 9783640132157
- ISBN (Buch)
- 9783640134717
- Dateigröße
- 695 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Vor- Nachteile Private Limited Company Vergleich GmbH Diplomabschlussarbeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 51,99
- Arbeit zitieren
- Diplom-Betriebswirtin Pila Wirtz (Autor:in), 2004, Vor- und Nachteile der englischen Private Limited Company im Vergleich zur deutschen GmbH , München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/113030
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-