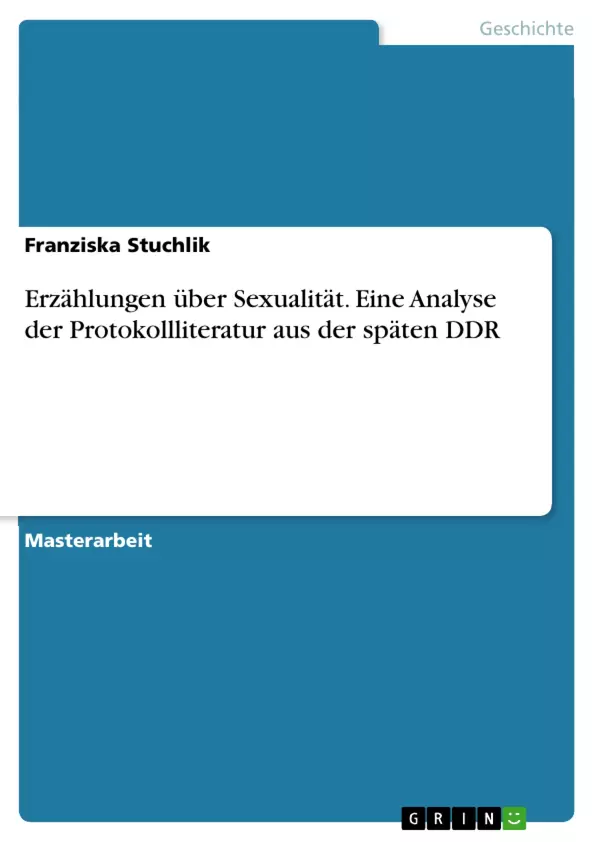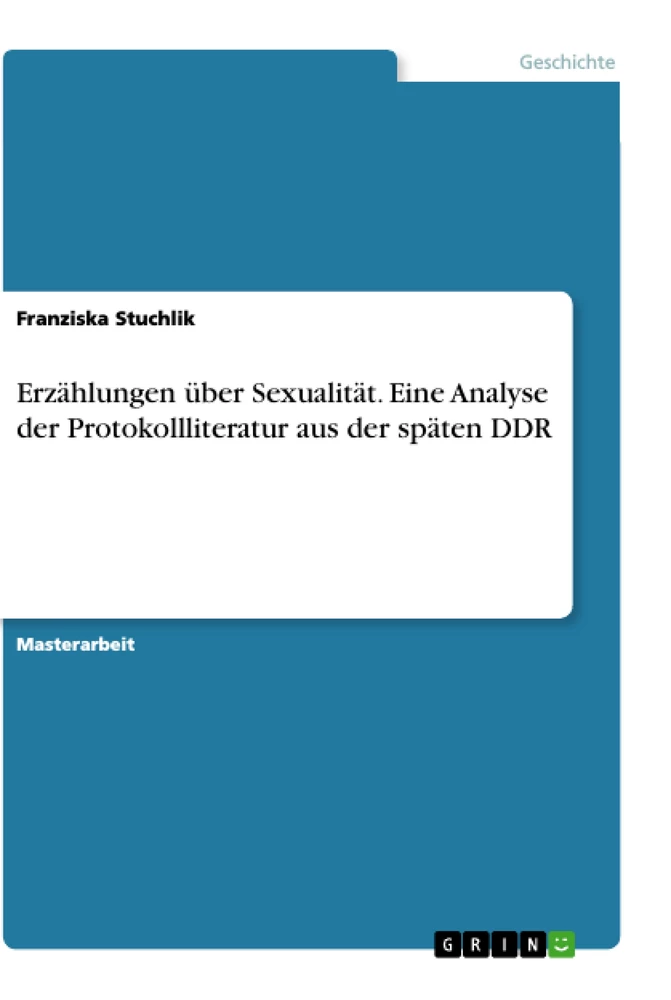
Erzählungen über Sexualität. Eine Analyse der Protokollliteratur aus der späten DDR
Masterarbeit, 2020
115 Seiten, Note: 1,8
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Methodik
- 4. Quellenkritik
- 4.1. Oral History und Protokollliteratur – eine Abgrenzung
- 4.2. Protokollliteratur in der DDR
- 4.3. Kritische Betrachtung der DDR-Protokollliteratur und ihr Mehrwert als historische Quelle
- 4.4. Verwendete Protokollbände
- 4.4.1. Maxie Wander: Guten Morgen, du Schöne (1975, hier 1978²)
- 4.4.2. Christine Müller: Männerprotokolle (1985)
- 4.4.3. Christine Lambrecht: Männerbekanntschaften. Freimütige Protokolle (1986)
- 4.4.4. Jürgen Lemke: Ganz normal anders. Auskünfte schwuler Männer aus der DDR (1989)
- 4.4.5. Kerstin Gutsche: Ich ahnungsloser Engel. Lesbenprotokolle (1991)
- 5. Geschlechtergerechtigkeit in der späten DDR
- 5.1. Geschlechtergerechtigkeit in der DDR – historischer Kontext
- 5.2. Analyse des Datenmaterials – Geschlechtergerechtigkeit
- 5.2.1. Narrative über Weiblichkeit
- 5.2.1.1. Selbstwahrnehmung ihrer Rolle als Frau
- 5.2.1.2. Fremdwahrnehmung der Frauenrollen
- 5.2.2. Narrative über Männlichkeit
- 5.2.2.1. Selbstwahrnehmung der Rolle als Mann
- 5.2.2.2. Fremdwahrnehmung Männlichkeit
- 5.2.3. Narrative über Gleichberechtigung
- 5.2.1. Narrative über Weiblichkeit
- 6. Beziehungsalltag in der späten DDR
- 6.1. Paarbeziehungen in der späten DDR – historischer Kontext
- 6.1.1. Pronatalistische Maßnahmen der DDR-Regierung
- 6.1.2. Eheschließung in der DDR
- 6.1.3. Nichteheliche Lebensgemeinschaften in der DDR
- 6.1.4. Ehescheidungen in der DDR
- 6.2. Analyse des Datenmaterials – Paarbeziehungen
- 6.2.1. Gründungen von Paarbeziehungen
- 6.2.2. Konfliktmanagement in Paarbeziehungen
- 6.2.3. Trennungsverläufe
- 6.1. Paarbeziehungen in der späten DDR – historischer Kontext
- 7. Sexualität in der späten DDR
- 7.1. Sexualmoral und Sexualpolitik im historischen Kontext
- 7.2. Analyse des Datenmaterials - Sexualität
- 7.2.1. Die Aufklärung und „das erste Mal“
- 7.2.2. Narrative über Sexualität
- 8. Homosexualität in der späten DDR
- 8.1. Homosexualität in der DDR – historischer Kontext
- 8.2. Analyse des Datenmaterials - Homosexualität
- 8.2.1. Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung
- 8.2.2. Homophobie in der Gesellschaft
- 9. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Protokollliteratur der späten DDR, um ein tiefergehendes Verständnis von Sexualität, Geschlechterrollen und Beziehungsdynamiken in diesem Kontext zu erlangen. Die Untersuchung fokussiert auf die individuellen Erzählungen und Erfahrungen der Protagonist*innen, um die gesellschaftlichen Normen und Zwänge der Zeit zu beleuchten.
- Geschlechtergerechtigkeit in der späten DDR
- Beziehungsalltag und Paardynamiken in der späten DDR
- Sexualität und Sexualmoral in der späten DDR
- Homosexualität und gesellschaftliche Diskriminierung in der späten DDR
- Die Rolle der Protokollliteratur als historische Quelle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet die Relevanz des Themas „Sexualität“ im heutigen Diskurs, kontrastiert mit den Erfahrungen in der späten DDR. Ein Zitat von Rosi verdeutlicht die Komplexität sexueller Erfahrungen und die gesellschaftlichen Einflüsse darauf. Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand vor und gibt einen Überblick über die Vorgehensweise der Arbeit.
2. Forschungsstand: Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über den bestehenden Forschungsstand zum Thema Sexualität in der DDR. Es beleuchtet relevante Studien und Theorien und zeigt die Forschungslücke auf, die diese Arbeit zu schließen versucht.
3. Methodik: Hier wird die methodische Vorgehensweise der Arbeit detailliert beschrieben. Die verwendeten Methoden der Quellenanalyse und Dateninterpretation werden erläutert, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
4. Quellenkritik: Dieses Kapitel untersucht kritisch die verwendeten Quellen, insbesondere die Protokollliteratur der DDR. Es wird eine Abgrenzung zu Oral History vorgenommen und der Mehrwert dieser Quellen als historische Zeugnisse diskutiert. Die einzelnen verwendeten Protokollbände werden vorgestellt und ihre spezifischen Merkmale erläutert.
5. Geschlechtergerechtigkeit in der späten DDR: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Geschlechterrollen und Geschlechtergerechtigkeit in der späten DDR anhand der ausgewählten Protokollliteratur. Es untersucht sowohl die Selbst- als auch die Fremdwahrnehmung der Geschlechterrollen und beleuchtet die widersprüchlichen Erwartungen an Frauen und Männer.
6. Beziehungsalltag in der späten DDR: Hier werden Paarbeziehungen in der späten DDR im historischen Kontext beleuchtet. Es werden die staatlichen Maßnahmen und gesellschaftlichen Normen analysiert, die Paarbeziehungen prägten. Die Analyse des Datenmaterials fokussiert auf die Gründung, das Konfliktmanagement und die Trennungsverläufe von Paarbeziehungen.
7. Sexualität in der späten DDR: Dieses Kapitel befasst sich mit der Sexualität in der späten DDR, beginnend mit einem historischen Überblick über Sexualmoral und -politik. Die Analyse der Protokollliteratur untersucht die individuellen Erzählungen über Sexualität, den Umgang mit der Aufklärung und das "erste Mal".
8. Homosexualität in der späten DDR: Das Kapitel analysiert die Situation Homosexueller in der DDR. Es beginnt mit dem historischen Kontext und untersucht anschließend anhand des Datenmaterials den Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung und die allgegenwärtige Homophobie.
Schlüsselwörter
Protokollliteratur, DDR, Sexualität, Geschlechterrollen, Geschlechtergerechtigkeit, Paarbeziehungen, Homosexualität, Homophobie, Oral History, Qualitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Protokollliteratur der späten DDR
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Protokollliteratur der späten DDR, um ein tiefergehendes Verständnis von Sexualität, Geschlechterrollen und Beziehungsdynamiken in diesem Kontext zu erlangen. Der Fokus liegt auf individuellen Erzählungen und Erfahrungen, um gesellschaftliche Normen und Zwänge zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschlechtergerechtigkeit in der späten DDR, den Beziehungsalltag und Paardynamiken, Sexualität und Sexualmoral, Homosexualität und gesellschaftliche Diskriminierung sowie die Rolle der Protokollliteratur als historische Quelle.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert hauptsächlich auf der Protokollliteratur der späten DDR. Genannt werden u.a. Werke von Maxie Wander, Christine Müller, Christine Lambrecht, Jürgen Lemke und Kerstin Gutsche. Das Kapitel "Quellenkritik" vergleicht Protokollliteratur mit Oral History und analysiert den Mehrwert dieser Quellen als historische Zeugnisse.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die methodische Vorgehensweise, einschließlich der Quellenanalyse und Dateninterpretation, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Die genaue Methode wird im Kapitel "Methodik" erläutert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Forschungsstand, Methodik, Quellenkritik, Geschlechtergerechtigkeit in der späten DDR, Beziehungsalltag in der späten DDR, Sexualität in der späten DDR, Homosexualität in der späten DDR und Fazit/Ausblick. Jedes Kapitel wird im HTML-Dokument mit einer Zusammenfassung versehen.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Die konkreten Ergebnisse der Analyse der Protokollliteratur werden in den Kapiteln 5-8 dargestellt. Diese Kapitel untersuchen Geschlechterrollen, Paarbeziehungen, Sexualität und Homosexualität in der späten DDR anhand der individuellen Erzählungen der Protagonist*innen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen und ein Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen werden im Kapitel 9 ("Fazit und Ausblick") zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Protokollliteratur, DDR, Sexualität, Geschlechterrollen, Geschlechtergerechtigkeit, Paarbeziehungen, Homosexualität, Homophobie, Oral History, Qualitative Inhaltsanalyse.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler*innen, Studierende und alle Interessierten, die sich mit der Geschichte der DDR, Geschlechterverhältnissen, Sexualität und der Analyse von qualitativen Quellen auseinandersetzen.
Details
- Titel
- Erzählungen über Sexualität. Eine Analyse der Protokollliteratur aus der späten DDR
- Hochschule
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Geschichte)
- Veranstaltung
- -
- Note
- 1,8
- Autor
- Franziska Stuchlik (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 115
- Katalognummer
- V1132052
- ISBN (eBook)
- 9783346499288
- ISBN (Buch)
- 9783346499295
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Sexualität Deutsche Demokratische Republik Homosexualität Ehe
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Franziska Stuchlik (Autor:in), 2020, Erzählungen über Sexualität. Eine Analyse der Protokollliteratur aus der späten DDR, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1132052
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-