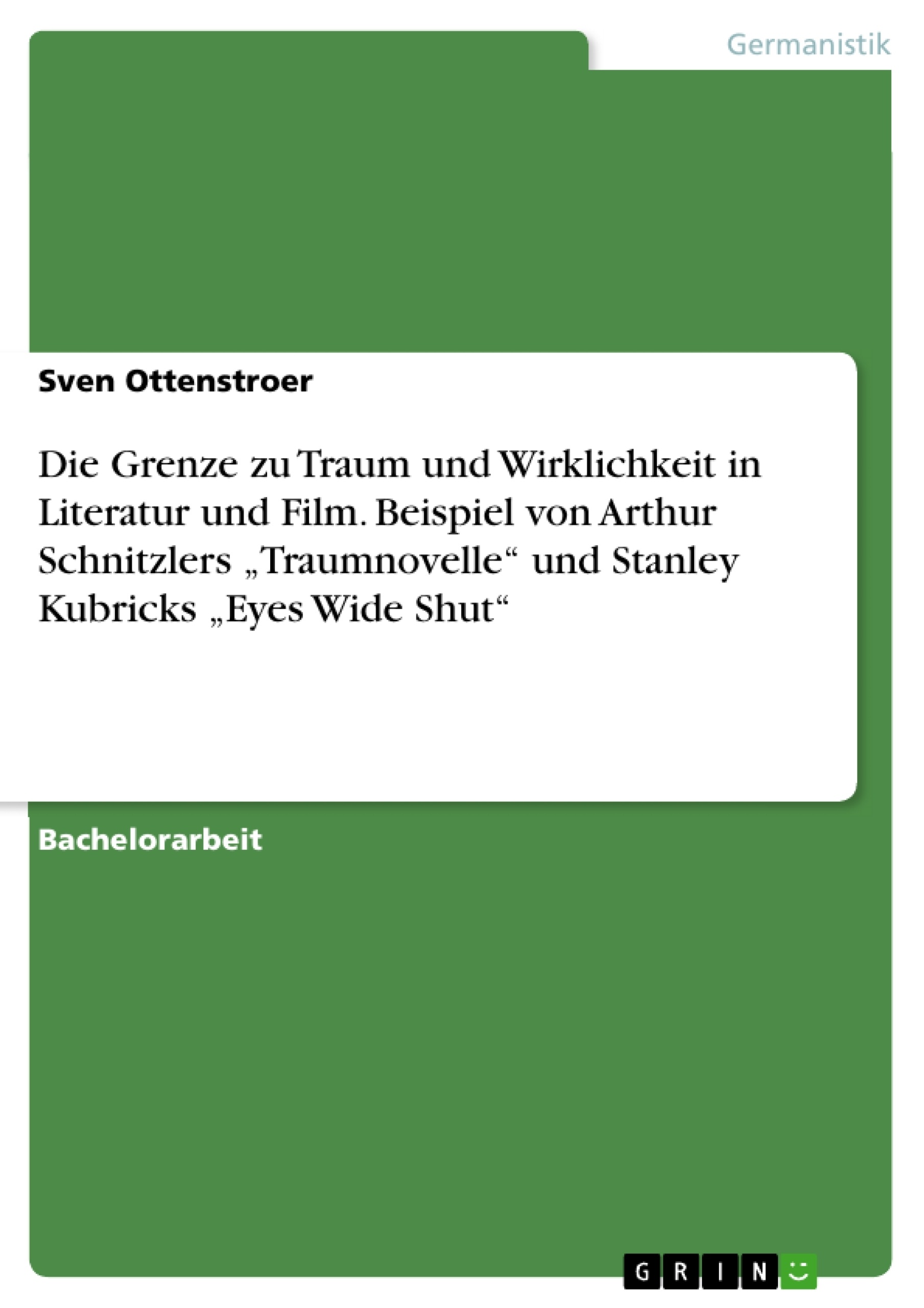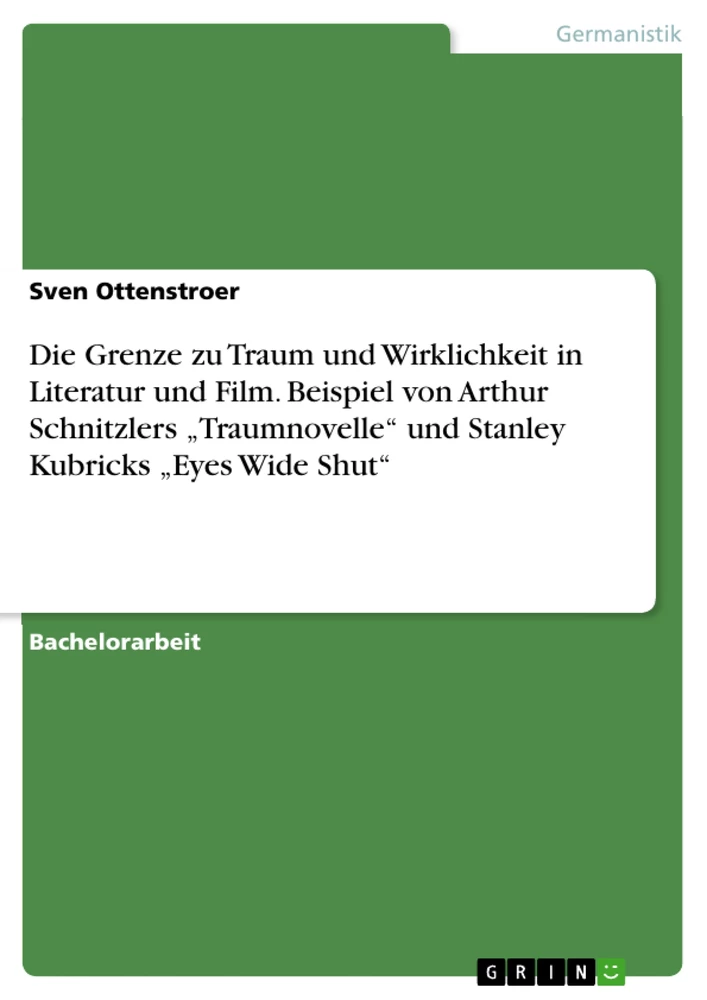
Die Grenze zu Traum und Wirklichkeit in Literatur und Film. Beispiel von Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ und Stanley Kubricks „Eyes Wide Shut“
Bachelorarbeit, 2019
49 Seiten, Note: 2,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Motivation
- Kulturgeschichtlicher Hintergrund
- Schnitzler und die Psychoanalyse
- Freud und Kubrick
- Theoretischer Hintergrund
- Intermedialität
- Probleme der Intermedialität
- Hauptteil und Analyse
- Rhetorische Mittel
- Metaphorik
- Ekphrasis
- Einführung in die Literatur und Hinführung zur Szene
- Fridolins Odyssee durch das nächtliche Wien - Schnitzler
- Fridolins Odyssee durch das nächtliche New York - Kubrick
- Der geheime Maskenball - Schnitzler
- Der geheime Maskenball - Kubrick
- Die Ballmaske und die Auflösung des Konflikts - Schnitzler
- Die Ballmaske und die Auflösung des Konflikts – Kubrick
- Zusammenfassung der Analyseergebnisse und Interpretation
- Einbettung in den schulischen Kontext
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die schriftsprachlichen und filmischen Mittel, die Arthur Schnitzler in seiner „Traumnovelle“ und Stanley Kubrick in seiner Verfilmung „Eyes Wide Shut“ verwenden, um den Übergang zwischen Traum und Realität darzustellen. Dabei werden die jeweiligen Auswirkungen auf den Leser/Zuschauer untersucht.
- Der Einfluss von Sigmund Freuds Psychoanalyse auf die Darstellung von Träumen und Sehnsüchten
- Die Verwendung von Metaphern und Ekphrasis zur Schaffung einer verwirrenden und unwirklichen Atmosphäre
- Die Bedeutung der Maske als Symbol für Scham, Verhüllung und das Versteckspiel der eigenen Wünsche
- Der Kontrast zwischen Traum und Realität im Vergleich der beiden Medien: Sprache und Film
- Die didaktische Einsetzbarkeit von „Traumnovelle“ und „Eyes Wide Shut“ im Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung und Motivation stellen die literarische Vorlage und die filmische Adaption von Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ vor. Der kulturhistorische Hintergrund beleuchtet das Wien des 19. Jahrhunderts und die Entstehung der Psychoanalyse durch Sigmund Freud sowie dessen Einfluss auf Schnitzlers Werk. Der theoretische Teil definiert den Begriff der Intermedialität und beschreibt die Besonderheiten einer Literaturverfilmung. Im Hauptteil werden verschiedene rhetorische Mittel wie Metaphorik und Ekphrasis erläutert und auf die Bedeutung der Maske als Symbol für Scham und Verhüllung eingegangen. Die Kapitel „Fridolins Odyssee durch das nächtliche Wien - Schnitzler“ und „Fridolins Odyssee durch das nächtliche New York - Kubrick“ analysieren die schriftsprachlichen und filmischen Mittel, mit denen der Übergang zwischen Traum und Realität dargestellt wird. Die Kapitel „Der geheime Maskenball - Schnitzler“ und „Der geheime Maskenball - Kubrick“ fokussieren sich auf die Darstellung der Ballmaske und die Auswirkungen der Maskerade auf den Protagonisten. Die Kapitel „Die Ballmaske und die Auflösung des Konflikts - Schnitzler“ und „Die Ballmaske und die Auflösung des Konflikts – Kubrick“ untersuchen, wie die Maske als Symbol für Scham und Verhüllung zum Wendepunkt in der Beziehung zwischen Fridolin und Albertine führt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „Traum“, „Realität“, „Maskerade“, „Scham“, „Intermedialität“, „Psychoanalyse“, „Metapher“, „Ekphrasis“ und „Literaturverfilmung“ im Kontext von Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ und Stanley Kubricks „Eyes Wide Shut“. Darüber hinaus wird die didaktische Einsetzbarkeit beider Medien im Deutschunterricht der Oberstufe beleuchtet.
Details
- Titel
- Die Grenze zu Traum und Wirklichkeit in Literatur und Film. Beispiel von Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ und Stanley Kubricks „Eyes Wide Shut“
- Hochschule
- Universität Paderborn
- Note
- 2,7
- Autor
- Sven Ottenstroer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V1139134
- ISBN (eBook)
- 9783346513182
- ISBN (Buch)
- 9783346513199
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- grenze traum wirklichkeit literatur film beispiel arthur schnitzlers traumnovelle stanley kubricks eyes wide shut
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Sven Ottenstroer (Autor:in), 2019, Die Grenze zu Traum und Wirklichkeit in Literatur und Film. Beispiel von Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ und Stanley Kubricks „Eyes Wide Shut“, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1139134
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-