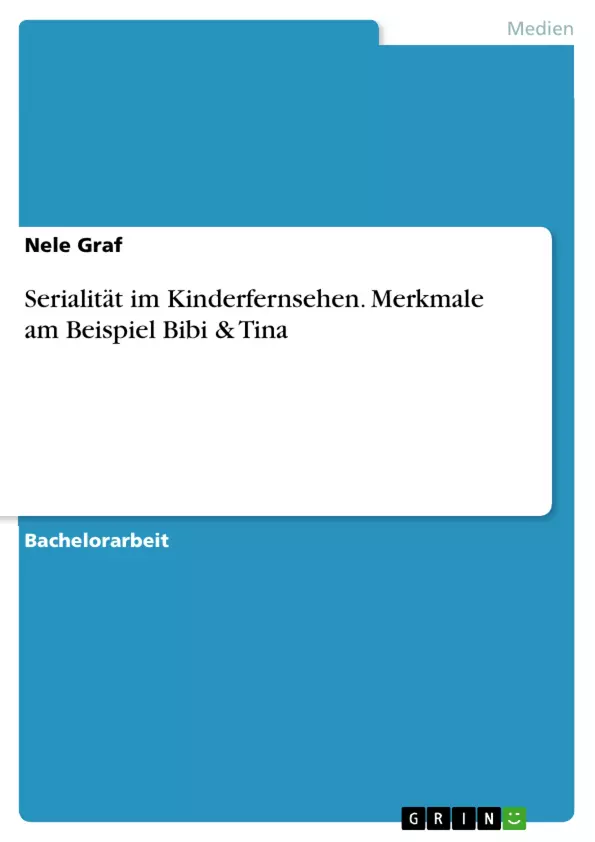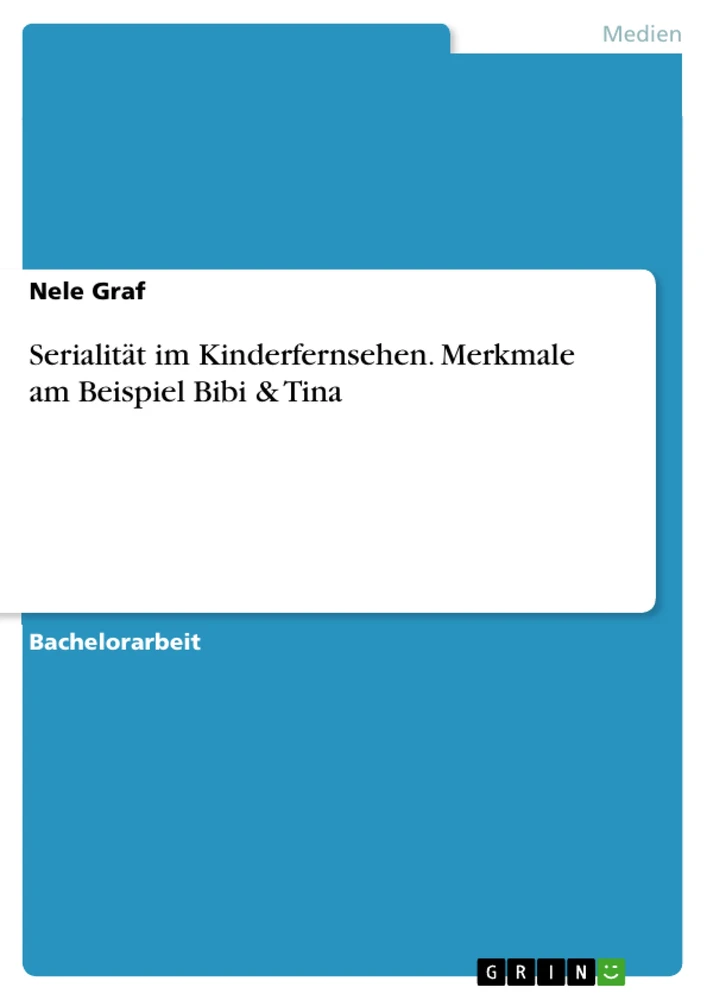
Serialität im Kinderfernsehen. Merkmale am Beispiel Bibi & Tina
Bachelorarbeit, 2019
38 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Kinderfernsehen und Wirkung
- Pädagogischer Aspekt
- Negativer Aspekt von Fernsehen
- Geschlechterspezifisches Fernsehen
- Merkmale von Serialität am Beispiel von Bibi und Tina
- Serielle Organisation
- Genre
- Intro
- Farbgebung
- Wiederholung und Stagnation
- Adaption
- Cliffhanger
- Pilot
- Outro
- Merchandising und Kinofilme
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Serialität im Kinderfernsehen, genauer mit dem Zeichentrickformat Bibi und Tina. Sie analysiert die Merkmale von Serialität anhand des Beispiels und untersucht, wie diese in der Zielgruppe der Kinder wirken.
- Definition und Merkmale von Serialität
- Analyse von Bibi und Tina als Beispiel für eine Kinderserie
- Die Wirkung von Kinderfernsehen und die Rolle der Medienerziehung
- Geschlechterspezifische Aspekte im Kinderfernsehen
- Der Einfluss von Merchandising und Kinofilmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema Serialität im Kinderfernsehen ein und erläutert den Stellenwert des Fernsehens im Alltag von Heranwachsenden.
- Der theoretische Rahmen definiert den Begriff „Serie“ und die Eigenschaften des seriellen Erzählens.
- Das Kapitel "Kinderfernsehen und Wirkung" beleuchtet die pädagogischen Aspekte von Kinderfernsehen, die negativen Auswirkungen und die geschlechtsspezifischen Merkmale von Sendungen.
- Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Bibi und Tina. Das Kapitel beschreibt die seriellen Strukturen der Serie, das Genre, die Gestaltung von Intro und Outro und untersucht die Rolle von Wiederholungen, Adaptionen und Cliffhangern.
- Das Kapitel "Merchandising und Kinofilme" befasst sich mit der kommerziellen Verwertung der Serie.
Schlüsselwörter
Kinderfernsehen, Serialität, Bibi und Tina, Medienerziehung, Geschlechterrollen, Genre, Narrativ, Fernsehwirkung, Merchandising, Kinofilme.
Details
- Titel
- Serialität im Kinderfernsehen. Merkmale am Beispiel Bibi & Tina
- Hochschule
- Universität Regensburg
- Note
- 2,3
- Autor
- Nele Graf (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 38
- Katalognummer
- V1154299
- ISBN (Buch)
- 9783346554659
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- serialität kinderfernsehen merkmale beispiel bibi tina
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Nele Graf (Autor:in), 2019, Serialität im Kinderfernsehen. Merkmale am Beispiel Bibi & Tina, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1154299
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-