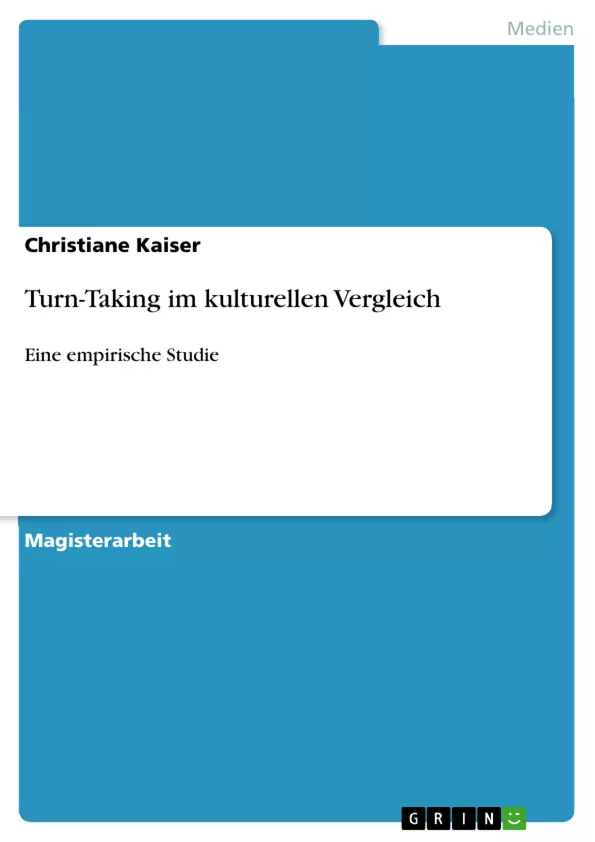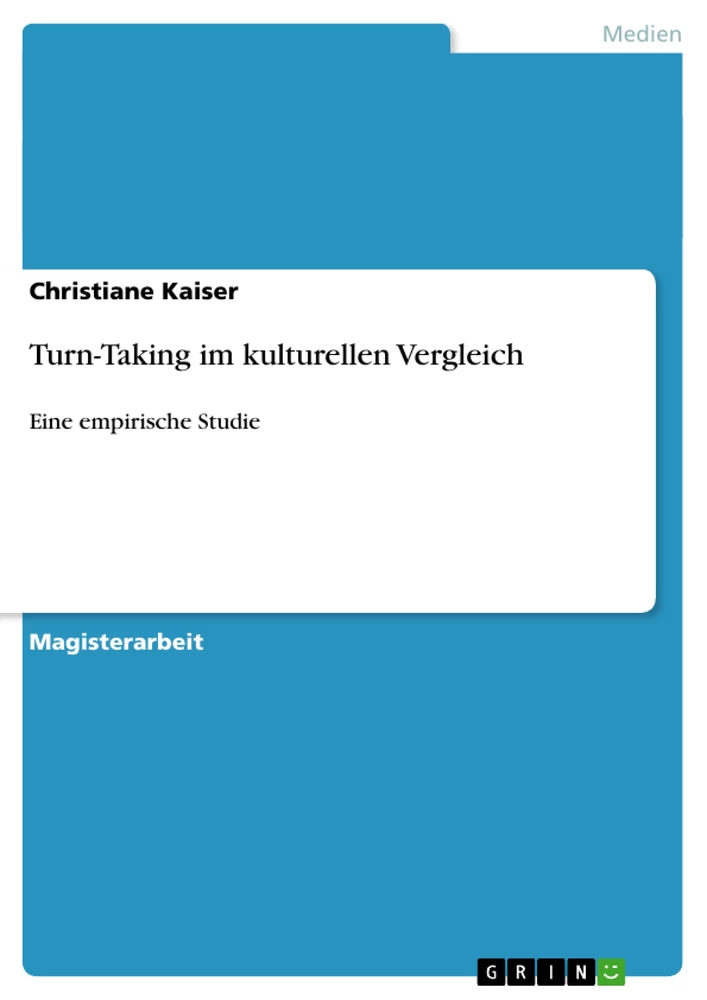
Turn-Taking im kulturellen Vergleich
Magisterarbeit, 2008
94 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kommunikationswissenschaftlicher Aspekt
- 3. Konversationsanalyse
- 4. Begriffserklärung
- 4.1 Kommunikation
- 4.2 Alltagsgespräche
- 4.3 Turn-Taking
- 5. Funktionsweise des Turn-Taking
- 5.1 Turn-Bildung durch die Vier-Felder-Lehre von Karl Bühler
- 5.2 Merkmale des Turn-Taking
- 5.3 Rule-Set
- 5.4 Intonation
- 5.5 Nonverbale Äußerungen
- 5.6 Konsequenzen
- 6. Funktionsstörungen des Turn-Taking
- 6.1 Unterbrechungen
- 6.2 Unproblematische Typen des Overlaps
- 6.3 Problematische Typen des Overlaps
- 6.4 Ablauf eines Overlaps
- 6.5 Auflösung eines Overlaps
- 7. Reparatur-Mechanismen des Turn-Taking
- 8. Datenmaterial
- 8.1 Kriterien zur Auswahl des Datenmaterials
- 8.2 Beschreibung des Datenmaterials
- 9. Transkriptionssystem: Transana
- 10. Untersuchungsergebnisse für Deutschland
- 10.1 Turns
- 10.1.1 Anzahl der Turns
- 10.1.2 Länge der Turns
- 10.2 Turn-Taking
- 10.2.1 Rule-Set
- 10.2.2 Turneinleitende Floskeln
- 10.3 Pausen
- 10.4 Intonation
- 10.5 Nonverbale Merkmale
- 10.5.1 Mimik
- 10.5.2 Gestik
- 10.5.3 Körperpositur
- 10.6 Funktionsstörungen
- 10.6.1 Anzahl der Overlaps
- 10.6.2 Art der Overlaps
- 10.6.3 Ort der Overlaps
- 10.6.4 Dauer der Overlaps
- 10.7 Reparatur-Mechanismen
- 10.1 Turns
- 11. Untersuchungsergebnisse für Großbritannien
- 11.1 Turns
- 11.1.1 Anzahl der Turns
- 11.1.2 Länge der Turns
- 11.2 Turn-Taking
- 11.2.1 Rule-Set
- 11.2.2 Turneinleitende Floskeln
- 11.3 Pausen
- 11.4 Intonation
- 11.5 Nonverbale Merkmale
- 11.5.1 Mimik
- 11.5.2 Gestik
- 11.5.3 Körperpositur
- 11.6 Funktionsstörungen
- 11.6.1 Anzahl der Overlaps
- 11.6.2 Art der Overlaps
- 11.6.3 Ort der Overlaps
- 11.6.4 Dauer der Overlaps
- 11.7 Reparatur-Mechanismen
- 11.1 Turns
- 12. Vergleich Deutschland und Großbritannien
- 12.1 Turns
- 12.1.1 Anzahl der Turns
- 12.1.2 Länge der Turns
- 12.2 Turn-Taking
- 12.2.1 Rule-Set
- 12.2.2 Turneinleitende Floskeln
- 12.3 Pausen
- 12.4 Intonation
- 12.5 Nonverbale Merkmale
- 12.5.1 Mimik
- 12.5.2 Gestik
- 12.5.3 Körperpositur
- 12.6 Funktionsstörungen
- 12.6.1 Anzahl der Overlaps
- 12.6.2 Art der Overlaps
- 12.6.3 Ort der Overlaps
- 12.6.4 Dauer der Overlaps
- 12.7 Reparatur-Mechanismen
- 12.1 Turns
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den kulturellen Vergleich von Turn-Taking in Alltagsgesprächen. Ziel ist es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Ablauf von Gesprächsbeiträgen zwischen deutschen und britischen Gesprächspartnern aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert die Funktionsweise, Störungen und Reparaturmechanismen von Turn-Taking unter Berücksichtigung nonverbaler Kommunikation.
- Kulturelle Unterschiede im Turn-Taking
- Analyse der Funktionsweise von Turn-Taking
- Untersuchung von Funktionsstörungen (z.B. Overlaps, Unterbrechungen)
- Bedeutung nonverbaler Kommunikation für Turn-Taking
- Vergleich der Reparaturmechanismen in beiden Sprachkulturen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Magisterarbeit ein und beschreibt die Forschungsfrage und die Methodik. Es wird der Rahmen der Arbeit abgesteckt und die Relevanz des Themas im Kontext der Kommunikationswissenschaft hervorgehoben. Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den kulturellen Unterschieden im Turn-Taking zwischen Deutschland und Großbritannien vor und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
2. Kommunikationswissenschaftlicher Aspekt: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Kommunikationswissenschaft, der für die Untersuchung des Turn-Taking relevant ist. Es werden grundlegende Konzepte der Kommunikationswissenschaft eingeführt und deren Bedeutung für die Analyse von Alltagsgesprächen erläutert. Der Fokus liegt auf dem theoretischen Fundament, das für die spätere empirische Analyse unerlässlich ist. Es werden verschiedene Ansätze der Kommunikationswissenschaft vorgestellt und ihre jeweiligen Beiträge zum Verständnis von Turn-Taking diskutiert.
3. Konversationsanalyse: Kapitel 3 beschreibt die Konversationsanalyse als methodischen Ansatz für die Untersuchung des Turn-Taking. Es wird die Bedeutung und der methodische Zugang der Konversationsanalyse für die Analyse von gesprochenen Interaktionen im Detail dargestellt. Die relevanten theoretischen Grundlagen und methodischen Vorgehensweisen werden erläutert, um die spätere Analyse der Daten zu untermauern. Es wird die Eignung dieser Methode für den interkulturellen Vergleich herausgestellt.
4. Begriffserklärung: In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe der Arbeit, wie Kommunikation, Alltagsgespräche und Turn-Taking, präzise definiert und voneinander abgegrenzt. Eine klare Begriffsbestimmung bildet die Grundlage für eine präzise und nachvollziehbare Analyse. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Begriffe beleuchtet und eine Arbeitsdefinition für den Kontext dieser Studie formuliert, um etwaige Missverständnisse zu vermeiden.
5. Funktionsweise des Turn-Taking: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Funktionsweise des Turn-Taking, unter Einbezug der Vier-Felder-Lehre von Karl Bühler und der Beschreibung von Merkmalen wie dem Rule-Set, Intonation und nonverbalen Äußerungen. Die Bedeutung jedes einzelnen Elements für den reibungslosen Ablauf eines Gesprächs wird analysiert und durch Beispiele illustriert. Es wird gezeigt, wie die verschiedenen Komponenten zusammenwirken, um einen geordneten Turn-Taking Prozess zu gewährleisten.
6. Funktionsstörungen des Turn-Taking: Hier werden verschiedene Arten von Funktionsstörungen im Turn-Taking, wie Unterbrechungen und Overlaps, analysiert. Es wird zwischen unproblematischen und problematischen Typen von Overlaps differenziert und der Ablauf sowie die Auflösung solcher Störungen untersucht. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Mustern und den Auswirkungen dieser Störungen auf den Gesprächsverlauf. Es werden konkrete Beispiele aus dem Datenmaterial analysiert, um die verschiedenen Arten von Funktionsstörungen zu verdeutlichen.
7. Reparatur-Mechanismen des Turn-Taking: Dieses Kapitel befasst sich mit den Mechanismen, die eingesetzt werden, um Störungen im Turn-Taking zu beheben und den Gesprächsablauf wiederherzustellen. Es werden verschiedene Reparaturstrategien detailliert beschrieben und deren Effektivität analysiert. Der Fokus liegt darauf, wie Sprecher und Hörer gemeinsam an der Reparatur von Störungen arbeiten, um eine reibungslose Kommunikation sicherzustellen. Es wird untersucht, wie diese Mechanismen in den untersuchten Kulturen angewendet und variieren.
8. Datenmaterial: Kapitel 8 beschreibt detailliert das verwendete Datenmaterial für die empirische Untersuchung. Es werden die Kriterien zur Auswahl des Materials erläutert und das Material selbst hinsichtlich Umfang und Zusammensetzung beschrieben. Die Auswahl der Daten wird transparent und nachvollziehbar dargestellt, um die Validität der Untersuchung zu gewährleisten. Die Begründung der Auswahl des Datenmaterials ist ausschlaggebend für die Interpretation der Ergebnisse.
9. Transkriptionssystem: Transana: Dieses Kapitel erklärt das verwendete Transkriptionssystem Transana und seine Funktionen. Es wird detailliert beschrieben, wie das System eingesetzt wurde, um das Datenmaterial zu transkribieren und zu analysieren. Die Wahl des Systems wird begründet, und seine Eignung für die jeweilige Fragestellung wird hervorgehoben. Es werden die wichtigsten Funktionen von Transana erklärt, die für die Analyse des Turn-Taking relevant sind.
Schlüsselwörter
Turn-Taking, Konversationsanalyse, interkultureller Vergleich, Alltagsgespräche, Deutschland, Großbritannien, Nonverbale Kommunikation, Funktionsstörungen, Reparaturmechanismen, empirische Studie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Kultureller Vergleich von Turn-Taking in Alltagsgesprächen
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den kulturellen Vergleich von Turn-Taking in Alltagsgesprächen zwischen deutschen und britischen Gesprächspartnern. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten im Ablauf von Gesprächsbeiträgen, der Funktionsweise, Störungen und Reparaturmechanismen von Turn-Taking, unter Berücksichtigung nonverbaler Kommunikation.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Wie unterscheiden sich das Turn-Taking in Alltagsgesprächen zwischen deutschen und britischen Gesprächspartnern? Zusätzlich werden Fragen nach der Funktionsweise, Störungen (z.B. Overlaps, Unterbrechungen) und den Reparaturmechanismen von Turn-Taking untersucht. Die Rolle nonverbaler Kommunikation wird ebenfalls analysiert.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet die Konversationsanalyse als methodischen Ansatz. Das Datenmaterial wird mit dem Transkriptionssystem Transana analysiert. Die Auswahl des Datenmaterials wird detailliert beschrieben und begründet.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien der Kommunikationswissenschaft und der Konversationsanalyse. Das Kapitel "Kommunikationswissenschaftlicher Aspekt" beleuchtet den relevanten theoretischen Hintergrund. Die Vier-Felder-Lehre von Karl Bühler wird im Kontext der Turn-Bildung diskutiert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, kommunikationswissenschaftlicher Aspekt, Konversationsanalyse, Begriffserklärung (Kommunikation, Alltagsgespräche, Turn-Taking), Funktionsweise des Turn-Taking, Funktionsstörungen des Turn-Taking, Reparaturmechanismen, Datenmaterial, Transkriptionssystem Transana, Untersuchungsergebnisse für Deutschland, Untersuchungsergebnisse für Großbritannien, Vergleich Deutschland und Großbritannien, sowie ein Fazit/Schlussfolgerung (implizit).
Was sind die zentralen Begriffe?
Die wichtigsten Begriffe sind: Turn-Taking, Konversationsanalyse, interkultureller Vergleich, Alltagsgespräche, Deutschland, Großbritannien, Nonverbale Kommunikation, Funktionsstörungen (Overlaps, Unterbrechungen), Reparaturmechanismen.
Welche Aspekte des Turn-Taking werden untersucht?
Untersucht werden die Anzahl und Länge der Turns, das Rule-Set, turneinleitende Floskeln, Pausen, Intonation, nonverbale Merkmale (Mimik, Gestik, Körperpositur), Funktionsstörungen (Anzahl, Art, Ort, Dauer von Overlaps), und die Reparaturmechanismen.
Wie wird das Datenmaterial beschrieben?
Kapitel 8 beschreibt detailliert die Kriterien für die Auswahl und die Zusammensetzung des Datenmaterials. Die Auswahl wird transparent und nachvollziehbar dargestellt, um die Validität der Untersuchung zu gewährleisten.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse werden getrennt für Deutschland und Großbritannien präsentiert und anschließend verglichen. Es werden quantitative und qualitative Daten zu den oben genannten Aspekten des Turn-Taking analysiert und gegenübergestellt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Turn-Taking zwischen deutschen und britischen Gesprächspartnern. Die Ergebnisse liefern Erkenntnisse über die Funktionsweise, Störungen und Reparaturmechanismen des Turn-Taking in beiden Sprachkulturen.
Details
- Titel
- Turn-Taking im kulturellen Vergleich
- Untertitel
- Eine empirische Studie
- Hochschule
- Universität Duisburg-Essen
- Note
- 1,3
- Autor
- Christiane Kaiser (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2008
- Seiten
- 94
- Katalognummer
- V115537
- ISBN (eBook)
- 9783640170289
- ISBN (Buch)
- 9783640172597
- Dateigröße
- 1014 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Turn-Taking Vergleich Sprecherwechsel Kommunikationswissenschaft Gesprächsuntersuchungen Linguistik Magisterarbeit Schegloff Alltagsgespräche Kulturell International Sacks Jefferson Deutschland Großbritannien
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Christiane Kaiser (Autor:in), 2008, Turn-Taking im kulturellen Vergleich, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/115537
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-