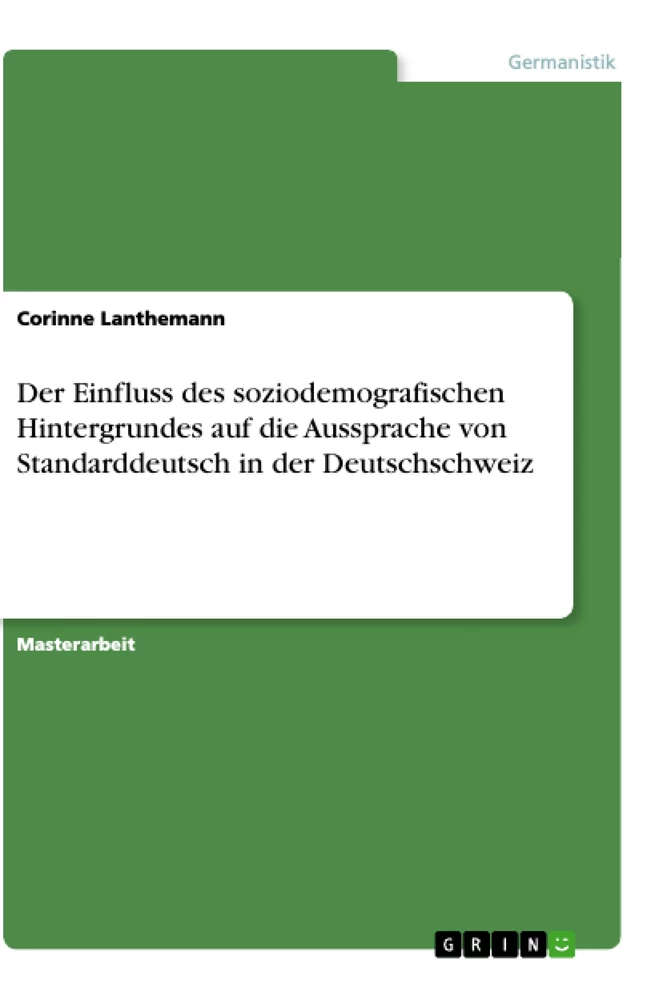
Der Einfluss des soziodemografischen Hintergrundes auf die Aussprache von Standarddeutsch in der Deutschschweiz
Masterarbeit, 2021
113 Seiten, Note: 5,5 (Schweiz)
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Terminologie
- 2. Die Sprachensituation in der Schweiz
- 2.1 Diglossie oder Bilingualismus?
- 2.2 Die schweizerische Standardsprache
- 2.3 Spracheinstellungen
- 2.4 Literatur zur Aussprache des Schweizerhochdeutschen
- 2.5 Literatur zum Einfluss auf die Aussprache
- 2.5.1 Geschlecht
- 2.5.2 Alter
- 2.5.3 Bildung und soziale Klasse
- 2.5.4 Spracheinstellungen
- 2.5.5 Persönlichkeit
- 2.5.6 Medienkonsum
- 2.5.7 Sprachgebrauch
- 2.6 Die Aussprachenormen der schweizerischen und deutschländischen Standardsprache
- 2.6.1 Vokale
- 2.6.2 Konsonanten
- 2.7 Hypothesen
- 3. Experiment 1
- 3.1 Methoden
- 3.1.1 Erhebungen im Rahmen des SDATS-Projekts
- 3.1.2 Ortschaften
- 3.1.3 Gewährspersonen
- 3.1.4 Material
- 3.1.4.1 Features
- 3.1.4.2 Metadaten
- 3.1.5 Vorgehensweise
- 3.2 Resultate
- 3.2.1 Generelle Verteilung
- 3.2.2 Verteilung einzelner Features
- 3.3 Vergleich der Ergebnisse und Erklärungsversuche
- 3.3.1 Total Score
- 3.3.2 Die r-Laute
- 3.3.3 Der alveolare Frikative /s/
- 3.3.4 Der Laut für den Buchstaben <ä>
- 3.3.5 Die Frikative /x/
- 3.3.6 Die Affrikate /k/
- 3.3.7 Die Lautverbindung [ks]
- 3.3.8 Weitere Einflüsse auf die Aussprache
- 4. Experiment 2: Perzeptionsanalyse
- 4.1 Methoden
- 4.1.1 Studiendesign
- 4.1.2 Gewährspersonen
- 4.1.3 Vorgehensweise
- 4.2 Allgemeine Resultate
- 4.2.1 Faktoren, welche die Ratings beeinflussen
- 4.2.1.1 Bildung
- 4.2.1.2 Alter
- 4.3 Diskussion der Perzeptionsanalyse
- 5. Gesamtdiskussion
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht den Einfluss des soziodemografischen Hintergrunds auf die Aussprache von Standarddeutsch in der Deutschschweiz. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern wird die Aussprache des Standarddeutschen vom soziodemografischen Hintergrund der Sprecher:innen beeinflusst?
- Sprachsituation in der Deutschschweiz (Diglossie vs. Bilingualismus)
- Schweizerische Standardsprache und Sprachkonventionen
- Spracheinstellungen gegenüber Standarddeutsch und deren Varietäten
- Einfluss soziodemografischer Faktoren (Geschlecht, Alter, Bildung, Medienkonsum, Persönlichkeit, Sprachgebrauch) auf die Aussprache
- Wahrnehmung verschiedener Aussprachevarietäten durch Deutschschweizer:innen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der ambivalenten Beziehung der Deutschschweizer:innen zur Aussprache ihrer Standardsprache ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss des soziodemografischen Hintergrunds auf die Aussprache und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung verweist auf die bestehenden Widersprüche in der Wahrnehmung und Bewertung der Standardaussprache, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der wissenschaftlichen Literatur. 2. Die Sprachensituation in der Schweiz: Dieses Kapitel beleuchtet die komplexe Sprachsituation der Schweiz, insbesondere die Debatte um die Beschreibung als Diglossie oder Bilingualismus. Es werden verschiedene Ansätze und Definitionen diskutiert und die Herausforderungen bei der Kategorisierung der Interaktion zwischen Dialekt und Standardsprache beleuchtet. Die Rolle der Medien und der sozialen Veränderungen im Sprachgebrauch werden eingehend behandelt. 2.1 Diglossie oder Bilingualismus?: Der Abschnitt vertieft die Diskussion um die Klassifizierung der Sprachsituation in der Deutschschweiz als Diglossie oder Bilingualismus. Die unterschiedlichen Perspektiven und Argumente führender Linguisten werden präsentiert, und die Grenzen der jeweiligen Begrifflichkeiten im Kontext der Schweizer Sprachrealität werden hervorgehoben. Die Einflüsse von Medien und technologischen Entwicklungen auf den Sprachgebrauch werden analysiert. 2.2 Die schweizerische Standardsprache: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und den aktuellen Stand der schweizerischen Standardsprache. Es beleuchtet die historische Entwicklung, die Herausforderungen der Vereinheitlichung und den Einfluss der deutschländischen Standardsprache. Der Begriff der "schweizerhochdeutschen Sprachkonvention" und die damit verbundenen Varianten werden erläutert. Das Kapitel diskutiert verschiedene Idealvorstellungen der schweizerischen Standardaussprache. 2.3 Spracheinstellungen: Der Abschnitt behandelt die ambivalenten Einstellungen der Deutschschweizer:innen zur Standardsprache. Er beschreibt die unterschiedlichen Komponenten von Spracheinstellungen (kognitiv, affektiv, konativ) und präsentiert Ergebnisse relevanter Studien, welche die Widersprüchlichkeiten und die Spannungen zwischen der Akzeptanz der Standardsprache und dem Stolz auf die Dialekte beleuchten. 2.4 Literatur zur Aussprache des Schweizerhochdeutschen: Hier wird der aktuelle Stand der Forschung zur Aussprache des Schweizerhochdeutschen zusammengefasst. Wichtige präskriptive und deskriptive Arbeiten werden vorgestellt, wobei der Fokus auf empirischen Untersuchungen liegt, insbesondere auf die Arbeiten von Hove (2002) und Christen et al. (2010). 2.5 Literatur zum Einfluss auf die Aussprache: Dieser Abschnitt behandelt die soziolinguistische Literatur zum Einfluss verschiedener Faktoren auf die Aussprache, mit besonderem Fokus auf Geschlecht, Alter, Bildung, Spracheinstellungen, Persönlichkeit, Medienkonsum und Sprachgebrauch im Kontext der schweizerischen Standardsprache. 2.6 Die Aussprachenormen der schweizerischen und deutschländischen Standardsprache: Die Aussprachenormen des Standarddeutschen in Deutschland und der Schweiz werden verglichen, mit Schwerpunkt auf den Unterschieden bei Vokalen und Konsonanten. Die in der Studie analysierten Laute werden detailliert erläutert. 2.7 Hypothesen: Basierend auf der Literaturrecherche werden konkrete Hypothesen formuliert, die im weiteren Verlauf der Arbeit empirisch überprüft werden sollen. Diese Hypothesen beziehen sich auf den Einfluss soziodemografischer Faktoren auf die Aussprache und die Wahrnehmung verschiedener Aussprachevarietäten. 3. Experiment 1: Dieses Kapitel beschreibt das erste Experiment der Studie, das die Aussprache von Standarddeutsch bei Berner:innen untersucht. 3.1 Methoden: Die Methodik des ersten Experiments wird detailliert dargestellt, einschließlich der Datenerhebung im Rahmen des SDATS-Projekts, der Auswahl der Ortschaften und Gewährspersonen, des Materials (Features und Metadaten) und der Vorgehensweise bei der Datenanalyse. 3.2 Resultate: Die Ergebnisse des ersten Experiments werden präsentiert, sowohl die allgemeine Verteilung der Aussprachevarianten als auch die Verteilung einzelner Features (r-Laute, s-Laute, ch-Laute, k-Laute, ks-Laut und ä-Laut). 3.3 Vergleich der Ergebnisse und Erklärungsversuche: Die Ergebnisse werden mit den Befunden vorheriger Studien verglichen und vor dem Hintergrund der erhobenen soziodemografischen Daten diskutiert. Die Hypothesen werden anhand der Ergebnisse überprüft und mögliche Erklärungsansätze für die beobachteten Muster werden diskutiert. 4. Experiment 2: Perzeptionsanalyse: Dieses Kapitel beschreibt das zweite Experiment, eine Perzeptionsanalyse, die die Wahrnehmung verschiedener Aussprachevarietäten durch Deutschschweizer:innen untersucht. 4.1 Methoden: Die Methodik der Perzeptionsanalyse wird detailliert beschrieben, einschließlich des Studiendesigns, der Auswahl der Gewährspersonen und der Vorgehensweise bei der Datenanalyse. 4.2 Allgemeine Resultate: Die Ergebnisse der Perzeptionsanalyse werden präsentiert. Die Bewertung der verschiedenen Aussprachevarianten (BDnah, CHnah, Medium) hinsichtlich Kompetenz, Sympathie und Attraktivität werden dargestellt und verglichen. 4.3 Diskussion der Perzeptionsanalyse: Die Ergebnisse der Perzeptionsanalyse werden diskutiert, wobei der Fokus auf den Faktoren liegt, die die Bewertung der Aussprachevarianten beeinflussen. Die Hypothesen werden anhand der Ergebnisse überprüft. 5. Gesamtdiskussion: Die Ergebnisse beider Experimente werden zusammenfassend diskutiert. Die Ergebnisse werden im Kontext der Forschungsfrage interpretiert. Die Hypothesen werden erneut in Bezug auf die gewonnenen Erkenntnisse bewertet. Stärken und Schwächen der Studie werden reflektiert und die Implikationen für weitere Forschung werden aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Standarddeutsch, Schweizerhochdeutsch, Diglossie, Bilingualismus, Spracheinstellungen, Soziolinguistik, Aussprachevariation, Soziodemografie, Geschlecht, Alter, Bildung, Medienkonsum, Persönlichkeit, Sprachgebrauch, Perzeptionsanalyse, SDATS-Projekt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Soziodemografischer Einfluss auf die Aussprache des Standarddeutschen in der Deutschschweiz
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Einfluss des soziodemografischen Hintergrunds (Geschlecht, Alter, Bildung, Medienkonsum etc.) auf die Aussprache des Standarddeutschen in der Deutschschweiz. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern beeinflusst der soziodemografische Hintergrund die Aussprache des Standarddeutschen?
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet zwei Experimente: Experiment 1 untersucht die Aussprache von Standarddeutsch bei Berner:innen mittels Daten des SDATS-Projekts. Experiment 2 ist eine Perzeptionsanalyse, die die Wahrnehmung verschiedener Aussprachevarianten durch Deutschschweizer:innen erfasst.
Welche soziodemografischen Faktoren wurden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Einfluss von Geschlecht, Alter, Bildung, Spracheinstellungen, Persönlichkeit, Medienkonsum und Sprachgebrauch auf die Aussprache.
Welche Aspekte der Aussprache wurden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf verschiedene Laute und Lautverbindungen im Standarddeutschen, wie z.B. die r-Laute, der alveolare Frikative /s/, der Laut für den Buchstaben <ä>, die Frikative /x/, die Affrikate /k/ und die Lautverbindung [ks].
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Sprachsituation in der Schweiz (inkl. Diglossie/Bilingualismus-Debatte und schweizerischer Standardsprache), ein Kapitel zur Literatur zum Thema, zwei Kapitel zu den Experimenten (Methoden, Ergebnisse, Diskussion), eine Gesamtdiskussion, und ein Fazit. Es enthält auch ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Die Ergebnisse zeigen die Auswirkungen der untersuchten soziodemografischen Faktoren auf die Aussprache des Standarddeutschen in der Deutschschweiz. Konkrete Ergebnisse zu den einzelnen Lauten und die Ergebnisse der Perzeptionsanalyse (Wahrnehmung der Aussprachevarianten) sind im Detail in den Kapiteln 3 und 4 beschrieben.
Welche Hypothesen wurden aufgestellt und geprüft?
Basierend auf der Literaturrecherche wurden Hypothesen zum Einfluss der soziodemografischen Faktoren auf die Aussprache formuliert und anhand der Ergebnisse der Experimente überprüft.
Welche Daten wurden verwendet?
Die Daten stammen aus dem SDATS-Projekt und umfassen Aufnahmen von Sprecher:innen aus verschiedenen Ortschaften der Deutschschweiz. Zusätzlich wurden Daten aus der Perzeptionsanalyse erhoben.
Wie wird die schweizerische Sprachsituation beschrieben?
Die Arbeit diskutiert die komplexe Sprachsituation der Schweiz und beleuchtet die Debatte um die Beschreibung als Diglossie oder Bilingualismus. Die Interaktion zwischen Dialekt und Standardsprache und der Einfluss der Medien werden analysiert.
Welche Literatur wurde berücksichtigt?
Die Arbeit stützt sich auf relevante soziolinguistische Literatur zum Thema Aussprachevariation, Standarddeutsch, Schweizerhochdeutsch und den Einfluss soziodemografischer Faktoren. Es werden unter anderem die Arbeiten von Hove (2002) und Christen et al. (2010) zitiert.
Details
- Titel
- Der Einfluss des soziodemografischen Hintergrundes auf die Aussprache von Standarddeutsch in der Deutschschweiz
- Hochschule
- Universität Bern
- Note
- 5,5 (Schweiz)
- Autor
- Corinne Lanthemann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 113
- Katalognummer
- V1161109
- ISBN (Buch)
- 9783346567246
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- einfluss hintergrundes aussprache standarddeutsch deutschschweiz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Corinne Lanthemann (Autor:in), 2021, Der Einfluss des soziodemografischen Hintergrundes auf die Aussprache von Standarddeutsch in der Deutschschweiz, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1161109
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









