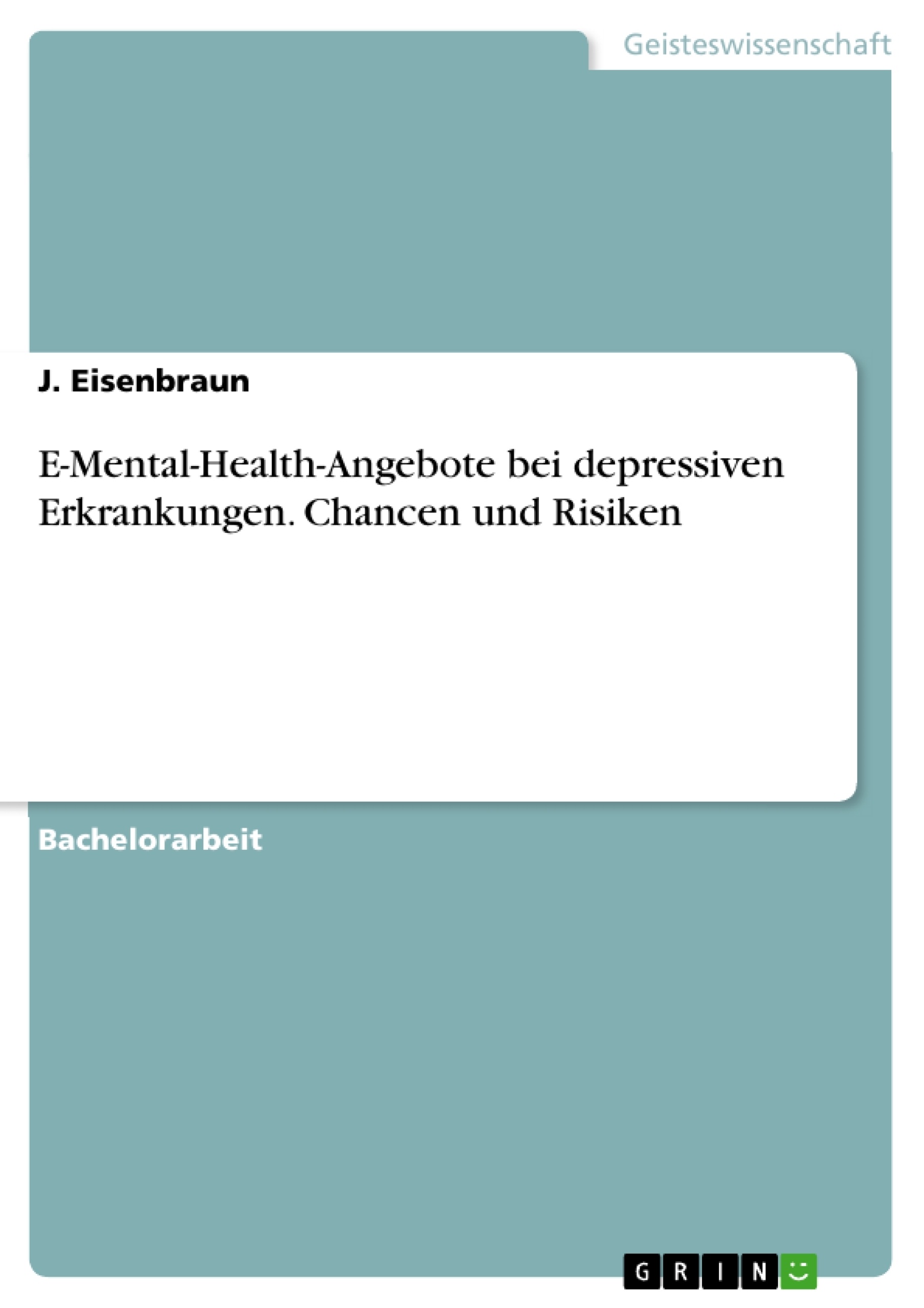E-Mental-Health-Angebote bei depressiven Erkrankungen. Chancen und Risiken
Bachelorarbeit, 2020
77 Seiten, Note: 1,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. E-Mental-Health
- 2.1 E-Health: Hintergrund und begriffliche Einordnung
- 2.2 E-Mental-Health: Begriffliche Einordnung
- 2.3 Relevanz einer digitalen Gesundheitsversorgung
- 3. Depressive Erkrankungen
- 3.1 Krankheitsbild und Symptome
- 3.2 Ursachen und Risikofaktoren
- 3.3 Klassische Behandlungsmethoden
- 4. E-Mental-Health-Angebote bei depressiven Erkrankungen
- 4.1 Informationsseiten und aktive Informationssuche
- 4.2 Internetbasierte Interventionen
- 4.2.1 Geführtes Selbstmanagement
- 4.2.2 Unbegleitetes Selbstmanagement
- 4.3 Online-Selbsthilfe-Gruppen
- 4.4 Anwendungssoftwares
- 5. Chancen von E-Mental-Health am Beispiel depressiver Erkrankungen
- 5.1 Erreichbarkeit und niedrige Hemmschwelle
- 5.2 Anonymität und Aktualität
- 5.3 Wirksamkeit
- 5.4 Kosteneffizienz
- 5.5 Aktive Teilnahme und Individualisierung
- 5.6 Zusammenfassung der Chancen
- 6. Risiken von E-Mental-Health am Beispiel depressiver Erkrankungen
- 6.1 Unübersichtliche Auswahl und fehlende Qualitätsvorgaben
- 6.2 Datenschutz und rechtliche Hindernisse
- 6.3 Krisenmanagement
- 6.4 Zusammenfassung der Risiken
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht Chancen und Risiken von E-Mental-Health-Angeboten bei depressiven Erkrankungen. Ziel ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Auswahl verfügbarer Angebote und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. Die Arbeit analysiert die Möglichkeiten und Herausforderungen der internetbasierten Versorgung psychisch Erkrankter.
- Chancen von E-Mental-Health bei Depressionen (Zugänglichkeit, Anonymität, Wirksamkeit)
- Risiken von E-Mental-Health bei Depressionen (Qualitätsmängel, Datenschutz, Krisenmanagement)
- Eignung und Grenzen internetbasierter Interventionen
- Begriffliche Einordnung von E-Health und E-Mental-Health
- Relevanz einer digitalen Gesundheitsversorgung für psychisch Erkrankte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung im Gesundheitswesen, insbesondere im Kontext psychischer Erkrankungen wie Depressionen. Sie hebt die hohe Prävalenz depressiver Erkrankungen und den dringenden Bedarf an verbesserter Versorgung hervor, wobei die Digitalisierung als potenzielles Instrument zur Bewältigung dieser Herausforderungen präsentiert wird. Die Einleitung begründet somit die Relevanz der Arbeit und skizziert den weiteren Aufbau.
2. E-Mental-Health: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Begriffsbestimmung von E-Health und E-Mental-Health, wobei der historische Kontext und die begriffliche Abgrenzung im Fokus stehen. Es werden die verschiedenen Facetten der digitalen Gesundheitsversorgung erörtert und die besondere Relevanz für den Umgang mit psychischen Erkrankungen herausgestellt. Die Bedeutung von E-Mental-Health für eine effektivere und zugänglicher gestaltete Behandlung von Depressionen wird umfassend beleuchtet.
3. Depressive Erkrankungen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Krankheitsbild und die Symptome von Depressionen, inklusive Ursachen und Risikofaktoren. Es werden etablierte Behandlungsmethoden im Detail dargestellt, um einen umfassenden Vergleich mit den im weiteren Verlauf beschriebenen E-Mental-Health-Angeboten zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der umfassenden Darstellung des Problems, das durch E-Mental-Health adressiert werden soll.
4. E-Mental-Health-Angebote bei depressiven Erkrankungen: Hier werden verschiedene internetbasierte Angebote zur Behandlung von Depressionen vorgestellt und differenziert. Dies beinhaltet Informationsseiten, geführte und unbegleitete Selbstmanagementprogramme, Online-Selbsthilfegruppen und Anwendungssoftwares. Der Schwerpunkt liegt auf einer systematischen Darstellung der Vielfalt und der jeweiligen Charakteristika der verschiedenen Ansätze.
5. Chancen von E-Mental-Health am Beispiel depressiver Erkrankungen: In diesem Kapitel werden die vielversprechenden Aspekte von E-Mental-Health im Kontext der Behandlung depressiver Erkrankungen detailliert analysiert. Es werden die Vorteile in Bezug auf Erreichbarkeit, Anonymität, Wirksamkeit, Kosteneffizienz, aktive Teilnahme und Individualisierung beleuchtet und mit Beispielen aus der Praxis untermauert. Die positive Wirkung auf die Betroffenen wird umfassend dargestellt.
6. Risiken von E-Mental-Health am Beispiel depressiver Erkrankungen: Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel werden hier die potenziellen Gefahren und Herausforderungen im Umgang mit E-Mental-Health-Angeboten für Menschen mit Depressionen thematisiert. Dies umfasst die unübersichtliche Auswahl an Angeboten, mangelnde Qualitätsstandards, datenschutzrechtliche Bedenken und die Schwierigkeiten im Krisenmanagement. Die möglichen negativen Konsequenzen werden kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
E-Mental-Health, E-Health, Depressionen, internetbasierte Interventionen, digitale Gesundheitsversorgung, Selbstmanagement, Online-Selbsthilfegruppen, Datenschutz, Qualitätssicherung, Wirksamkeit, Risiken, Chancen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Chancen und Risiken von E-Mental-Health bei depressiven Erkrankungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Chancen und Risiken von E-Mental-Health-Angeboten bei depressiven Erkrankungen. Sie analysiert die Möglichkeiten und Herausforderungen der internetbasierten Versorgung psychisch Erkrankter und zielt auf eine kritische Auseinandersetzung mit der Auswahl verfügbarer Angebote sowie einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Chancen von E-Mental-Health bei Depressionen (Zugänglichkeit, Anonymität, Wirksamkeit), Risiken von E-Mental-Health bei Depressionen (Qualitätsmängel, Datenschutz, Krisenmanagement), die Eignung und Grenzen internetbasierter Interventionen, die begriffliche Einordnung von E-Health und E-Mental-Health sowie die Relevanz einer digitalen Gesundheitsversorgung für psychisch Erkrankte.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, E-Mental-Health (inkl. Begriffsbestimmung und Relevanz), Depressive Erkrankungen (inkl. Krankheitsbild, Symptome und klassische Behandlungsmethoden), E-Mental-Health-Angebote bei depressiven Erkrankungen (inkl. Informationsseiten, Internetbasierte Interventionen, Online-Selbsthilfegruppen und Anwendungssoftwares), Chancen von E-Mental-Health (inkl. Erreichbarkeit, Anonymität, Wirksamkeit, Kosteneffizienz und Individualisierung), Risiken von E-Mental-Health (inkl. Qualitätsmängel, Datenschutz und Krisenmanagement) und Fazit.
Welche Arten von E-Mental-Health-Angeboten werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene internetbasierte Angebote zur Behandlung von Depressionen, darunter Informationsseiten, geführte und unbegleitete Selbstmanagementprogramme, Online-Selbsthilfegruppen und Anwendungssoftwares. Es wird eine systematische Darstellung der Vielfalt und der jeweiligen Charakteristika der verschiedenen Ansätze gegeben.
Welche Chancen von E-Mental-Health werden hervorgehoben?
Die Arbeit hebt folgende Chancen hervor: erhöhte Erreichbarkeit und niedrige Hemmschwelle, Anonymität und Aktualität der Informationen, Wirksamkeit der Interventionen, Kosteneffizienz, aktive Teilnahme der Betroffenen und Möglichkeiten zur Individualisierung der Behandlung.
Welche Risiken von E-Mental-Health werden diskutiert?
Die Arbeit thematisiert Risiken wie die unübersichtliche Auswahl an Angeboten und fehlende Qualitätsvorgaben, Datenschutzbedenken und rechtliche Hindernisse sowie die Herausforderungen im Krisenmanagement.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: E-Mental-Health, E-Health, Depressionen, internetbasierte Interventionen, digitale Gesundheitsversorgung, Selbstmanagement, Online-Selbsthilfegruppen, Datenschutz, Qualitätssicherung, Wirksamkeit, Risiken, Chancen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit der digitalen Gesundheitsversorgung, insbesondere im Bereich der psychischen Gesundheit, auseinandersetzen, einschließlich Fachkräfte im Gesundheitswesen, Betroffene und Angehörige sowie Wissenschaftler und Studierende.
Details
- Titel
- E-Mental-Health-Angebote bei depressiven Erkrankungen. Chancen und Risiken
- Hochschule
- Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln
- Note
- 1,5
- Autor
- J. Eisenbraun (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 77
- Katalognummer
- V1162290
- ISBN (Buch)
- 9783346570611
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- E-Mental-Health E-Health Depressionen internetbasierte Interventionen health-apps eHealth
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 34,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- J. Eisenbraun (Autor:in), 2020, E-Mental-Health-Angebote bei depressiven Erkrankungen. Chancen und Risiken, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1162290
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-