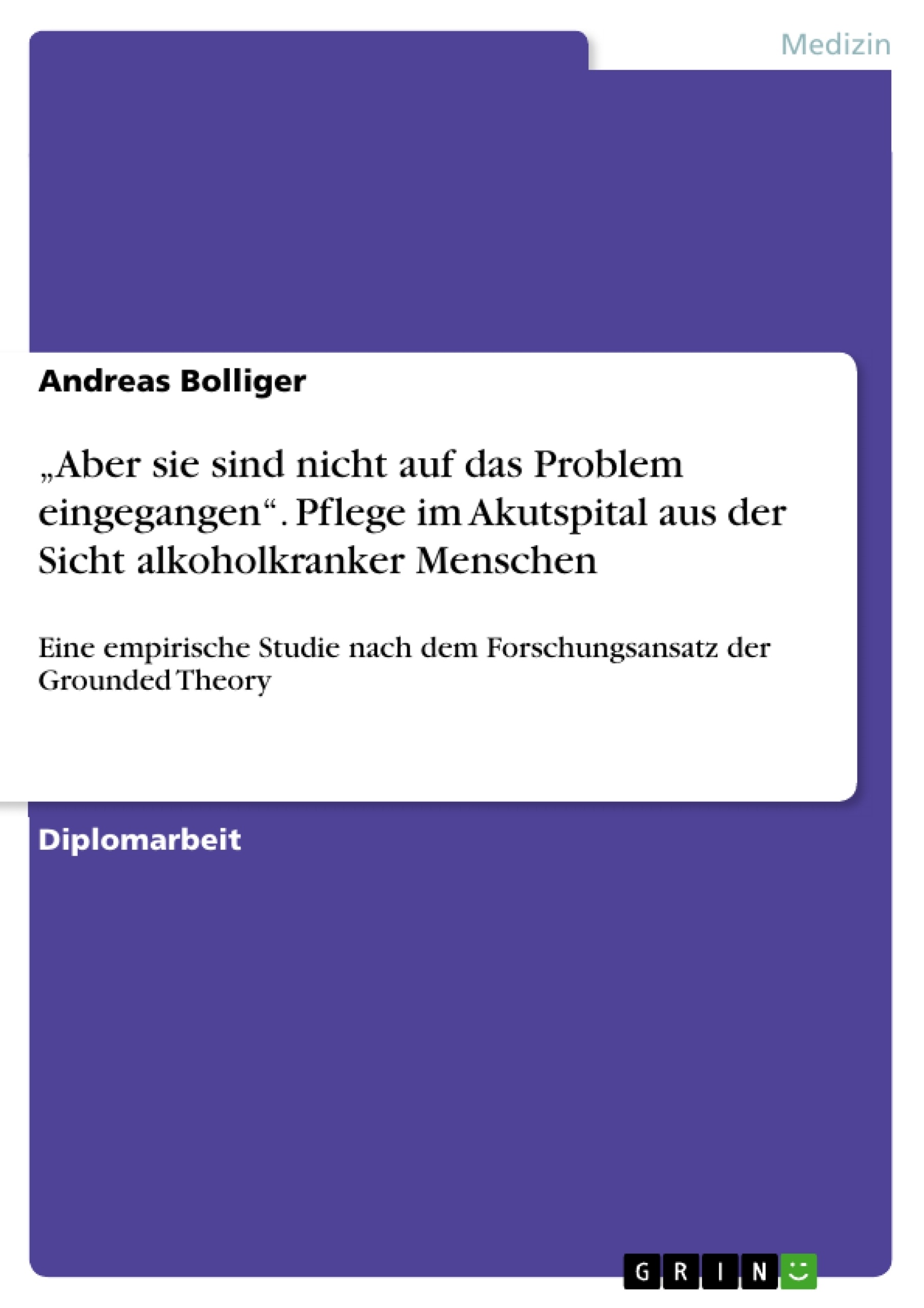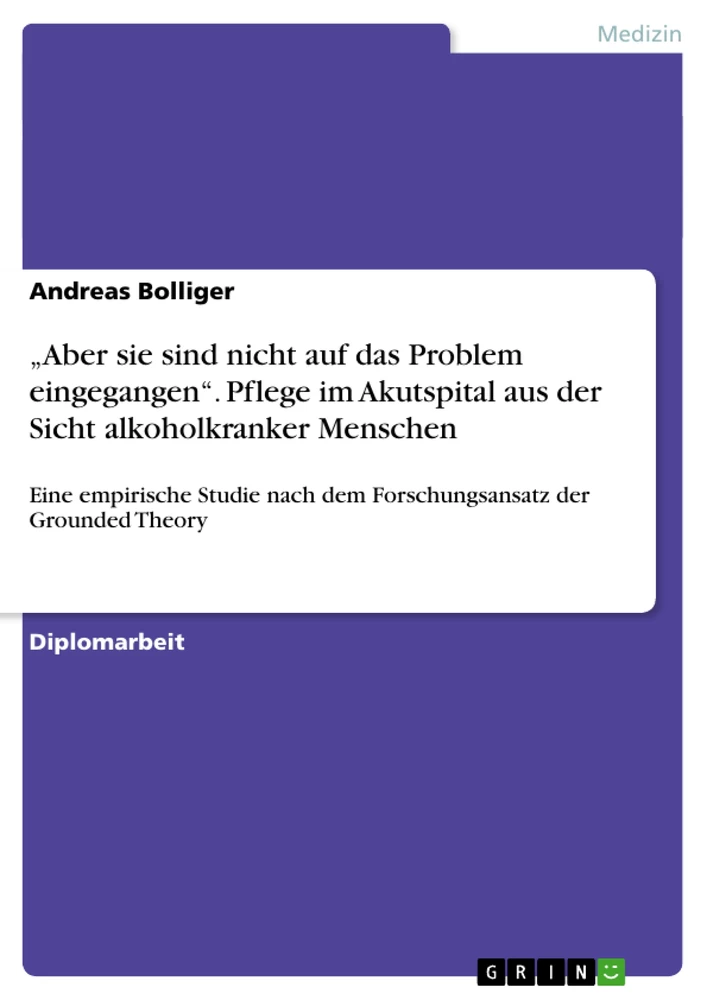
„Aber sie sind nicht auf das Problem eingegangen“. Pflege im Akutspital aus der Sicht alkoholkranker Menschen
Diplomarbeit, 2002
98 Seiten, Note: 5.5 (CH)
Leseprobe
INHALT
DANK
0 LISTEN DER ABBILDUNGEN UND TABELLEN
0.1 Liste der Abbildungen
0.2 Liste der Tabellen
1 EINLEITUNG
1.1 Problembeschreibung und Pflegerelevanz
1.2 Forschungsfragen
1.3 Forschungsziele
1.4 Grenzen der Studie
2 LITERATURÜBERSICHT UND THEORETISCHER RAHMEN
2.1 Alkoholkrankheit: Begriffsklärung
2.2 Alkoholkrankheit und Pflege: Hindernisse und Unterstützung
2.2.1 Hindernisse
2.2.2 Unterstützung
2.2.3 Mögliche Handlungsfelder für die Pflege
2.3 Theoretischer Rahmen: Das Transtheoretische Modell
2.3.1 Anwendung des Transtheoretischen Modells bei Alkoholproblemen
2.3.2 Das Transtheoretische Modell und die Anonymen Alkoholiker
2.4 Synthese
3 METHODOLOGIE
3.1 Design
3.2 Zielgruppe / Sample
3.3 Setting
3.4 Datensammlung
3.5 Datenanalyse
3.6 Ethische Überlegungen
3.7 Gütekriterien
4 RESULTATE
4.1 Beschreibung der Kategorien
4.1.1 Kernkategorie: Die Alkoholproblematik im Akutspital zum Thema machen
4.1.2 Genesungsprozess
4.1.3 Anstoss von Aussen
4.1.4 Soziale Einflussfaktoren
4.1.5 Spitalaufenthalt erleben
4.1.6 Abstinenz erleben
4.1.7 Pflege erleben
4.2 Theoretische Integration der Resultate
5 DISKUSSION
5.1 Diskussion der Resultate
5.2 Kritik und Grenzen der Untersuchung
5.3 Empfehlungen für die Pflegepraxis
5.4 Weiterführende Forschungsfragen
6 LITERATUR
7 ANHANG
7.1 Anhang A: Readiness to Change Questionnaire (RCQ)
7.2 Anhang B: CAGE Questionnaire
7.3 Anhang C: Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)
7.4 Anhang D: Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale (CIWA)
7.5 Anhang E: Kurzintervention: A-FRAMES
7.6 Anhang F: Das Transtheoretische Modell
7.7 Anhang G: Integration von Stufen und Veränderungsstrategien
7.8 Anhang H: Interviewleitfaden
7.9 Anhang I: Einverständniserklärung
7.10 Anhang J: Vorkommen der vorläufigen Kategorien in den ersten 6 Interviews
7.11 Anhang K: Ordnen der vorläufigen Kategorien zu Kategorien
7.12 Anhang L: Vorkommen der definitiven Kategorien in den ersten 6 Interviews
7.13 Anhang M: Eigenschaften und Dimensionen der Kernkategorie
7.14 Anhang N: Unterstützung und Hindernisse auf dem Weg zur Genesung
7.15 Anhang O: Reflexion eigener Einstellungen gegenüber alkoholkranken Menschen
0 LISTEN DER ABBILDUNGEN UND TABELLEN
0.1 Liste der Abbildungen
Abbildung 1: Kernkategorie Die Alkoholproblematik im Akutspital zum Thema machen: Darstellung anhand des paradigmatischen Modells nach Strauss und Corbin (1996)
Abbildung 2: Kategorie Genesungsprozess: Darstellung anhand des Transtheoretischen Modells
Abbildung 3: Integration der Ergebnisse: Die Alkoholproblematik im Akutspital zum Thema machen
Abbildung 4: Transtheoretisches Modell
0.2 Liste der Tabellen
Tabelle 1: Readiness to Change Questionnaire (RCQ)
Tabelle 2: Alcohol Use Disorder Identification Test (Audit)
Tabelle 3: Kurzintervention: A-FRAMES
Tabelle 4: Integration von Stufen und Veränderungsstrategien
Tabelle 5: Vorkommen der vorläufigen Kategorien in den ersten 6 Interviews
Tabelle 6: Ordnen der vorläufigen Kategorien zu Kategorien
Tabelle 7: Vorkommen der definitiven Kategorien in den ersten 6 Interviews
Tabelle 8: Eigenschaften und Dimensionen der Kernkategorie: Die Alkoholproblematik im Akutspital zum Thema machen
Tabelle 9: Unterstützung und Hindernisse auf dem Weg zur Genesung
DANK
Danken möchte ich den InterviewteilnehmerInnen für die bereitwillige und aktive Teilnahme, Regula für fachliche Diskussionen, Christine fürs professionelle Transkribieren der Interviews, Maya für den Ansporn, Heinz für empathisches Vertrauen, HP, der mich daran gehindert hat, den Computer aus dem Fenster zu werfen und nicht zuletzt der Peer-Group: Unzählige Diskussionen über Methode, Analyse und Inhalte und reger E-Mail-Austausch mit Anna, Brigit, Elisabeth, Eva und Eveline brachten Verwirrung, Klärung, neue Gedanken und Ideen. Das gemeinsame Zmörgele werde ich vermissen. Auch danken möchte ich Herrn Anselm Strauss für die Erkenntnis, das eine solche Arbeit immer ein Manuskript bleiben wird.
Winterthur im Juni 2002, Andreas Bolliger
1 EINLEITUNG
Mit dieser Studie wird untersucht, wie alkoholkranke Menschen die Pflege im Akutspital erlebt haben und welche Unterstützung und Hindernisse sie auf ihrem Weg der Genesung von ihrer Alkoholkrankheit wahrgenommen haben. Dabei spielt der Hospitalisationsgrund keine Rolle.
1.1 Problembeschreibung und Pflegerelevanz
In der Schweiz leben rund 300'000 alkoholabhängige Menschen (Müller, Meyer & Gmel, 1997). Zwei Drittel der Betroffenen sind Männer, ein Drittel Frauen (alles-im-griff.ch, 2001). Jährlich werden 25’000 von ihnen wegen chronischen und/oder akuten alkoholbedingten Problemen hospitalisiert (Schweizerische Fachstelle für Alkoholund andere Drogenprobleme [SFA], 1999a). In schweizerischen Akutspitälern nimmt zudem die Diagnose Alkoholismus bei Frauen und Männern im Alter zwischen 35 und 54 Jahren einen Platz unter den vier häufigsten Hauptund Nebendiagnosen ein, bei Männern zwischen 35 und 49 Jahren jeweils den ersten Platz (Müller et al., 1997).
Neben persönlichem Leid von Betroffenen und ihren Angehörigen führen Alkoholprobleme zu erheblichen sozialen Kosten. Direkte Kosten wie Behandlungskosten, sowie indirekte Kosten, wie verlorene Produktivität durch alkoholbedingte Mortalität und Morbidität werden unterschieden (Gutjahr, Gmel & Klingenmann, 2000). Die indirekten Kosten allein werden in der Schweiz auf jährlich 0.2 bis 2.175 Milliarden Schweizer Franken geschätzt1 (Gutjahr & Gmel, 2001). Aufgrund der lückenhaften Datenlage in der Schweiz sowie methodischer Probleme empfehlen die AutorInnen diese Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren. Die SFA (1999b) geht davon aus, dass sich die gesamten sozialen Kosten auf mindestens 3 Milliarden Schweizer Franken jährlich belaufen. Im Vergleich dazu: Die Einnahmen aus den Alkoholsteuern betragen etwa 400 Millionen Schweizer Franken im Jahr (SFA, 1999b). Behandlung von Sucht aber wird oft als ineffektiv und als Geldverschwendung betrachtet, da sie eine Krankheit mit hoher Rückfallwahrscheinlichkeit darstellt (Naegle, 1994). Eine amerikanische Studie weist darauf hin, dass Behandlung kosteneffektiver ist als keine Behandlung. Die Gesundheitskosten sanken – Behandlungskosten mit einberechnet – zwischen 23% und 55% pro Fall (Holder & Blose, 1992).
Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) (1992, zitiert nach Juchli, 1997) definiert das Gesamtangebot der Pflege in fünf Funktionen. Funktion 4 fordert, dass die Pflege bei der Erhaltung und Förderung der Gesundheit mitwirken soll. Bezogen auf die sehr heterogene Patien tengruppe2 alkoholkranker Menschen könnte dies bedeuten, sekundärpräventive Massnahmen im Spital durchzuführen. Unter Sekundärprävention werden Massnahmen der frühzeitigen Erkennung und Behandlung von Krankheiten verstanden. Mit diesen Massnahmen sollen die Krankheitsdauer gesenkt und Folgeschäden der Erkrankung vermieden werden. Alkoholkranke Menschen werden sehr häufig aus verschiedensten Gründen in Akutspitälern hospitalisiert ohne, dass sie einer formalen Therapie zugeführt werden (Hapke, 2000). Durch einen Krankenhausaufenthalt kann die Änderungsmotivation von alkoholkranken Patienten deutlich erhöht sein im Vergleich zu Personen in der Bevölkerung (Rumpf, Hapke, Meyer & John, 1999). Das Akutspital wäre somit ein idealer Ort, motivationsorientierte und verhaltensmodifizierende Massnahmen anzuwenden.
80 Prozent alkoholkranker Menschen schaffen den Ausstieg ohne Unterstützung von Kliniken, die auf Suchtbehandlung spezialisiert sind und ohne Hilfe von Selbsthilfegruppen wie den AA (Sobell, Sobell, Toneatto & Leo, 1993). Dies scheint bei Frauen häufiger zu sein als bei Männern (Copeland, 1997). Es ist davon auszugehen, dass es ebenso viele Wege zur Genesung gibt, wie es verschiedene alkoholkranke Menschen gibt. Im Grunde genommen sind alle erfolgreichen Veränderungen gesundheitlichen Risikoverhaltens letztendlich Selbstveränderungen; sie geschehen lediglich mit mehr oder weniger professioneller Unterstützung (Prochaska, Norcross & DiClemente, 1997).
Traditionelle Suchthilfesysteme orientieren sich an Therapiekonzepten, die eine hohe Motivation der Klienten voraussetzen. Leider kann damit nur ein kleiner Teil der Betroffenen erreicht werden; und dies oft erst, wenn schon gravierende Gesundheitsstörungen eingetreten sind (Hapke, Rumpf, Schumann & John, 1999). Viele Professionelle im Gesundheitswesen sind der Ansicht, dass ein Süchtiger erst tief genug fallen muss, um Hilfe annehmen zu können. Obwohl schwere Erkrankungen als Folge des Trinkens zur Lösung des Problems motivieren können, führen die Symptome oft eher zu weiterem Trinken, um Linderung zu erreichen. Dies führt zu einem der von Smith (1998) beschriebenen Teufelskreise, der paradoxen Situation der Abhängigkeit: Wissen um den Schaden, der angerichtet wird, aber Fortführen des gesundheitsschädigenden Verhaltens, um sich besser zu fühlen. Wie Klingemann (1991) in seiner Grounded Theory-Studie zeigt, kann das am-Boden-zerstört-sein (hitting bottom) ein Motivationsgrund zur Verhaltensänderung sein. Diese Verlaufsform entspricht dem Krankheitskonzept der AA. In der Literatur wird auch von einem Wendepunkt (turning point) gesprochen (Klingemann, 1991; Koski-Jännes, 1998). Dieser kann individuell sehr verschieden sein; es müssen nicht unbedingt schon gravierende gesundheitliche Schäden eingetreten sein (Klingemann, 1991). Andere Menschen haben keinen Wendepunkt erlebt,„...[they drifted] slowly and harmoniously... out of their addiction3 “ (S. 733). Viele Menschen finden zu einer positiven Lebensperspektive oder einem neuen Sinn im Leben, bevor ihre Alkoholkrankheit weit fortgeschritten ist. Diese neue Lebensperspektive motiviert sie, mit dem Trinken aufzuhören. Es wäre wünschenswert, wenn diese Menschen im Sinne der Sekundärprävention frühzeitig in ihrer Motivation unterstützt werden könnten. In Smiths (1998) Studie berichteten die InterviewteilnehmerInnen alle von einem persönlichen Tiefpunkt, welcher sie motivierte, ihr Trinkverhalten zu verändern. Prochaska (1999) wehrt sich gegen Bezeichnungen wie „therapieresistent“ oder „unmotiviert“ und bemerkt: „Glücklicherweise wissen wir heute, dass wohl eher wir [Hervorhebung v. Verf.] nicht bereit waren für die Behandlung dieser Personen, solange uns ausschliesslich handlungsorientierte Programme zur Verfügung standen“ (S. 8). Je früher ein substanzbezogenes Problem identifiziert wird, desto wahrscheinlicher ist ein positives Outcome, da bio-medizinische und psychosoziale Komplikationen in der Regel weniger weit fortgeschritten sind und der Patient eher Beratung und Behandlung akzeptieren kann (Gerace, Hughes & Spunt, 1995).
Bisher wurden hauptsächlich quantitative Studien aus der Sicht der Forschenden durchgeführt; über die subjektive Sicht der Betroffenen ist bisher wenig bekannt.
1.2 Forschungsfragen
- Wie haben alkoholkranke Menschen die Pflege im Akutspital erlebt?
- Welche Unterstützung und Hindernisse von Pflegenden nahmen sie auf ihrem Weg der Genesung von ihrer Alkoholkrankheit war?
Der Hospitalisationsgrund spielt bei obiger Fragestellung keine Rolle.
1.3 Forschungsziele
- Erleben der Pflege aus der Sicht alkoholkranker Menschen beschreiben
- Genesungsfördernde und –hemmende Faktoren aus der Sicht betroffener ehemaliger Patienten formulieren.
1.4 Grenzen der Studie
- Enger Zeitrahmen
- Einzelarbeit statt Gruppenarbeit. Grounded Theory Projekte finden idealerweise als Teamarbeiten statt (Haller, 2000).
- Örtliche Begrenzung: Die Studie berücksichtigt nur InterviewteilnehmerInnen aus der Deutschschweiz.
- Das Sample von 7 InterviewteilnehmerInnen ist auch für qualitative Studien relativ klein
- Soziale Erwünschtheit: Die InterviewteilnehmerInnen könnten in persönlichen Interviews zu Antworten neigen, von denen sie annehmen, dass der Interviewende sie erwartet.
Mit diesen Grenzen kann die theoretische Sättigung nicht erreicht werden. Eine Theoriebildung im Sinne der Grounded Theory ist nicht möglich; Konzeptentwicklung (Strauss & Corbin, 1996) und partielle Theoriebildungsansätzen können erreicht werden.
2 LITERATURÜBERSICHT UND THEORETISCHER RAHMEN
2.1 Alkoholkrankheit: Begriffsklärung
Begriffe wie Alkoholmissbrauch, Alkoholabhängigkeit, Alkoholismus, Alkoholiker, Alkoholkrankheit und alkoholkranke Menschen werden in der Literatur nicht allgemeingültig definiert. Es existieren über 50 verschiedene, teilweise kontrovers diskutierte Theorien und Perspektiven, die diese Begriffe erklären oder beschreiben (Gerace, Hughes & Spunt, 1995).
Die beiden in den USA führenden Fachinstanzen (National Council on Alcoholism and Drug Dependence & American Society of Addictive Medicine, zitiert nach Feuerlein, Küfner & Soyka, 1998) definieren Alkoholismus folgendermassen:
Alkoholismus ist eine primäre, chronische Krankheit, deren Entstehung und Manifestation durch genetische, psychosoziale und umweltbedingte Faktoren beeinflusst wird. Sie schreitet häufig fort und kann tödlich enden. Alkoholismus wird durch eine Reihe von dauernd oder zeitweilig auftretenden Kennzeichen charakterisiert: durch die Verschlechterung des Kontrollvermögens beim Trinken und durch die vermehrte gedankliche Beschäftigung mit Alkohol, der trotz besseren Wissens um seine schädlichen Folgen getrunken wird und dessen Konsum häufig verleugnet wird. (S.7)
Der Begriff alkoholkranker Mensch soll im Gegensatz zum Begriff des Alkoholikers den Krankheitsaspekt des Suchtgeschehens herausstreichen (Sondheimer & Eichenberger, 1989). Heute ist die Alkoholabhängigkeit weitgehend als Krankheit anerkannt (SFA, 1999a). Trotzdem sind immer noch viele Menschen skeptisch, ob es sich dabei um eine Krankheit handelt oder nicht (Backmund, 1999b; Naegle, 1994). Die Anonymen Alkoholiker (AA) sprechen von Alkoholkrankheit und verwenden den Begriff AlkoholikerIn , den sie folgendermassen umschreiben:
Wenn Sie immer wieder mehr trinken, als Sie eigentlich beabsichtigen oder wollen, wenn Sie dadurch in Schwierigkeiten geraten oder wenn Sie wegen des Trinkens an Gedächtnislücken leiden, sind Sie möglicherweise AlkoholikerIn. Diese Frage können letztlich nur Sie selbst beantworten. Niemand bei den Anonymen Alkoholikern wird Ihnen die Entscheidung abnehmen. (AA, 2001a)
Die AA sind der Ansicht, „dass es so etwas wie eine Heilung nicht gibt. Wir können nie wieder normal trinken und unsere Fähigkeit, den Alkohol stehen zu lassen, hängt davon ab, ob wir uns körperlich, seelisch und geistig gesund erhalten“ (AA, 2001a). Wenn es ein alkoholkranker Mensch schafft, keinen Alkohol mehr zu trinken, kommt die Alkoholkrankheit zum Stillstand; dieser Zustand wird Genesung genannt (AA, 2001b). Deshalb ist das oberste Ziel der AA Abstinenz. Es wird angenommen, dass alkoholkranke Menschen niemals kontrolliert trinken können (AA, 1998). Die Frage, ob alkoholkranke Menschen jemals fähig sein können, kontrolliert, das heisst nicht gesundheitsgefährdend Alkohol zu konsumieren, wird in der Lite ratur kontrovers diskutiert4. Es gibt Hinweise darauf, dass Menschen mit leichten oder mittleren Alkoholproblemen zu einem harmlosen Trinkverhalten finden können (Brochu, 1990; Peele, 2000; Riley, 1996; Steffen, Steffen & Nathan, 1982). Menschen, welche die Unterstützung der AA suchen, haben eher schwerere Alkoholprobleme (Snow, Prochaska & Rossi, 1994). Allerdings sind die Begriffe leichte, mittlere oder schwere Alkoholprobleme nicht klar definiert.
Im Folgenden wird der Begriff alkoholkranker Mensch verwendet. Für die Literaturübersicht ist die Definition des National Council on Alcoholism and Drug Dependence und der American Society of Addictive Medicine von Bedeutung. Die Rekrutierung von InterviewteilnehmerInnen für die Studie berücksichtigte die Definition der AA: Es muss jeder Mensch die Frage selber beantworten, ob er alkoholkrank ist oder nicht.
2.2 Alkoholkrankheit und Pflege: Hindernisse und Unterstützung
Dieses Kapitel zeigt in einer Literaturübersicht, wie Pflegende im Akutspital mit alkoholkranken Menschen umgehen. Ein erstes Unterkapitel beschreibt Hindernisse, welche alkoholkranke Menschen auf ihrem Weg der Genesung seitens des Pflegepersonals erlebt haben. Das zweite Unterkapitel geht umgekehrt auf die Unterstützung ein. Das dritte Unterkapitel beschreibt Pflegeinterventionen, welche in nicht auf Suchtbehandlung spezialisierten Kliniken durchgeführt werden könn(t)en.
2.2.1 Hindernisse
Welche Hindernisse seitens der Pflege im Akutspital nahmen alkoholkranke Menschen auf ihrem Weg der Genesung von ihrer Alkoholkrankheit war? Neben fehlenden Angeboten nennt die Literatur vor allem eine Antwort: negative Einstellungen gegenüber alkoholkranken Menschen. Eine Einstellung definiert Stroebe (1998) als Tendenz oder Neigung, ein bestimmtes Objekt (Mensch oder Sache) eher positiv oder eher negativ zu bewerten. Negative Einstellungen gegenüber substanzmissbrauchenden Menschen, Wissenslücken und mangelhafte klinische Fertigkeiten verhindern frühe Identifikation, Behandlung und Überweisung (Gerace, Hughes & Spunt, 1995). Negative Einstellungen haben einen direkten Einfluss auf das Behandlungsergebnis.
Welche Faktoren Menschen geholfen haben, ihr Alkoholproblem selbständig, ohne formale Hilfe zu lösen, war Gegenstand von zwei Grounded Theory-Studien der amerikanischen Pflegewissenschaftlerin Finfgeld (1998, 1999a). Negative Einstellungen von Professionellen im Gesundheitswesen (healthcare providers) gegenüber alkoholkranken Menschen wurden als Hindernis auf dem Weg der Genesung wahrgenommen.
Die Ergebnisse einer Literaturstudie (Bolliger, 2000) zeigen zwar einen Trend zu eher positiven Einstellungen gegenüber alkoholkranken Menschen (Allen, 1993; Bendtsen & Akerlind, 1999; Happel & Taylor, 1999; Rassool, 1993), es herrschen aber noch immer negative Einstellungen vor (Hall, 1994; Riley, 1996). Howard und Chung (2000), welche die Literatur der letzten 30 Jahre (1966-1996) bezüglich Einstellungen von Pflegenden gegenüber psychoaktive Substanzen missbrauchenden Menschen gesichtet haben, bestätigen diesen Trend. Trotzdem würden noch eine grosse Minderheit der Pflegenden psychoaktive Substanzen missbrauchende Menschen als unsittlich, charakterschwach und zur Genesung kaum fähig betrachten. Viele Pflegende übernehmen die gesellschaftlich übliche Sicht gegenüber dem Alkoholkonsum: Akzeptanz des Alkoholkonsums, aber Ablehnung der Person, dessen Alkoholkonsum ausser Kontrolle gerät (Estes & Heinemann, 1986).
Eine Herausforderung des Gesundheitswesen ist, die Einstellungen der verschiedenen Akteure zu ändern um eine verbesserte Versorgung der Patienten anbieten zu können (Swenson-Britt, Carrougher, Martin & Brackley, 2000). Gemäss Harts (1988, zitiert nach Swenson-Britt et al., 2000) Dissertation tragen vor allem Früherkennung und frühzeitige Behandlung alkoholbedingter Probleme zu einer signifikanten Verbesserung der Einstellungen von Pflegenden gegenüber alkoholkranken Menschen bei.
Als Hindernis, bei selbst wahrgenommenen Alkoholproblemen Hilfe zu suchen, werden in verschiedenen Studien folgende Faktoren genannt:
- Stigmatisierung durch Professionelle im Gesundheitswesen (Grant, 1997; Klingemann, 1991). Frauen scheinen dies noch stärker wahrzunehmen als Männer (Copeland, 1997)
- Fehlendes Bewusstsein über das Behandlungsangebot, Informationsmangel (Copeland, 1997; Klingemann, 1991)
- Wahrgenommene Inkompetenz Professioneller im Gesundheitswesen: „They can’t teach me more than I know already5 “ (Klingemann, 1991, S. 740)
- Stolz (Klingemann, 1991).
2.2.2 Unterstützung
Welche Unterstützung seitens der Pflege im Akutspital nahmen alkoholkranke Menschen auf ihrem Weg der Genesung von ihrer Alkoholkrankheit war? Analog dem letzten Unterkapitel – mit umgekehrten Vorzeichen – werden hier vor allem positive Einstellungen, Akzeptanz und Empathie genannt.
Allen (1993) ermittelte in einer Studie die Einstellungen von Pflegenden gegenüber alkoholkranken Menschen in einem Allgemeinkrankenhaus in Illinois (USA). Sie ging davon aus, dass die Pflegenden negative Einstellungen hätten. Ihre Hypothese konnte nicht bestätigt werden; im Gegenteil, die Pflegenden nannten unter anderem folgende Punkte, welche gemäss dem Marcus Alcoholism Questionnaire6 eine positive Einstellung gegenüber alkoholkranken Menschen repräsentiert: Die Pflegenden glaubten, dass emotionelle und psychologische Schwierigkeiten wichtige Faktoren in der Entstehung von Alkoholismus sind, Kontrollverlust ein Symptom von Alkoholismus ist, jemand nicht ununterbrochen trinken muss, um alkoholkrank zu sein und Alkohol eine Abhängigkeit erzeugende chemische Substanz ist.
Wie gestalten und erleben Pflegende in einem allgemeinen Akutspital in der Schweiz den Umgang mit alkoholkranken Menschen? Dieser Frage ging Bolliger (2001) nach. Überraschendes Ergebnis war, dass die interviewten Pflegenden weit weniger Berührungsängste und Vorurteile haben, als in der Literatur beschrieben wird. Alle InterviewteilnehmerInnen akzeptierten alkoholkranke Menschen wie jeden anderen Patienten auch. Sie berichteten, sie hätten keine Mühe, die Alkoholproblematik ihrer Patienten anzusprechen. Dies ist eine wichtige und positiv überraschende Aussage. Im Gegensatz dazu wird in der Literatur erwähnt, dass Pflegende grosse Hemmungen haben, erwachsene Menschen zu einem derart sensiblen Thema zu befragen. Daher würden sie vermeiden, Patienten darauf anzusprechen (Finfgeld, 1999b). Eine andere Studie weist darauf hin, dass die meisten alkoholkranken Menschen es sogar schätzen würden, von Professionellen im Gesundheitswesen auf ihr Alkoholproblem angesprochen zu werden (Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen & Seppä, 2001). Als unterstützenden Faktor nahmen alkoholkranke Frauen in Copelands (1997) Studie eine empathische Beziehung war. Copeland (1997) ging der Frage nach, welche Hindernisse alkoholkranke Frauen vom Aufsuchen formaler Hilfe abgehalten hat. Die InterviewteilnehmerInnen empfanden es ebenfalls als angemessen, dass Professionelle im Gesundheitswesen sie über Alkoholund anderen Drogengebrauch befragten.
In den bereits erwähnten Grounded Theory-Studien Finfgelds (1998, 1999a) war ein wesentlicher, durch Pflegende beeinflussbarer Faktor die dauernde Verfügbarkeit von Informati- onen bezüglich Alkoholmissbrauch . Auch wenn die Informationen nicht zu unmittelbaren Verhaltensänderungen geführt haben, waren sie doch eine wichtige Grundlage für eine spätere Veränderung der Trinkgewohnheiten. Ein Studienteilnehmer meinte dazu: „At the time, no single piece of information made me change. All together, though, a combination of different types of information was helpful. It was good for reference later on7 “ (Finfgeld, 1998, S. 10). Weitere die Genesung unterstützende Faktoren waren Lebens-Management-Fähigkeiten (life management skills) wie Prioritäten und Ziele setzen, Kontrolle über das eigene Leben haben und Selbstvertrauen. Eine wesentliche Erkenntnis Finfgelds (1998, 1999a) ist, dass die Selbstveränderer in ihren Studien nicht bloss ihr tägliches Leben geändert haben, sondern in sich selbst (re-)investiert haben, um das (wieder) zu erreichen, was sie sein wollten.
2.2.3 Mögliche Handlungsfelder für die Pflege
Pflegende stehen im Umgang mit alkoholkranken Menschen in einer in vielerlei Hinsicht besonderen Position: Pflegende übernehmen als Teil der Gesellschaft auch Einstellungen der Gesellschaft, aber sie können sich nicht aussuchen, ob sie ihre Patienten betreuen wollen oder nicht (Allen, 1993). Pflegende sind aufgrund des häufigen Patientenkontakts die professionelle Gruppe mit dem grösstem Potential, Menschen mit drogenund alkoholbedingten Problemen zu Verhaltensund Lebensstiländerungen zu ermutigen (Happel & Taylor, 1999). Der längere Kontakt gibt ihnen eine einmalige Gelegenheit, eine enge, pflegerische Beziehung aufzubauen, was die Behandlung verbessern dürfte (Riley, 1996). Pflegende sind oft auch die ersten der Professionellen im Gesundheitswesen, die mit psychoaktive Substanzen missbrauchenden Menschen in Kontakt treten (Rassool, 1993). Pflegende sind somit in einer zentralen Position, die nötige Pflege von Menschen mit alkoholbedingten Problemen zu erkennen und einzuleiten (Gerace, Hughes & Spunt, 1995). Ziele der Pflegeinterventionen sind a) Förderung der Inanspruchnahme weiterer Hilfe beziehungsweise b) direkte Einwirkung auf den Alkoholkonsum (Hapke, 2000).
Die International Nurses Society on Addictions [IntNSA] (1978) betont, dass die Pflege alkoholkranker Menschen die traditionellen Grenzen der Pflege überschreitet; Pflege alkoholkranker Menschen findet in allen Bereichen der Pflege statt, nicht nur in der psychiatrischen Pflege. In einem Grundlagenpapier beschreibt die IntNSA (1978) die Rolle der Pflegenden. Sie unterscheidet fünf Teilgebiete der Pflege alkoholkranker Menschen: a) Direkte Pflege in einem allgemeinen Setting, b) direkte Pflege in einem Alkoholismus-spezifischen Setting, c) Bildung, d) Management und e) Forschung. In der vorliegenden Arbeit steht das allgemeine Setting des (somatischen) Akutspitals im Vordergrund; Beispiele angewandter Forschung werden weiter unten beschrieben. Die IntNSA (1978) führt fünf Kategorien von Pflegeinterventionen auf:
- Identifizierung von Alkoholproblemen. Die Pflegenden sollten in jedem Setting jeden Patienten systematisch bezüglich alkoholbedingten Problemen befragen.
- Kommunikation über das Alkoholproblem. Die Kommunikation über Alkoholprobleme sollte selbstverständlich und in einer nicht-verurteilenden Weise erfolgen.
- Aufklärung bezüglich Alkoholgebrauch, -missbrauch und –abhängigkeit
- Beratung des alkoholkranken Menschen und seiner Angehörigen
- Überweisung an weitere Behandlungsangebote .
Forschung legt den Schluss nahe, dass bereits das Screening nach Alkoholproblemen einige Menschen dazu motiviert, ihr Alkoholproblem selbst zu lösen (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism [NIAAA] 1993, zitiert nach Finfgeld, 1997). In einer Literatur- übersicht bezüglich Kurzinterventionen (Watson, 1999) wurde bei einigen Studien folgender Effekt beobachtet: Auch die Kontrollgruppen, welche keine Behandlung erhielten, reduzierten ihren Alkoholkonsum. Das heisst, das Minimum, was Pflegende leisten können, ist mit ihren Patienten über ihren Alkoholkonsum zu sprechen, wie dies die Pflegenden in Bolligers (2001) Studie tun.
Ein ideales Versorgungskonzept würde gemäss Hapke et al. (1999) ein Routine-Screening aller etwa 18 bis 70jährigen Patienten beinhalten. Es gibt verschiedene, einfach und schnell anzuwendende Fragebögen. Bei positivem Screening-Resultat hätte ein beratendes Gespräch zu erfolgen. Dies könnte durch Angehörige verschiedener Berufsgruppen durchgeführt werden, nachdem sie für diese Beratung geschult wurden. Es wäre denkbar, dass dies Pflegende übernähmen (Hapke, 2000).
In Bolligers (2001) Studie meinte ein Interviewteilnehmer, im Akutspital müsse bezüglich Alkoholkrankheit kein kuratives Ziel verfolgt werden, „weil wir sicher nicht die Welt retten.“ Aber „es wäre viel gemacht, wenn der Patient darüber nachdenken würde, dass er vielleicht das Problem angehen könnte... Wenn er seinen ersten Kontakt hätte, wenn er vielleicht einen Support hätte, sich mit dieser Situation auseinander zu setzen, dann wäre das schon sehr sehr viel für ein Akutspital.“ Unter Anwendung des Transtheoretischen Modells (TTM, Beschreibung des Modells siehe Kapitel 2.3) (Prochaska et al., 1992) könnte der alkoholkranke Mensch dort abgeholt werden, wo er steht. Das heisst, er könnte zum Beispiel mit geeigneter Hilfestellung von der untersten Stufe der Absichtslosigkeit zur nächsten Stufe der Absichtsbildung gebracht werden. Patienten, die bezüglich ihres Alkoholkonsums über ein grösseres Problembewusstsein verfügen, könnten gezielter bei der Planung angepasster Therapiemöglichkeiten unterstützt werden. Zur genaueren Einschätzung der Änderungsbereitschaft eines alkoholkranken Menschen könnte auch der Readiness to Change Questionnaire (RCQ, siehe Anhang A und Kapitel 2.3.1) angewendet werden. Auch wenn ein alkoholkranker Mensch nicht zur Behandlung seiner Abhängigkeit ins Akutspital eintritt, könnte der Spitalaufenthalt doch einen Anstoss zur Verbesserung seiner Situation geben .
Das Project Hope (Swenson-Britt, Carrougher, Martin & Brackley, 2000), im Jahre 1990 am Universitätsspital in San Antonio, Texas (USA) gestartet, hat das Ziel, die Pflege psychoaktive Substanzen missbrauchender Patienten zu verbessern, indem Einstellungen und Wissen verbessert werden. Verschiedene Massnahmen, wie vermehrter Kontakt zu Selbsthilfegruppen, Einführung von Assessmentund Behandlungsinstrumenten und verschiedene Weiterbildungen wurden einund durchgeführt. Bisherige Ergebnisse zeigen ein deutlich verbessertes Wissen der Pflegenden bezüglich Substanzmissbrauch, Entzug und Heilungsmöglichkeiten. Bezüglich Einstellungen der Pflegenden konnten allerdings keine signifikanten Änderungen festgestellt werden. Eine Hypothese der Studie, nämlich dass Wissen Einstellungen ver- ändert, konnte nicht bestätigt werden. Es wurden folgende Screeningund Assessment- Instrumente eingeführt: Der CAGE Questionnaire (siehe Anhang B) und die Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale (CIWA, siehe Anhang D). Der CAGE Questionnaire ist ein Instrument, welches der Entdeckung einer möglichen Alkoholproblematik dient. Bei einem positiven Screening-Resultat erfolgt weitere (ärztliche) Diagnostik. CIWA ist ein Instrument zur Erfassung des Schweregrades einer Alkoholentzugssymptomatik; die Einschätzung nimmt weniger als 2 Minuten in Anspruch8 (Sullivan, Sykora, Schneiderman, Naranjo & Sellers, 1989a). Es wird so möglich abzuschätzen, ob eine medikamentöse Behandlung oder Alkoholabgabe9 zur Abwendung gefährlicher Entzugssymptome nötig ist oder nicht. Beide Instrumente sind schnell und unkompliziert handhabbar und sind in einer deutschsprachigen Version erhältlich (Feuerlein, Küfner & Soyka, 1998; Stuppäck et al., 1995)10. In der Schweiz wird jedoch in Akutspitälern in der Regel keines der erwähnten In strumente routinemässig verwendet. Meyer (persönl. Mitteilung, 23.11.2001) spricht bezüglich Alkoholentzug von einem unprofessionellen Umgang, der oft in Akutspitälern vorherrsche. Dies lasse sich nur damit erklären, dass bei vielen Professionellen im Gesundheitswesen bezüglich Alkoholkrankheit immer noch das Lasterkonzept vorherrsche. Smith (1998) führte eine qualitative Studie nach einen hermeneutischen-phänomenologischen Ansatz durch. Er untersuchte die erlebte Erfahrung des Leidens von Menschen mit Alkoholproblemen. Die Resultate zeigten, dass das Leiden mehr als nur physische Schmerzen beinhaltet. Die InterviewteilnehmerInnen litten unter ihren Schamund Schuldgefühlen. Am meisten Angst hatten sie jedoch vor der Erfahrung schwerer Entzugssymptome.
Ein 3-jähriges Projekt in einem städtischen, US-amerikanischen Universitätsspital hatte zum Ziel, das Erkennen und den Umgang mit substanzmissbrauchenden Menschen zu verbessern (Gerace et al., 1995). Dabei konnte das Wissen und das Vertrauen der Pflegenden in ihre Fähigkeiten, substanzmissbrauchende Patienten betreuen zu können, verstärkt werden. Wie beim Project hope konnte keine Verbesserung der Einstellungen der Pflegenden gemessen werden; jedoch stellt der verbesserte Behandlungsoptimismus eine positive Veränderung dar, welche wichtige klinische Bedeutung hat. Der Kern des Projektes bestand in 2-tägigen Workshops, die jährlich durchgeführt wurden. Inhalt der Workshops waren Einstellungen, Wissen und klinische Fertigkeiten bezüglich Prävention, Screening, Kurzintervention und Überweisung (Gerace, Hughes & Spunt, 1995)
Einstellungsveränderungen sind schwierig zu erreichen und zu messen. Es zeigte sich jedoch, dass Verhaltensänderungen bei den Pflegenden durchaus erreicht werden können, auch wenn sich ihre Einstellungen nicht geändert haben (Gerace, Hughes & Spunt, 1995; Swenson-Britt, Carrougher, Martin & Brackley, 2000).
Bei leichten bis mittleren Alkoholproblemen zeigten sich Kurzinterventionen als wirkungsvoll (Finfgeld, 1999b; Fleming, Barry & Manwell, 1997; Minicucci, 1994; Watson, 1999). Bei schwereren Alkoholproblemen ist eher eine Zuweisung an Spezialisten nötig. Kurzinterventionen bestehen aus einem kurzen Assessment, Feedback und einer Kurzberatung. Finfgeld (1999b) plädiert dafür, dass solche Kurzinterventionen durch Pflegende durchgeführt werden sollten. Sie schlägt dabei ein Vorgehen anhand des englischen Akronyms FRAMES (beziehungsweise A-FRAMES) vor: Assessment, Responsibility, Advice, Menu, Empathy, Self-efficacy11 (Siehe Anhang E). Dabei sollen sich die Interventionen an den Stufen der Verhaltensänderung (Prochaska et al., 1992; Keller, Velicer & Prochaska, 1999) orientieren (siehe Kapitel 2.3).
Übereinstimmend mit Finfgeld (1999b) bemerkt Watson (1999), dass Kurzinterventionen gerade durch nicht spezialisierte Pflegende durchgeführt werden könnten. Allerdings erwähnt sie auch, dass bei mangelnder Motivation oder Wissenslücken bei den Pflegenden die Kurzinterventionen ineffektiv sind. Menschen, welche ihre Trinkprobleme ohne formale Hilfe gelöst haben, haben oft gleichzeitig auch andere gesundheitliche Risikoverhalten wie Rauchen, Bewegungsmangel oder mangelnde Ernährung aufgegeben (Finfgeld, 1997). Kurzinterventionen könnten deshalb in ein grösseres Gesundheitsförderungsprogramm eingebettet werden, um das Stigma beim Betroffenen zu vermeiden, als Problemtrinker etikettiert zu werden.
Finfgeld (1998, 1999a) zeigte, dass ein wesentlicher Faktor für Selbstveränderer das (Re- )Investieren in ihr Selbst (investing and re-investing in self) war. Für die Pflegenden könnte dies bedeuten, alkoholkranke Menschen zu empowern12, neue Ziele zu setzen und zusammen schauen, ob diese Ziele mit fortdauerndem Alkoholkonsum erreichbar sind. Das heisst, nicht die Gesundheit als abstrakte Grösse sollte im Vordergrund stehen, sondern das Leben des betroffenen Menschen. Selbsthilfematerial, insbesondere Broschüren, können zukünftige Selbstveränderer zu einer Verhaltensänderung ermutigen (Finfgeld, 1997).
2.3 Theoretischer Rahmen: Das Transtheoretische Modell
Auch bei Menschen, die noch nicht zum Handeln bereit sind, kann ein Veränderungsprozess in Gang gesetzt werden (Prochaska, Norcross & DiClemente, 1997). Dies zeigt das Transtheoretische Modell (TTM) (Prochaska et al., 1992; Keller et al., 1999). Es vermittelt die Erkenntnis, dass Verhaltensänderung ein Prozess ist, der in verschiedenen Stufen abläuft. In jeder Stufe werden verschiedene Handlungsstrategien verwendet; und dies unabhängig davon, ob die Veränderung mit oder ohne professionelle Hilfe geschieht. Das TTM vereint Hauptinhalte von verschiedenen psychologischen Theorien, die bislang als unvereinbar galten. Prochaska et al. (1992) haben herausgefunden, dass diese Theorien weit mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben. Im Vorwort zu Kellers Buch Motivation zur Verhaltensänderung (Keller, 1999) meint Prochaska: „Glücklicherweise haben Personen, die ihr Verhalten von selbst verändern, keine ideologischen Scheuklappen“ (S. 7). Die Kernkonstrukte des TTM sind die Stufen der Verhaltensänderung 13 (stages of change) und die Strategien der Verhaltensänderung (processes of change) (Keller, Velicer & Prochaska, 1999). Die Verhaltensänderung wird in fünf beziehungsweise sechs aufeinander aufbauenden Stufen beschrieben:
1. Absichtslosigkeit (precontemplation),
2. Absichtsbildung (contemplation),
3. Vorbereitung (preparation),
4. Handlung (action) und
5. Aufrechterhaltung (maintenance); für verschiedene Verhaltensweisen wurde eine
6. Stabilisierungsstufe (termination) eingeführt. Man geht davon aus, dass zum Beispiel Zielverhaltensweisen wie „sich gesund ernähren“ keine terminale Stabilisierung zulassen. Bei nicht lebensnotwendigen Genussmitteln wie Zigaretten wird diese Stabilisierungsstufe als möglich erachtet.
Die Unterscheidung der letzten beiden Stufen wurde empirisch noch nicht befriedigend untersucht; oft wird die letzte Stufe weggelassen. Das lineare Durchlaufen der verschiedenen Stufen ist eher Ausnahme denn Regel. Rückfälle auf frühere Stufen sind normal. Doch lernen die Menschen bei jedem Rückfall auch dazu; durch konstruktive Auseinandersetzung mit Misserfolgen können ein nächstes Mal günstigere Strategien zum Erfolg führen. Deshalb sprechen Prochaska et al. (1997) anstatt von Rückfall auch von Wiedereintritt in den Prozess. Dies symbolisiert das als Spiralmodell dargestellte TTM (siehe Anhang F). Es gibt weder sofort wirksame Wundermethoden, noch müssen Menschen zeitlebens in einer Endlosschleife verharren zwischen Absichtsbildung bis Handlung und wieder zurück in die Absichtslosigkeit. Für die Einteilung in die Stufen werden einfache Algorithmen verwendet, die für den Bereich Rauchen entwickelt wurden und für andere untersuchte Bereiche leicht abgeändert wurden. So wird jemand, der nicht beabsichtigt, sein gesundheitliches Risikoverhalten in den nächsten 6 Monaten zu verändern, in der Stufe der Absichtslosigkeit eingeteilt. Jemand, der sich ernsthaft überlegt, sein Verhalten in den nächsten 6 Monaten zu ändern, wird der Stufe der Absichtsbildung zugeteilt. Wer bereits in den nächsten 30 Tagen eine Änderung plant, befindet sich in der Stufe der Vorbereitung. Derjenige, der sein Risikoverhalten geändert hat, aber noch keine 6 Monate durchgehalten hat, ist am handeln und wer sein Risikoverhalten vor mehr als 6 Monaten erfolgreich änderte, hat es in die Stufe der Aufrechterhaltung geschafft (Keller et al., 1999).
Die Strategien der Verhaltensänderung vereinen verschiedene kognitiv-affektive Strategien (experiental processes) und verhaltensorientierte Strategien (behavioral processes). Die kognitiv-affektiven Strategien werden eher in den ersten zwei, drei Stufen benützt; die verhaltensorientierten Strategien kommen eher in der zweiten Hälfte des Veränderungsprozesses zum Zug (siehe Anhang G). Folgende Strategien der Verhaltensänderung kommen zum Einsatz:
- Kognitiv-affektive Strategien
- Steigern des Problembewusstseins (consciousness raising)
- Emotionales Erleben (emotional relief)
- Neubewertung der persönlichen Umwelt (environmental reevaluation)
- Selbstneubewertung (self-reevaluation)
- Wahrnehmung förderlicher Umweltbedingungen (social liberation)
- Verhaltensorientierte Strategien
- Selbstverpflichtung (self-liberation, commitment)
- Kontrolle der Umwelt (stimulus control)
- Gegenkonditionierung (counterconditioning)
- Nutzen hilfreicher Beziehungen (helping relationships)
- (Selbst-) Verstärkung (reinforcement management, reward) (Keller et al., 1999)14. Die Stufen der Verhaltensänderung beschreiben, wann eine Veränderung stattfindet; die Strategien der Verhaltensänderung beschreiben, wie eine Veränderung stattfindet. Die Verbindung der beiden Konzepte Stufen und Strategien der Verhaltensänderung erlaubt, Menschen gezielt in ihrer Stufe zu fördern (Keller et al., 1999).
Neben diesen beiden Konzepten werden im TTM noch drei Ergebnis-Variablen beschrieben, die den Prozess der Verhaltensänderung beschreiben:
- Entscheidungsbalance (decisional balance)
- Selbstwirksamkeitserwartung (self-efficacy)
- Situative Versuchung (temptation) (Keller et al., 1999).
Die Entscheidungsbalance bezeichnet eine subjektiv wahrgenommene Abschätzung der Vorund Nachteile des eigenen Verhaltens beziehungsweise der Verhaltensänderung. In hö- heren Stufen der Verhaltensänderung werden die Vorteile der Verhaltensänderung höher gewichtet als in tieferen Stufen. Die Selbstwirksamkeit beschreibt die Zuversicht, eine Verhaltensänderung auch unter ungünstigen Bedingungen aufrechterhalten zu können; die situative Versuchung stellt das Gegenteil der Selbstwirkamkeitserwartung dar. Die letzten beiden Konstrukte stellen zuverlässige Prädiktoren für einen Rückfall dar (Keller et al., 1999).
Das TTM wurde bisher in verschiedenen Bereichen gesundheitlichen Risikoverhaltens empirisch untersucht und angewendet. Im Kontext der Raucherentwöhnung wurden allein im anglo-amerikanischen Sprachraum über 100 Arbeiten publiziert (Keller et al., 1999). Auf Rauchen basierende Studien waren Ausgangspunkt der Entwicklung des TTM. Weitere Anwendungsbereiche des TTM sind zum Beispiel: Körperliche Aktivität, Gewichtsreduktion und Alkoholabusus (Keller, 1998).
2.3.1 Anwendung des Transtheoretischen Modells bei Alkoholproblemen
Das TTM wurde im Bereich der Alkoholproblematik durch verschiedene Studien empirisch unterstützt und wird in der Prävention (Primärund Sekundärprävention) in verschiedenen Settings verwendet.
In der Literatur werden für die Behandlung von alkoholkranker Menschen problematische Verhaltensweisen beschrieben: Leugnung des Problems, Widerstand und unterschiedliche Motivation für eine Verhaltensänderung (DiClemente & Hughes, 1990). Dabei wird die Ver- änderungsbereitschaft als dichotomes Phänomen angenommen, das entweder vorhanden ist oder nicht. Das TTM zeigt deutlich, dass die Realität etwas komplexer ist und dass beispielsweise Motivation alleine nicht reicht für eine Verhaltensänderung (Bischof, Rumpf, Hapke, Meyer & John, 2000). Bezüglich der Leugnung muss an dieser Stelle auch festgehalten werden, dass dies vermutlich im Zusammenhang mit konkret erlebter oder auch nur befürchteter Stigmatisierung durch die soziale Umwelt stehen dürfte (Hapke, 2000).
Eine Reihe von Studien konnte die Gültigkeit und die Nützlichkeit des TTM beim Verstehen des Veränderungsprozesses bei Menschen, die von ihren alkoholbedingten Problemen genesen sind, bestätigen (DiClemente & Hughes, 1990; Klingemann, 1991, 1992; Murphy, 1993; Murphy & Hoffman, 1993; Snow, Prochaska & Rossi, 1994). Die AutorInnen legen jeweils ihr Gewicht auf andere Aspekte des TTM. So wurden Veränderungsprozesse von alkohol- und heroinabhängigen Selbstveränderern untersucht (Klingemann, 1991, 1992) oder Versuche unternommen, dass TTM weiter zu entwickeln (Murphy, 1993; Murphy & Hoffman, 1993). Murphy (1993) und Murphy und Hoffman (1993) schlagen nach zwei Studien, welche die Copingstrategien von abstinenten alkoholkranken Menschen untersuchten, eine Erweiterung des TTM um eine Ausdifferenzierung der Stufe der Aufrechterhaltung vor:
- Symptomstabilisierung
- Distanzierung des Selbst von alkoholkrankem Verhalten
- Normalisierung des Lebensprozesses.
Die aktuellste Version des TTM (Keller, Velicer & Prochaska, 1999) übernimmt diese Vorschläge allerdings nicht. Tucker, Vuchinich und Gladsjo (1994) zeigten bezüglich Alkoholproblemen insbesondere, dass die Strategien, die zu einer Verhaltensänderung motivieren sich von denjenigen unterscheiden, die zur Beibehaltung der Verhaltensänderung beitragen.
Andere Studien (DiClemente & Hughes, 1990; Rollnick, Heather, Gold & Hall, 1992, zitiert nach Hapke, 2000) führten zu einem Messinstrument, das sich für die Anwendung in der Forschung, aber auch gut für das Assessment in klinischen Settings eignet: Der Readiness to Change Questionnaire (RCQ, siehe Anhang A), einem Einschätzungsinstrument für die Änderungsbereitschaft des alkoholkranken Menschen. DiClemente und Hughes (1990) identi fizierten und klassifizierten in ihrer Studie mit alkoholkranken Menschen, die in einem ambulanten Programm waren, die Stufen der Verhaltensänderung. Das dabei verwendete Messinstrument (University of Rhode Island Change Assessment Scale [URICA]) erwies sich als valide und reliabel. In jüngerer Forschung wurde die URICA zum Readiness to Change Questionnaire (RCQ) weiterentwickelt (Rollnick, Heather, Gold & Hall, 1992, zitiert nach Hapke, 2000). Für genesene Patienten eignet sich der Fragebogen allerdings nicht, da er keine Items für die Stufe der Aufrechterhaltung enthält.
Public Health-Programme wie die aktuelle „Alles im Griff“-Kampagne in der Schweiz verwenden das TTM als theoretischen Hintergrund. Das Präventionsprogramm zielt darauf ab, absichtslose Risikokonsumenten zur Absichtsbildung zu bewegen und motivierte Menschen von der Absichtsbildung in die Vorbereitungsphase zu bringen (Müller, Klingemann & Gmel, 1999).
Bei der Sekundärprävention muss aktiv auf die Zielgruppe zugegangen werden. Mit gezielten Screeningmassnahmen können auch Menschen erreicht werden, die sich in tiefen Stufen der Änderungsbereitschaft befinden und noch keine schweren Folgeprobleme aufweisen (Hapke, Rumpf, Schumann & John, 1999). Eine Studie, die in Lübeck Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts durchgeführt wurde, untersucht die Unterschiede der Änderungsbereitschaft bei Alkoholabhängigen im Akutspital und in der Allgemeinbevölkerung (Rumpf, Hapke, Meyer & John, 1999). Dabei zeigte sich, dass die alkoholabhängigen Patienten im Spital zu 5.9 % im der Stufe der Absichtslosigkeit waren, 50.8 % in der Stufe der Absichtsbildung und immerhin 43.2 % wurden der Stufe der Handlung zugerechnet. In der Stichprobe aus der Allgemeinbevölkerung zeigte sich ein anderes Bild: Absichtslos waren 26
%, ernsthaft eine Änderung in den nächsten 6 Monaten erwägten 58 % und am Handeln waren 16 %. Diese Zahlen belegen eine deutlich erhöhte Änderungsbereitschaft im Spital. Ungeachtet möglicher Gründe dieser Unterschiede weisen diese Zahlen auf die wichtige Bedeutung des Settings Spital für sekundärpräventive Massnahmen hin.
2.3.2 Das Transtheoretische Modell und die Anonymen Alkoholiker
Snow, Prochaska und Rossi (1994) untersuchten erstmals, wie sich die Änderungsstrategien von alkoholkranken Menschen, die mit Unterstützung der AA genesen sind von denjenigen unterscheiden, die das Ziel der Abstinenz ohne formale Hilfe erreicht haben. Die Autoren konnten zeigen, dass sich die beiden Gruppen nicht grundsätzlich unterschieden. Selbstveränderer nehmen etwas mehr Gebrauch von kognitiven Strategien, derweil AAs deutlich mehr verhaltensorientierte Strategien anwenden. Der Unterschied kann damit erklärt werden, dass die AA betonen, dass es lebenslanger Anstrengung bedarf und dass eine Heilung nicht möglich sei (AA, 2001a). Weiter konnte festgestellt werden, dass AAs im Vergleich zu Selbstver- änderern etwas schwerere Alkoholprobleme hatten. Bischof, Rumpf, Hapke, Meyer und John (2000) kommen zum gleichen Ergebnis. Die Veränderungsprozesse von Selbstveränderern und AAs können beide mit dem TTM erklärt werden; Unterschiede zwischen beiden Gruppen sind klein. Wie bei Snow et al. (1994) wendeten AAs mehr verhaltensorientierte Massnahmen an. Sie informierten mehr Freunde über ihre (früheren) Alkoholprobleme und suchten mehr soziale Unterstützung. Dies könnte damit zusammenhängen, dass es den AAs wichtig ist, zu akzeptieren, dass sie Alkoholiker sind (AA, 1998). Selbstveränderer möchten im Gegensatz dazu das Etikett „Alkoholiker“ nach ihrer Genesung eher vermeiden.
Im TTM wird die Stufe der Aufrechterhaltung als aktive Phase verstanden. Das Zielverhalten wird durch die in der Handlungsphase angewendeten Strategien weiter verfestigt. Je nach Verhaltensbereich kann diese Stufe den Rest des Lebens umfassen (Keller, Velicer & Prochaska, 1999). In diesem Sinne argumentieren die AA (2001a; 2001b): Sie gehen davon aus, dass ein alkoholkranker Mensch niemals geheilt werden kann, aber durch eine angepasste Lebensführung mit seinem Problem gesund weiterleben kann.
2.4 Synthese
Es wurden diverse Studien durchgeführt, die herausgearbeitet haben, welche unterstützenden (Copeland, 1997; Finfgeld, 1998, 1999a; Kääriäinen et al., 2001) beziehungsweise hindernden Faktoren (Finfgeld, 1998, 1999a; Gerace et al., 1995, Grant, 1997; Klingemann, 1991) auf ihrem Weg der Genesung alkoholkranke Menschen wahrgenommen haben. Die Antworten bleiben aber in der Regel auf einer recht abstrakten Ebene stehen: So wurden als unterstützende Faktoren hauptsächlich positive Einstellungen der Pflegenden gegenüber alkoholkranken Menschen beziehungsweise Akzeptanz oder Empathie genannt. Als Hindernisse wurden dementsprechend hauptsächlich negative Einstellungen der Pflegenden gegenüber alkoholkranken Menschen genannt. Daneben wird als Unterstützung die dauernde Verfügbarkeit von Informationen bezüglich Alkoholmissbrauch erwähnt. Allerdings ist dabei nicht klar, welche Informationen vermittelt werden sollen. Als weitere Hindernisse können vor allem Wissenslücken auf Seiten der Pflegenden und der Betroffenen vermutet werden. Ob diese Vermutung für die Pflege in der Schweiz zutrifft, ist nicht bekannt. Die Beantwortung dieser Frage hat jedoch anderswo zu erfolgen. Andere Studien zeigten, dass Selbstveränderer und Menschen, welche mit Hilfe von Selbsthilfegruppen wie den AA genesen sind von der selben Unterstützung profitiert haben (Bischof et al., 2000; Snow, et. al., 1994).
Es sind hauptsächlich in den USA, aber auch in Deutschland bereits einige Erfolg versprechende Interventionen durch Pflegende im Setting des Akutspitals durchgeführt worden (Finfgeld, 1999b; Fleming et al., 1997; Gerace et al., 1995; Hapke et al., 1999; Swenson-Britt et al., 2000; Watson, 1999). Einige valide, reliable und anwendungsfreundliche Instrumente für Forschung und klinischen Einsatz wurden entwickelt (CAGE, AUDIT, CIWA, RCQ, A- FRAMES und andere). Es wird in der Schweiz jedoch in Akutspitälern in der Regel keines dieser Instrumente routinemässig verwendet. Die erwähnten Studien weisen deutlich darauf hin, dass gerade im Akutspital Verbesserungen der Betreuung und Behandlung alkoholkranker Menschen möglich sind. Nichts spricht nach Ansicht des Verfassers dagegen, dass Pflegende in Zukunft einige dieser Instrumente auf ihre Anwendbarkeit prüften und angepasst übernähmen. In einer Studie hatten alkoholkranke Menschen am meisten Angst vor der Erfahrung schwerer Entzugssymptome (Smith, 1998). Diese Aussage allein sollte Rechtfertigung genug sein für einen professionelleren Umgang mit der Entzugsproblematik, das heisst zum Beispiel, in der Praxis bereits bewährte Instrumente anzuwenden.
Kurzinterventionen gäben den Pflegenden eine Gelegenheit, direkt therapeutisch auf den Alkoholkonsum einiger Patienten einzuwirken. Selbstverständlich müssten die Pflegenden vorher für diese Aufgabe geschult werden. Wenn auch nicht explizit, so zumindest implizit besteht durch die Funktion 4 (SRK, 1992, zitiert nach Juchli, 1997) ein Auftrag an die Pflege, sekundärpräventive Massnahmen bei alkoholkranken Menschen durchzuführen. Nur am Rande sei hier bemerkt, dass bei anderen Krankheiten mit manifesten Symptomen auch nicht auf eine Behandlung verzichtet wird, nur weil ein Patient nicht aus diesem Grund ins Spital eingetreten ist. Natürlich wäre bei der Einführung neuer Massnahmen ein interdisziplinäres Vorgehen nötig, da verschiedene Berufsgruppen im Behandlungsprozess involviert sind.
Von dem Wissen aus der Literatur liessen sich in der Schweiz einzuführende Pflegeinterventionen ableiten. Jedoch ist über die subjektive Sicht alkoholkranker Menschen noch zu wenig bekannt. Aufgrund der durchgeführten Studien ist noch nicht ganz geklärt, welche Pflegeinterventionen alkoholkranken Menschen konkret geholfen haben beziehungsweise, was sie von Seiten der Pflegenden auf ihrem Weg der Genesung behindert hat. Vor der Einführung neuer Pflegeinterventionen sollten die subjektiven Einschätzungen betroffener Menschen zur Kenntnis genommen werden.
[...]
1 Die zitierte Studie zeigt, dass geringfügige Änderungen der Methodik enorme Schwankungen in den Gesamtkosten zur Folge haben können.
2 Umgang mit geschlechtsspezifischen Bezeichnungen: Beim Begriff Patient wird jeweils die männliche Form gebraucht, da Männer den Grossteil alkoholkranker Menschen ausmachen, Frauen sind mitgemeint. Beim Begriff Interviewteilnehmer werden die Frauen mit einem Gross-I bedacht: InterviewteilnehmerInnen. Ebenso wird mit den AutorInnen und ÄrztInnen etcetera verfahren. Wenn explizit von Männern oder Frauen die Rede ist, wird auf das Gross-I verzichtet und die jeweils korrekte Form verwendet. Pflegende treten in einer sprachlich geschlechtsneutralen Form in Erscheinung.
3 Sie entwuchsen langsam und harmonisch ihrer Abhängigkeit. (Klingemann, 1991, S. 733, Übers. v. Verf.)
4 Ein zusammenfassender Literaturüberblick zum Thema kontrolliertes Trinken findet sich in Christoffel, Liechti, Meyer, Sieber und Sondheimer (1999) und in Meyer et al. (2000).
5 Sie können mir nicht mehr beibringen, als ich eh’ schon weiss. (Klingemann, 1991, S. 740, Übers. v. Verf.)
6 Fragebogen mit Fokus auf Wissen und Einstellungen gegenüber alkoholkranken Menschen.
7 Zu dieser Zeit veranlasste mich keine einzelne Information dazu, mich zu ändern. Alles zusammen jedoch, eine Kombination von verschiedenartigen Informationen war hilfreich. Es war gut, um später darauf zurückgreifen zu können. (Finfgeld, 1998, S. 10, Übers. v. Verf.)
8 Die Zeitangabe von 2 Minuten bezieht sich auf die neuste Version des CIWA: CIWA-Ar. Auf Deutsch übersetzt und modifiziert wurde die ältere Version der CIWA-Ar, die CIWA-A (Stuppäck et al., 1995). Sie hat sich als reliabel und valide erwiesen. Allerdings wurden redundante Items nicht entfernt, wie dies bei der englischen CIWA-Ar der Fall ist. Dies könnte die klinische Akzeptanz beeinträchtigen, da die Anwendung dieser Skala deutlich mehr als zwei Minuten beansprucht (etwa fünf Minuten).
9 Gemäss (Craft et al., 1994) ist die Alkoholabgabe bei traumatologischen Patienten der Gabe von Benzodiazepinen überlegen. Die AutorInnen treten allerdings dafür ein, dass nicht prophylaktisch Alkohol per Infusion gegeben wird, sondern erst bei Anzeichen einer beginnenden Alkoholentzugssymptomatik. Solange keine anderen Ursachen für diese Symptome erkennbar seien (Hypoglykämie, Kopfverletzungen, Lungenembolie), sei Alkohol der Gabe von Benzodiazepinen vorzuziehen. Obwohl letztere durchaus wirkungsvoll Alkoholentzugssymptome zu lindern vermögen, haben sie im Gegensatz zu Alkohol wesentliche Nachteile: Atemdepression, erhöhte Pneumonieneigung, Schläfrigkeit. Ein nicht sedierter Patient, der Alkohol nur in einer entzugsverhindernder Dosis erhält, sei viel besser bezüglich seines körperlichen und geistigen Zustands einzuschätzen. Er wird so nach Ansicht der Autoren auch kooperationsfähiger sein.
10 Die SFA hat ein dem CAGE-Instrument ähnliches Instrument entwickelt, den Swiss Institute for the Prevention of Alcohol and Drug Problems-Test (SIPA-Test), welches sich für die Schweiz besser eigne (Truan, Gmel, Fran- çois & Janin, 1997). Gemäss Meyer (2001), ist der CAGE Questionnaire eher für Screening-Massnahmen auf Bevölkerungsebene geeignet; für das klinische Setting empfiehlt er den Einsatz des AUDIT (siehe Anhang C). Dieses Instrument ist allerdings etwas ausführlicher als der CAGE Questionnaire; dies könnte die klinische Akzeptanz beeinträchtigen. Hearne, Conolly und Sheehan (2002) erachten deshalb den CAGE als das beste Screening- Instrument für das klinische Setting.
11 Einschätzung, Verantwortung, Ratschlag, Auswahl, Empathie, Selbstwirksamkeit
12 Für weitere Informationen zum Konzept des Empowerment siehe zum Beispiel Schweizerische Stiftung für Gesundheitsförderung (2001) unter http://www.gesundheitsfoerderung.ch
13 Bei der ersten Verwendung der Begriffe des TTM wird die englische Bezeichnung jeweils in Klammer angegeben, da die deutsche Übersetzung in verschiedenen Publikationen nicht einheitlich erfolgt ist. Im Folgenden werden die deutschen Begriffe verwendet, wie sie Keller (1999) benützt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments "INHALT"?
Das Dokument ist ein umfassender Überblick über eine Studie zum Thema Alkoholkrankheit und Pflege im Akutspital. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, Listen von Abbildungen und Tabellen, eine Einleitung, eine Literaturübersicht mit theoretischem Rahmen, eine Beschreibung der Methodologie, die Resultate der Studie, eine Diskussion der Ergebnisse, eine Liste der verwendeten Literatur und einen Anhang mit verschiedenen Fragebögen, Modellen und weiteren Materialien.
Welche Themen werden in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung umfasst die Problembeschreibung und Pflegerelevanz, Forschungsfragen, Forschungsziele und die Grenzen der Studie.
Was beinhaltet die Literaturübersicht und der theoretische Rahmen?
Dieser Abschnitt definiert Alkoholkrankheit, untersucht Hindernisse und Unterstützung in der Pflege, beschreibt mögliche Handlungsfelder für die Pflege und stellt das Transtheoretische Modell (TTM) vor, einschliesslich dessen Anwendung bei Alkoholproblemen und im Kontext der Anonymen Alkoholiker (AA). Eine Synthese der Erkenntnisse schliesst diesen Abschnitt ab.
Welche Aspekte werden in der Methodologie behandelt?
Die Methodologie beschreibt das Design der Studie, die Zielgruppe/Sample, das Setting, die Datensammlung, die Datenanalyse, ethische Überlegungen und die Gütekriterien.
Welche Kategorien werden in den Resultaten beschrieben?
Die Resultate umfassen die Beschreibung der Kategorien: Die Alkoholproblematik im Akutspital zum Thema machen (Kernkategorie), Genesungsprozess, Anstoss von Aussen, Soziale Einflussfaktoren, Spitalaufenthalt erleben, Abstinenz erleben und Pflege erleben. Ausserdem ist eine theoretische Integration der Resultate enthalten.
Was beinhaltet die Diskussion?
Die Diskussion umfasst die Diskussion der Resultate, Kritik und Grenzen der Untersuchung, Empfehlungen für die Pflegepraxis und weiterführende Forschungsfragen.
Welche Anhänge sind im Dokument enthalten?
Der Anhang enthält verschiedene Fragebögen (Readiness to Change Questionnaire (RCQ), CAGE Questionnaire, Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale (CIWA)), eine Beschreibung der Kurzintervention A-FRAMES, eine Darstellung des Transtheoretischen Modells, eine Integration von Stufen und Veränderungsstrategien, einen Interviewleitfaden, eine Einverständniserklärung, Vorkommen der Kategorien in den Interviews, Eigenschaften und Dimensionen der Kernkategorie, Unterstützung und Hindernisse auf dem Weg zur Genesung, und eine Reflexion eigener Einstellungen gegenüber alkoholkranken Menschen.
Was sind die Forschungsfragen der Studie?
Die Forschungsfragen sind: Wie haben alkoholkranke Menschen die Pflege im Akutspital erlebt? Welche Unterstützung und Hindernisse von Pflegenden nahmen sie auf ihrem Weg der Genesung von ihrer Alkoholkrankheit wahr?
Was sind einige der Grenzen der Studie?
Die Grenzen der Studie umfassen einen engen Zeitrahmen, Einzelarbeit statt Gruppenarbeit, örtliche Begrenzung auf die Deutschschweiz, ein relativ kleines Sample und das Risiko sozialer Erwünschtheit bei den Antworten der InterviewteilnehmerInnen.
Welche Rolle spielt das Transtheoretische Modell (TTM) in der Studie?
Das TTM dient als theoretischer Rahmen für die Studie. Es wird verwendet, um die verschiedenen Stufen der Verhaltensänderung im Genesungsprozess von Alkoholkrankheit zu verstehen und die Anwendung spezifischer Strategien in den verschiedenen Stufen zu analysieren.
Welche Bedeutung haben die Anonymen Alkoholiker (AA) im Kontext der Studie?
Die Perspektive und das Krankheitskonzept der AA werden in der Studie berücksichtigt. Es wird untersucht, wie sich die Genesungsstrategien von Alkoholkranken, die die AA nutzen, von denen unterscheiden, die ohne formale Hilfe genesen sind.
Welche Instrumente werden im Text erwähnt, um Alkoholprobleme zu erkennen und zu beurteilen?
Im Text werden verschiedene Instrumente zur Erkennung und Beurteilung von Alkoholproblemen erwähnt, darunter der CAGE Questionnaire, der AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test), die CIWA (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale), der RCQ (Readiness to Change Questionnaire) und die Kurzintervention A-FRAMES.
Was sind mögliche Handlungsfelder für die Pflege im Umgang mit Alkoholkranken im Akutspital?
Mögliche Handlungsfelder umfassen die Identifizierung von Alkoholproblemen, die Kommunikation über das Problem, Aufklärung, Beratung und Überweisung an weitere Behandlungsangebote. Kurzinterventionen könnten ebenfalls durch Pflegende durchgeführt werden.
Details
- Titel
- „Aber sie sind nicht auf das Problem eingegangen“. Pflege im Akutspital aus der Sicht alkoholkranker Menschen
- Untertitel
- Eine empirische Studie nach dem Forschungsansatz der Grounded Theory
- Hochschule
- Fachhochschule Nordwestschweiz (Departement Gesundheit)
- Note
- 5.5 (CH)
- Autor
- Dipl. Gesundheits- und Pflegeexperte FH Andreas Bolliger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2002
- Seiten
- 98
- Katalognummer
- V116742
- ISBN (eBook)
- 9783640187119
- ISBN (Buch)
- 9783640190713
- Dateigröße
- 1074 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Note entspricht einer 1,5 in Deutschland.
- Schlagworte
- Problem Pflege Akutspital Sicht Menschen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Dipl. Gesundheits- und Pflegeexperte FH Andreas Bolliger (Autor:in), 2002, „Aber sie sind nicht auf das Problem eingegangen“. Pflege im Akutspital aus der Sicht alkoholkranker Menschen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/116742
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-