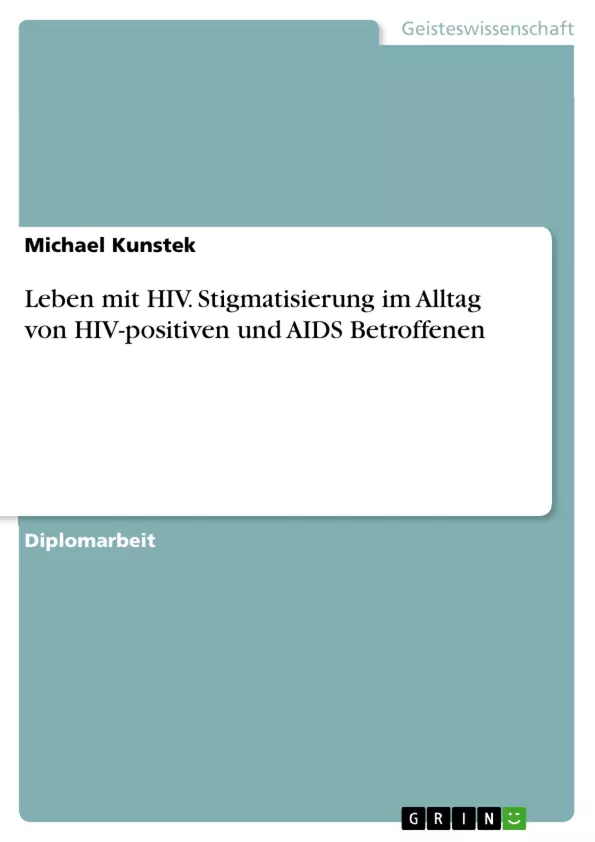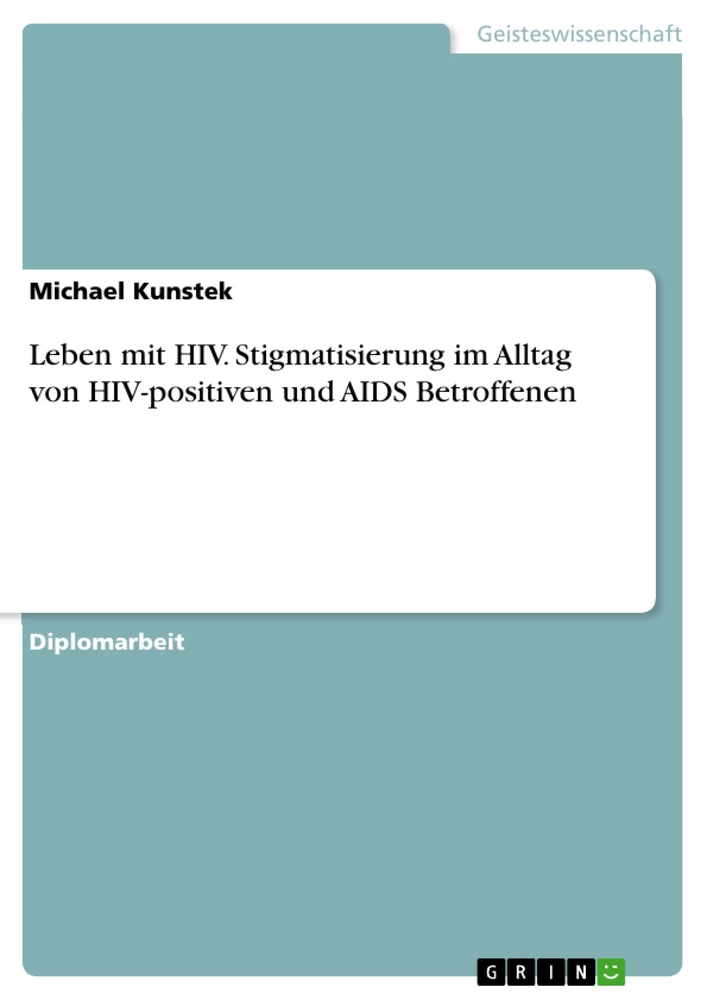
Leben mit HIV. Stigmatisierung im Alltag von HIV-positiven und AIDS Betroffenen
Diplomarbeit, 2018
32 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Problemdarstellung
- 1.1. Ziel
- 1.2. Fragestellungen
- 1.3. Methodik und Vorgehensweise
- 2. Humane Immunschwäche Virus (HIV)
- 2.1. Definition der Humane Immunschwäche Virus-Infektion
- 2.2. Verlauf der Humane Immunschwäche Virus-Infektion
- 2.2.1. Stadieneinteilung
- 2.2.2. Therapie
- 2.3. Diagnostik ELISA, Westernblood, PCR
- 2.4. Psychosoziale Belastung
- 3. Definition Stigmatisierung
- 3.1. Instrumentelles und symbolisches Stigma
- 3.1.1. Humane Immunschwäche Virus (HIV)-bedingte Stigmatisierung
- 3.2. Auswirkungen von Stigmatisierung für Betroffene
- 3.3. Bewältigung und Strategien von Humane Immunschwäche Virus - Infektion und Humane Immunschwäche Virus - bedingter Stigmatisierung
- 3.3.1. Bewältigungsphasen bei chronischer Erkrankung
- 3.3.2. Vorgehen gegen Stigmatisierung
- 3.4. Der Gedanke der kollektiven Selbsthilfe
- 3.4.1. Von der Opferrolle in die handelnde Position
- 4. Zusammenfassung und Erkenntnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Fachbereichsarbeit befasst sich mit der Stigmatisierung von Menschen mit HIV und AIDS. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Auswirkungen von Stigmatisierung auf das psychische Wohlbefinden der Betroffenen und auf die Frage, wie sie mit dieser schwierigen Situation umgehen. Die Arbeit beleuchtet, wie Stigmatisierung das Testverhalten und die damit verbundenen Gesundheitschancen von sexuellen Minderheiten beeinflusst.
- Auswirkungen von Stigmatisierung auf das psychische Wohlbefinden von HIV-positiven Menschen
- Die Bedeutung von Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stigmatisierung
- Die Rolle der kollektiven Selbsthilfe in der Bewältigung von Stigmatisierung
- Der Einfluss von Stigmatisierung auf das HIV-Testverhalten von sexuellen Minderheiten
- Die Herausforderungen im Bereich der Gesundheitsversorgung von HIV-positiven Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die historische Entwicklung der Stigmatisierung von Menschen mit HIV und AIDS beleuchtet. Sie stellt die Ziele der Arbeit sowie die wichtigsten Fragestellungen vor. Im zweiten Kapitel wird die Definition der HIV-Infektion und ihr Verlauf, einschließlich der Stadieneinteilung und Therapie, erläutert. Anschließend wird die psychosoziale Belastung von HIV-positiven Menschen thematisiert.
Im dritten Kapitel widmet sich die Arbeit dem Begriff der Stigmatisierung und ihren Auswirkungen. Es werden verschiedene Formen der Stigmatisierung, insbesondere die mit HIV verbundene Stigmatisierung, sowie deren Auswirkungen auf das Leben von Betroffenen betrachtet. Das Kapitel beleuchtet auch die Bewältigungsstrategien, die HIV-positive Menschen entwickeln, um mit Stigmatisierung umzugehen, und befasst sich mit dem Gedanken der kollektiven Selbsthilfe.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen HIV, AIDS, Stigmatisierung, Diskriminierung, psychische Gesundheit, Bewältigungsstrategien, Selbsthilfe, Gesundheitsversorgung, sexuelle Minderheiten, HIV-Testverhalten und Gesundheitschancen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich Stigmatisierung auf HIV-positive Menschen aus?
Stigmatisierung führt oft zu psychischen Belastungen, sozialer Ausgrenzung, Diskriminierung und kann sogar die physische Gesundheit verschlechtern, da Betroffene aus Angst vor Entdeckung medizinische Hilfe meiden.
Was ist der Unterschied zwischen instrumentellem und symbolischem Stigma?
Instrumentelles Stigma beruht auf der Angst vor Ansteckung, während symbolisches Stigma die Abwertung von Gruppen (z.B. Homosexuelle) aufgrund moralischer Vorurteile beschreibt.
Welche Bewältigungsstrategien gibt es für Betroffene?
Dazu gehören das Erlernen eines offenen Umgangs mit der Diagnose, die Suche nach Unterstützung in Selbsthilfegruppen und die psychologische Aufarbeitung der Erkrankung.
Warum ist das HIV-Testverhalten von Stigmatisierung betroffen?
Aus Angst vor einer positiven Diagnose und der damit verbundenen gesellschaftlichen Ächtung zögern viele Menschen, insbesondere aus Randgruppen, einen Test hinaus.
Welche Rolle spielt die kollektive Selbsthilfe?
Selbsthilfe hilft Betroffenen, aus der passiven Opferrolle in eine aktive, handelnde Position zu kommen und gemeinsam gegen Diskriminierung vorzugehen.
Details
- Titel
- Leben mit HIV. Stigmatisierung im Alltag von HIV-positiven und AIDS Betroffenen
- Note
- 1
- Autor
- Michael Kunstek (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 32
- Katalognummer
- V1170446
- ISBN (Buch)
- 9783346583611
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- HIV AIDS Stigmatisierung Prävention Bewältigungsstrategien
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Michael Kunstek (Autor:in), 2018, Leben mit HIV. Stigmatisierung im Alltag von HIV-positiven und AIDS Betroffenen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1170446
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-