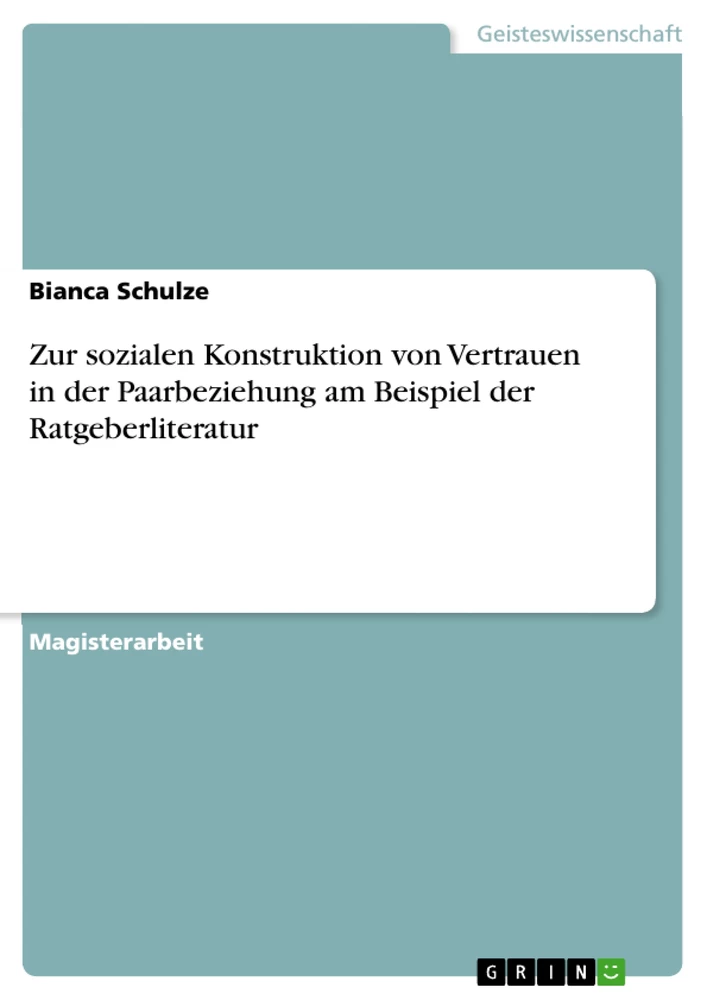
Zur sozialen Konstruktion von Vertrauen in der Paarbeziehung am Beispiel der Ratgeberliteratur
Magisterarbeit, 2004
89 Seiten, Note: 2.0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einführung
I. Zur Soziologie des Paares
1. Erste Begriffsbestimmung
2. Anfänge bei Simmel
3. Das Paar in der neueren soziologischen Diskussion
3.1. Das Paar und die Liebe
3.2. Die Intimität des Paares
II. Zur Soziologie des Vertrauens
1. Einführung
2. Ansätze zum Vertrauen aus verschiedenen Denkrichtungen
2.1. Vertrauen als soziales Kapital
2.2. Vertrauen als Mechanismus zur Reduktion von sozialer Komplexität
2.3. Vertrauen aus phänomenologisch-anthropologischer Perspektive
2.4. Vertrauen aus psychologischer und sozialpsychologischer Perspektive
2.5. Vertrauen als geistiges Phänomen
3. Vertrauen in der Paarbeziehung I
III. Die Entwicklung einer „Grounded Theory“ des Vertrauens in der Paarbeziehung
1.Einführung
1.1.Warum Ratgeberliteratur?
1.2. Einige kurze Bemerkungen zur „Brigitte“
1.3.Zur Auswahl der Artikel
2. Zur Methodologie
3. Vertrauen in der Paarbeziehung II
3.1. Die Spezifik des Vertrauens in der Paarbeziehung
3.2. Vertrauensfragen
4. Diskussion
5. Vertrauen in der Paarbeziehung III – eine substantive theory
5.1. Was ist Vertrauen?
5.2. Worauf bezieht sich Vertrauen in der Paarbeziehung?
5.3. Wie entwickelt sich Vertrauen in der Paarbeziehung?
5.4. Zur Funktion von Vertrauen in der Paarbeziehung
5.5. Zur Funktion von „Problemen“ – ein Exkurs
6. Die Treue-Untreue-Problematik im gesellschaftlichen Wertewandel – eine kleine Deutungsmusteranalyse
Zeitliche und soziale Verortung und soziale Folgen
Ein Schlußwort
Anhang I
Anhang II
Literatur
Einführung
Die vorliegende Magisterarbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Vertrauen in der Paarbeziehung zu behandeln. Der methodologische Ansatz liegt in der qualitativen Sozialforschung. Die von Strauss und Glaser entdeckte und in The Discovery of Grounded Theory (1967) beschriebene Methode ist die Basis dieses wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Teil I und II dienen zunächst dazu, in die Thematik einzuführen. Es werden die signifikanten Forschungsergebnisse und Theorien vorgestellt, die in dieser Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen und diskutiert werden. Teil I liefert eine Einführung in die Besonderheiten der Beziehung, die hier im Interesse steht. Teil II beschäftigt sich mit dem Phänomen, das in dieser Beziehung untersucht werden soll. Dazu kommen mehrere Ansätze aus unterschiedlichen Fachgebieten zu Wort. Auf dieser Grundlage basiert Teil III, der den Hauptteil der Arbeit ausmacht. Der Stil der Darstellung ist diskursiv, d.h. die Zusammenfassung der Erkenntnisse findet erst am Ende ihren Ausdruck. Dieser Stil wurde aus verschiedenen Gründen gewählt. Theoriebildung ist immer ein Prozeß. Auf dessen Unendlichkeit hat Weber bereits hingewiesen. Weiterhin ist die diskursive Darstellung vorzuziehen, weil damit dem Rezipienten die Möglichkeit gegeben wird, diesen Prozeß gedanklich nachzuvollziehen.
I. Zur Soziologie des Paares
1. Erste Begriffsbestimmung
Für die Art der Beziehung, die hier im Zentrum des Interesses steht, existieren in der soziologischen Literatur unterschiedliche Bezeichnungen mit wiederum unterschiedlicher Begriffsschärfe. Die „Dyade“ bezeichnet so grundsätzlich jede Art von Beziehung, in die zwei Personen involviert sind, seien dies Mutter-Kind, Arzt-Patient, Käufer-Verkäufer, Freund-Freundin etc. Bei dem Begriff „Zweierbeziehung“ steht man vor ähnlichen Schwierigkeiten, gründet die Bezeichnung doch ebenfalls auf der „Zwei-heit“, d.h. auf der strukturellen Tatsache, daß zwei Individuen (bzw. Gruppen) miteinander in Beziehung stehen. Die Bezeichnung „intime Beziehung“ stellt demgegenüber zweifellos einen Fortschritt dar, doch auch hier bleiben Unklarheiten bestehen. Die Beziehungen zwischen Eltern und Kind(ern) und zwischen Geschwistern sind ebenso durch Intimität gekennzeichnet wie die zwischen zwei Liebenden. Der Ausdruck „Partnerschaft“ ist gleichfalls ungenügend, findet er sich doch in zahlreichen anderen Gesellschaftszusammenhängen (Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Politik, uvm.) wieder und verweist zudem auf ein kulturelles Ideal der Gleichstellung (Lenz 1998: 44) Der Begriff „Paar“ wurde nun gewählt, weil es sich dabei um einen authentischen Begriff handelt. Sofort ist klar, daß es sich dabei um zwei Personen handelt, die „zusammen sind“.
Was bedeutet nun dieses „Zusammen-Sein“, was ist ein „Paar“? Bei Lenz findet sich folgende Definition: Bei einer Paarbeziehung[1] handelt es sich um eine „persönliche Beziehung zwischen [zwei] Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts, [... die] sich durch einen hohen Grad an Verbindlichkeit (Exklusivität) auszeichnet, ein gesteigertes Maß an Zuwendung aufweist und die Praxis sexueller Interaktion[2] einschließt bzw. eingeschlossen hat“ (ebd.: 45). Unter einem „Paar“ sind also zwei Individuen zu verstehen, die sich aus dysfunktionalen Gründen[3] zusammengefunden haben. Von einer „Paarbeziehung“ zu sprechen, bietet sich auch aufgrund der Tatsache an, daß heute verschiedene Beziehungsformen nebeneinander existieren und dabei alle oben genannten Kernbedingungen erfüllen. Das „Paar“ als zentrale Kategorie findet sich somit in der Ehe ebenso wie in Nicht-Ehelichen-Lebensgemeinschaften (NEL) und in Familien (damit sind alle Paare mit Kindern gemeint). Desgleichen ist es unerheblich, ob das Paar einen gemeinsamen Haushalt führt oder das sogenannte living apart together praktiziert. Wie die Paarbeziehung sich zu einem eigenen Zweig in der Soziologie auswuchs und in welchen Bereichen die Forschung bisher ihre Schwerpunkte setzte, davon handeln die nächsten zwei Kapitel.
2. Anfänge bei Simmel
In seinen Überlegungen zur „quantitativen Bestimmtheit der Gruppe“ hat sich Simmel unter anderem auch mit der Zweierbeziehung beschäftigt. Sein Ausgangspunkt ist jedoch das Individuum „als kleinste soziologische Einheit“ (Simmel 1968:55). Er legt dabei zugrunde, daß der einzelne ein soziales Wesen, d.h. geprägt durch die Beziehungen zu seinen Mitmenschen, ist. Die beiden spezifischen Erscheinungen der kleinsten Einheit „Individuum“ sind die Einsamkeit und die Freiheit, die nicht nur auf das Vorhandensein eines oder mehrerer anderer Individuen verweisen, sondern gleichfalls auf einen logischen Zusammenhang hindeuten. So ist mit der Einsamkeit „keineswegs nur die Abwesenheit jeder Gesellschaft, sondern gerade ihr irgendwie vorgestelltes und dann erst verneintes Dasein“ (ebd.) ausgedrückt. Das Gefühl der Einsamkeit kann mithin nicht empfunden werden ohne das Wissen um die Existenz der anderen. Auch die Freiheit ist ein relationaler Begriff. Laut Simmel ist sie „eine bestimmte Art der Beziehung zu der Umgebung, eine Korrelationserscheinung, die ihren Sinn verliert, wenn kein Gegenpart da ist“ (ebd.: 57). Freiheit ist also ebenfalls kontextabhängig. Zwei Beispiele zu Verdeutlichung: Freiheit kann erscheinen als Freiheit von etwas. Man kann frei sein von Beherrschung, von Verantwortung usw., wenn auch nicht bis in die letzte Konsequenz. Und, Freiheit ist immer auch eine Freiheit zu etwas[4], so beispielsweise die Freiheit zu wählen. Freiheit ohne Kontext, als Abstraktum, ist nicht denkbar. Sie ist eine Illusion in einem Raum, in dem sich alles bedingt. Der Ort der abstrakten Freiheit wäre das Nichts. Spricht man also von Freiheit, ist man immer mit einer semantischen Leerstelle konfrontiert. Diese Spezifika haben nun wiederum unmittelbaren Einfluß auf die Beziehung zu zweit.
Die Zweierbeziehung bildet von außen betrachtet eine überindividuelle Einheit. Das Paar konstituiert sich aus zwei Individuen und ist doch mehr als diese beiden zusammengenommen.[5] Es entsteht etwas Neues. Die beteiligten Personen hingegen sehen sich immer nur dem anderen gegenüber.[6] Das wohl wichtigste Strukturmerkmal ist die Abhängigkeit der Beziehung von den zwei Beteiligten. Mit dem Austritt jedes einzelnen würde das Ganze zerstört. Aus diesem Grunde beschwört diese Art der Beziehung „für das Gefühl einen Ton von Gefährdung und von Unersetzlichkeit“ (ebd.: 59f.) herauf. Das personale Aufeinander-Angewiesensein ist die Basis für Intimität, für das, „was ihre Teilnehmer nur miteinander, aber mit niemandem außerhalb dieser Gemeinschaft teilen“ (ebd.: 61). Dieser Umstand erklärt die starke Bindung und ist gleichzeitig verantwortlich für die Zerbrechlichkeit der Konstruktion. Die wechselseitige Einstellung der „gefühlsmäßigen Struktur“ (Simmel 1993: 351) auf den anderen, der Akzent auf die spezifischen Besonderheiten, läßt die Gemeinsamkeiten mit den anderen außerhalb der Zweierbeziehung in den fernen Hintergrund treten. Laut der Simmelschen These von der Notwendigkeit von Abwechslungsreizen bzw. Unterschiedsempfindungen ist jedoch ein bestimmtes Maß an Balance zwischen Intimität und alternierenden Reizen für die Stabilisierung der Beziehung notwendig (Nedelmann 1983: 205).
Die Kräfte, die für Konstitution und Aufrechterhaltung der Paarbeziehung verantwortlich sind, nennt Simmel primäre und sekundäre Emotionen. Das Paar nimmt seinen Ausgangspunkt idealiter bei der „reinen, erotischen Liebe“, deren Wesen sich an fünf Merkmalen errichten läßt: Sie ist 1. ein „nicht zu zerlegender, durch keine Kooperation anderer Elemente verständlich zu machender seelischer Akt“; 2. „eine primäre Emotion, als sie durch subjektive Willensakte weder hervorrufbar noch auslöschbar ist“; 3. beschwört sie einen Idealisierungsprozeß herauf, der zu den „typischen Fälschungen und Verschiebungen“ führt; 4. besteht eine weitere Besonderheit darin, daß sie den Fortfall ihres Entstehungsgrundes zu überleben vermag; und schließlich 5. bedarf sie aufgrund ihrer starken Verbundenheit mit der Dynamik des Lebens institutioneller Stützen[7] und emotionaler Ergänzungen (Nedelmann 1983: 178f.).
Emotionale Ergänzungen sind die sogenannten sekundären Gefühle, deren drei wichtigste Treue, Dankbarkeit und Vertrauen sind (ebd. 177). Simmel greift die Treue als wichtiges „Ergänzungsgefühl der Liebe“ heraus. Sie ist nicht auf Individuen, sondern auf den Bestand des Verhältnisses gerichtet. Treue ist zum einen apriorische Bedingung für die Bildung von Gruppen und „ergibt sich“ zum anderen im Bestand der Beziehung durch den gefühlsmäßigen Schluß des Fortbestandes. Sie ermöglicht es, daß sich die Liebe begleitende Gefühle der Gefährdung, Tragik und elegischer Problematik in Berechenbarkeit, Gewißheit und Alltäglichkeit umwandeln (ebd.: 183). Im Gegensatz zur primären Emotion „Liebe“ ist die Treue moralischen Vorannahmen zugängig, d.h. willentlich beeinflußbar. Im Simmelschen Verständnis können Liebe und Treue nicht gleichzeitig auftreten. Es vollzieht sich vielmehr ein Pendeln zwischen beiden Emotionen. Die „treue Liebe“ ist also unmöglich?[8] Nichtsdestominder attestiert Simmel der Treue eine „vereinigende Rolle“. Sie „fusioniere“ die Liebe mit den kulturellen Formen.
Die Einheit einer Gruppe entsteht also erst durch das Zusammenspiel verschiedener Emotionen von unterschiedlicher Qualität und Richtung. Wichtig ist die Art der Beziehungen zwischen primären Emotionen, institutionellem Kontext und sekundären Emotionen. Simmels grundlegende Überlegungen finden sich in zahlreichen Arbeiten zur Paarbeziehung wieder. Doch zunächst dauerte es einige Zeit, bis die Aufmerksamkeit der Sozialwissenschaftler in diese Richtung gelenkt wurde.
3. Das Paar in der neueren soziologischen Diskussion
Die gesellschaftlichen Umbrüche der späten 60er und 70er Jahre hinterließen ihre Spuren erwartungsgemäß auch in den Sozialwissenschaften. Das Paar löste sich innerhalb der Gesellschaft langsam als eigenständige Gruppe aus dem Familienverband, d.h. mit dem Eingehen einer Paarbeziehung war nicht automatisch die Heirat und Familiengründung vorgesehen. Das Paar existierte nun sozusagen um seiner selbst willen. Gleichfalls vollzog sich in der Soziologie ein Perspektivenwechsel. Der Definitionsschwerpunkt verlagerte sich vom institutionsbezogenen Denken hin zu personen- und interaktionsbezogenen Konzepten (Weiss 1995: 120). War das Paar zuvor im Kontext von Ehe und Familie thematisiert worden, begann sich nun allmählich ein eigener Zweig zu entwickeln.[9]
Eine Soziologie der Paarbeziehung kommt nicht umhin, das Thema ‚Liebe‘ zu behandeln. In den letzten Jahren wurde gar versucht, eine ‚Soziologie der Liebe‘ zu entwickeln (Burkart 1998; Alberoni 1998). Aus der Liebe wächst das, was man ‚Intimität‘ nennt. Selbige ist untrennbar mit der Liebe des Paares verbunden. Wollen wir also etwas über Vertrauen in einer solchen Beziehung herausfinden, ist es nur sinnvoll, sich zunächst ein genaueres Bild über ihre besonderen Merkmale zu verschaffen.
3.1. Das Paar und die Liebe
In der Kunst – die ebenso wie die Wissenschaft einen bestimmten Zugang zur Wirklichkeit und zum Leben an sich darstellt - hat die Liebe des Paares ganz selbstverständlich und scheinbar schon von jeher ihren Platz. Generationen von Künstlern haben versucht, ihr Wesen zu ergründen. Das älteste Zeugnis für die Wahrnehmung dieses Phänomens findet sich in der Liebesdichtung Ägyptens um ca. 1300 bis 1100 v. Chr. (Bergmann 1999: 18).
Liebe ist ein universales, menschliches Phänomen[10] ; also als Objekt der Soziologie geradezu geschaffen. Doch warum war man diesem Thema gegenüber lange Zeit so zurückhaltend? Denn: sowohl Simmel als auch Weber haben die Liebe in ihren Werken wenigstens angesprochen (Corsten 1993: 24). Nicht ganz abwegig erscheint die Vermutung, daß die Liebe ebenso wie das Paar es deshalb so schwer hatten, weil sie stark an das Forschungsfeld der Psychologie grenzen. Vieles scheint hier nicht aufgrund von sozialen Mechanismen, sondern aus der Psyche des Individuums heraus, zu geschehen. Und folglich herrscht hinsichtlich dieses Forschungsschwerpunktes ein Übergewicht zugunsten der Sozialpsychologie (Lenz 1998: 29). Manche Soziologen vertreten daneben die Auffassung, daß es die Liebe überhaupt nicht gibt. Damit versuche man bloß, den Sexualtrieb zu beschönigen. Wie man darüber auch denken mag, die „Gemeinschaft zu zweien“ stellt ohne Frage eine gesellschaftliche Wirklichkeit[11] dar und die vermeintlich mächtigste Kraft, die diese Gemeinschaft hervorbringt, ist die Liebe[12].
Das Bedürfnis, das Wesen der Liebe in Worten zu erfassen, setzt sich durch alle Jahrhunderte fort. Als Sprichwörter sind diese „Definitionsversuche“ Teil der Alltagskultur.[13] „Die Lieb‘ ist übel angelegt, die keine Lieb‘ herwider trägt.“; „Wer nicht eifert, liebt nicht.“; „Liebe überwindet alles.“; „Wo die Liebe hinfällt, da bleibt sie liegen, und wär es ein Misthaufen.“; „Wenn dir die Liebe ihre Brille aufsetzt, siehst du in dem Mohren einen Engel.“; „Wenn die Liebe so zunähme, wie sie abnimmt, fräßen sich die Eheleute vor Liebe.“; „Wo Liebe fehlt, erblickt man alle Fehler.“; „Wer Liebe bergen will, dem kriecht sie aus den Augen heraus.“; „Wer ohne Liebe lebt, ist lebendig tot.“; „Wer Lieb erzwingt, wo keine ist, der bleibt ein Narr zu aller Frist.“ (Fink-Henseler 1996: 355-360).
Doch Liebe ist nicht gleich Liebe. Die Versuche einer Liebestypologie reichen bis zu den Mythen des antiken Griechenlands zurück (Bergmann 1994: 40-58) und ihr Vokabular hat sich bis heute bewahrt. Da gibt es die Unterscheidung zwischen Eros, der Liebe vom Niederen zum Höheren, und Agape, der Liebe vom Höheren zum Niederen (Alberoni / Veca 1998: 22f.). Bierhoff (1997: 94f.) unterscheidet gar sechs Liebesstile: Eros (romantische Liebe), Mania (besitzergreifende Liebe), Storge (freundschaftliche Liebe), Agape (altruistische Liebe), Pragma (pragmatische Liebe) und Ludus (spielerische Liebe). Erich Fromm differenziert die Liebe nach ihren Objekten in Nächstenliebe, Mütterliche Liebe, Erotische Liebe, Selbstliebe und die Liebe zu Gott (Fromm 1995).
In „Liebe als Passion“ stellt Luhmann (1982) die These voran, daß die Darstellungen der Liebe von den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen beeinflußt sind. Dies wird anhand der geschichtlichen Entwicklung des Liebescodes dokumentiert.[14] Im Rahmen dieser Arbeit ist ein Aspekt von besonderer Bedeutung: Der Einbezug der Sexualität in die Liebessemantik im 17. Jahrhundert. Sexualität wurde für die Liebe essentiell. Während die Literatur des 18. Jahrhunderts das Ideal der „romantischen Liebe“ hervorbringt, vollendet schließlich das 19. Jahrhundert den Gedanken an die Liebe als die „Idealführung und Systematisierung des Geschlechtstriebs“ (ebd.: 53). Liebe und Intimität erfahren eine starke Verflechtung. Das Ideal der „romantischen Liebe“ – wenngleich in verzerrter Form[15] - setzt sich gesamtgesellschaftlich durch.
Die „romantische Liebe“ läßt sich in wenig prosaischen Worten wie folgt charakterisieren: Liebe ist die „Koinzidenz von Selektion und Höchstrelevanz“ (Tyrell 1987: 571), das bedeutet, die Präferenz einer bestimmten Person und die Besetzung dieser Person mit höchster persönlicher Relevanz. Es kann folglich nur ein Mensch Gegenstand der (romantischen!) Liebe sein. Ein weiteres Reglement ist die Gegenseitigkeit und unbedingte Symmetrie. Der Liebescode ist strikt binär: es gibt nur ein Ja oder Nein, Liebe oder Nichtliebe, Glück oder Unglück (ebd. 579f.). Die romantische Liebe kennt keine Kompromisse und schließt jeden Dritten aus. Sie ist die „individualisierte Intimität zu zweit“ (ebd.: 575).
3.2. Die Intimität des Paares
Mit Intimität verbindet man im Alltagsverständnis eine gewisse Vertraulichkeit und Nähe, aber auch Exklusivität und Verletzlichkeit. Intime Beziehungen finden sich im familialen wie auch im freundschaftlichen Bereich. Allein von ganz besonderer Färbung ist die Intimität in der Paarbeziehung. Luhmann definiert sie als hohe „zwischenmenschliche Interpenetration“ und meint damit das Senken der Relevanzschwelle mit der Folge, daß was für den einen relevant auch für den anderen so ist (Luhmann 1982: 200). In der Liebe als „System der Interpenetration“ geht es „um den anderen Menschen, der in meiner Umwelt meiner Welt Sinn zuführen könnte, aber dies nur kann, wenn ich ihn und seine Umwelt als meine akzeptiere. [...] sie hat zu beachten, daß sie als Handlung des einen Systems zugleich Erleben des anderen ist, und das ist nicht nur eine äußerliche Identifikation, sondern zugleich Bedingung ihrer eigenen Reproduktion. Man kann in Liebe nur so handeln, daß man mit genau diesem Erleben des anderen weiterleben kann. Handlungen müssen in die Erlebniswelt eines anderen eingefügt [...] werden.“ (ebd.: 219). In der Liebe sucht das Individuum die Aufhebung der Vereinzelung, wie sie vor der Geburt und nach dem Tod gedacht wird (Bataille 1994: 17).[16] Der Ausgangspunkt der Luhmannschen Theorie von der Interpenetration ist eben diese Sehnsucht und zugleich die Unmöglichkeit ihrer Erfüllung.
Wie bereits angedeutet, ist die Existenz von Grenzen für Intimität unabdingbar. Damit ist nicht nur die Abgrenzung des Paares von den anderen gemeint, sondern ebenso die Schaffung klarer persönlicher Grenzen innerhalb der Beziehung. Intimität bedeutet nicht, daß einer den anderen absorbiert. Vielmehr geht es darum, die Eigenheiten des anderen zu kennen. Um sich einander zu öffnen und miteinander zu kommunizieren, bedarf es eben dieser Grenzen,[17] wie auch Sensibilität und Taktgefühl, „[...] because it is not the same as living with no thoughts at all“ (Giddens 1992: 94). So nahe sich die Partner auch kommen, die Wahrung einer persönlichen Sphäre ist für die Aufrechterhaltung der Liebe unentbehrlich. Intimität ist nicht zu verwechseln mit schrankenlosem Sich-Gehenlassen, sondern erfordert gerade ein hohes Maß an Respekt. Dies betrifft sowohl den Körper als auch den Geist.
Die psychische Seite von Intimität besteht in der vertraulichen Kommunikation des Paares. Ausgangspunkt ist hierbei die gemeinsame Innenwelt (bzw. deren Fiktion) und die darauf basierende Gestaltung der äußeren Lebensführung. Die kommunikativ konstruierte Beziehungswirklichkeit hat die Funktion der Vergewisserung geteilter Gefühle, Meinungen und Weltbilder (Loenhoff 1998: 203; Berger / Kellner 1965; Hahn, A. 1983). Die Besonderheit der intimen Paarkommunikation liegt in Stil und Thematik. Paare entwickeln oft eine „eigene“ Sprache. Der physische Aspekt von Intimität bezieht sich wesentlich auf die Sexualität. Die sexuelle Interaktion ist die „Kernzone der dyadischen Exklusivität“ (Tyrell 1987: 588). Das Sexuelle erfährt hier eine romantische Umdeutung in das schlechthin Intime; es wird zum „Intimitätssymbol“ (Willi 1991: 104). Die „Verdichtung sozialer Wirklichkeit durch Zugang zur Körpersphäre des anderen und dem damit verbundenen Integrationspotential“ ist charakteristisch für Intimbeziehungen (Loenhoff 1998: 207).
Diese Vorüberlegungen zur Paarbeziehung waren nötig, um sich zunächst der Besonderheit dieser sozialen Gruppierung bewußt zu werden. Sie sind die Grundlage, auf der das zentrale Thema der Arbeit aufbaut: Vertrauen. Auch hier sind in der Soziologie einige Ansätze entstanden, nachdem dieses Feld lange Zeit nur von den Religionswissenschaften bearbeitet wurde. Der wissenschaftlichen Auseinandersetzung schlossen sich bald die Wirtschaftswissenschaften und gleichfalls die Psychologie und Sozialpsychologie an.
II. Zur Soziologie des Vertrauens
1. Einführung
Mit dem Vertrauen hat es etwas Mysteriöses auf sich. Jeder weiß, was es ist, aber sobald man es erklären soll, fehlen einem die Worte. Vertrauen wird oft versucht, anhand von Beispielen, eigenen Erlebnissen oder Vergleichen zu erklären. So z.B.: „Vertrauen ist, nicht darüber nachzudenken.“; „Vertrauen bedeutet, sich auf jemanden verlassen können.“ Man kann zunächst einmal annehmen, daß es so etwas wie das Vertrauen gibt. Denn, stellt man im Alltag die Aufgabe, Vertrauen in einem Satz zu beschreiben, fragt niemand nach dem Kontext. Vertrauen ist etwas so Selbstverständliches, so lange es nicht thematisiert wird, daß man erstaunt ist, es nicht mit Worten allein fassen zu können. Die nächste alltagsnahe Schlußfolgerung besteht darin, daß es sich bei Vertrauen um ein Gefühl handelt und es deswegen so schwer zu beschreiben ist. Ist Vertrauen ein Gefühl? Wir erinnern uns, daß Simmel Vertrauen als eine sekundäre Emotion definiert hat. Wie sahen bzw. sehen das andere Soziologen?
Das zweite Kapitel soll dazu dienen, einen kurzen Überblick über die bisherige sozialwissenschaftliche Forschung zum Thema Vertrauen zu geben. Erst in den letzten Jahren hat das Interesse an diesem Thema zugenommen und unterschiedlichste Ansätze in den verschiedenen Teildisziplinen[18] hervorgebracht. Vordem wurde dieses Phänomen durchaus des öfteren angesprochen, blieb aber mindestens ebenso häufig nur ein Randaspekt (Preisendörfer 1995: 263). Die „Paralyse“ in der soziologischen Diskussion war, Gambetta (1988) zufolge, auf die Allgegenwart von Vertrauen im täglichen Leben zurückzuführen. Im folgenden sollen die Versuche, die dennoch unternommen wurden, um das Problem zu erfassen, vorgestellt werden. Aus dem Bereich der Soziologie betrifft dies zum einen Coleman, als Vertreter der Rational Choice Theory sowie Luhmanns Konzept aus systemtheoretischer Perspektive. Als nächstes folgt Endreß‘ phänomenologisch-anthropologischer Ansatz, gefolgt von zwei Vertretern aus Psychologie und Sozialpsychologie. Schlußendlich werfen wir noch einen Blick auf eine geisteswissenschaftliche Herangehensweise. Das dritte Kapitel widmet sich schließlich der zusammenfassenden Darstellung von bereits vorhandenen Definitionen, Studien und Erkenntnissen in bezug auf das Vertrauens in der Beziehung des Paares.
2. Ansätze zum Vertrauen aus verschiedenen Denkrichtungen
2.1. Vertrauen als soziales Kapital
Coleman erklärt Vertrauen vorrangig aus ökonomischer Perspektive. Ausgangspunkt sind sogenannte soziale Transaktionen. Diese erzeugen zeitliche Asymmetrien, wodurch für eine Partei, nämlich die, welche Leistungen im Voraus erbringt, ein Risiko entsteht. Damit es nun überhaupt zu einer Transaktion kommen kann, ist eine Vertrauensvergabe notwendig. Darunter versteht Coleman eine „Entscheidung unter Risiko“ (Coleman 1991: 125). Ausschlaggebend für die Entscheidung, Vertrauen zu vergeben, ist der mögliche Verlust bzw. Gewinn und die Wahrscheinlichkeit beider Möglichkeiten. Im Gegensatz zum möglichen Gewinn ist der mögliche Verlust meist gut bekannt. Der wichtigste Faktor zur Einschätzung der Gewinnwahrscheinlichkeit sind Informationen. Und je größer der zu erwartende Verlust bzw. Gewinn, umso mehr gilt die Aufmerksamkeit der Informationsbeschaffung.[19]
Welchen Grund – außer einer internalisierten moralischen Norm - hat nun derjenige, dem Vertrauen entgegengebracht wird, dieses nicht zu mißbrauchen (ebd.: 138)? Im Falle eines Vertrauensbruches muß der „Täter“ mit Verlusten in der Zukunft rechnen, da seine Vertrauenswürdigkeit gelitten hat. Daraus folgen zwei Schlüsse: 1. Ist die Beziehung eine fortdauernde, sind bei einem Vertrauensbruch größere Verluste zu erwarten, wohingegen bei einer einmaligen Transaktion ein Vertrauensmißbrauch sogar von Vorteil sein kann. 2. Je umfassender die Kommunikation zwischen dem Vertrauenden und anderen Akteuren, von denen der, dem Vertrauen entgegengebracht wird, in Zukunft Vertrauen genießen will, umso vertrauenswürdiger ist er. Es ist somit nur vernünftig, das entgegengebrachte Vertrauen nicht zu enttäuschen und damit nicht zukünftige Gewinne zu verlieren (ebd.: 142). Es ist zudem sinnvoll, zwischen symmetrischen und asymmetrischen Vertrauensverhältnissen zu unterscheiden. So ist in Systemen gegenseitigen Vertrauens mit hoher Wahrscheinlichkeit eine positive Rückkopplung, d.h., „daß die Dynamik zu einem erhöhten Ausmaß der Vertrauensvergabe und Vertrauenswürdigkeit führt“ (ebd.: 229), zu erwarten. Bei einer Vertrauensbeziehung, die durch besondere Nähe oder auch Abhängigkeit gekennzeichnet ist, bietet sich obendrein die Strategie des „Überbezahlens“ (ebd.: 231) an. Damit schafft man beim Einlösen einer Verpflichtung zugleich eine neue und versichert sich so auch in Zukunft der Loyalität des Gegenüber.
Das Colemansche Vertrauen ist eine Art soziales Kapital, welches man investiert. Je höher die Vertrauenswürdigkeit der Akteure ist, umso höher ist das soziale Kapital. Seine Ausführungen treffen die Gegebenheiten des Marktes, wo man Gewinne und Verluste im Vorhinein kalkuliert, Wahrscheinlichkeiten berechnet und Verträge schließt. Die Vertrauensvergabe seiner Akteure ist in jedem Fall das Resultat rationaler Überlegungen. Aber, stellen wir im täglichen Leben wirklich komplizierte Wahrscheinlichkeitsberechnungen an, bevor wir vertrauensvoll handeln? Ist die Einschätzung von Vertrauenswahrscheinlichkeiten mit Vertrauen gleichzusetzen?
2.2. Vertrauen als Mechanismus zur Reduktion von sozialer Komplexität
Luhmanns Überlegungen zum Vertrauen basieren auf der Annahme der äußersten Komplexität der Welt. Damit folgt er Weber, der die Wirklichkeit als ein Chaos und das Leben als einen unendlichen Ablauf von sowohl nebeneinander- als aufeinanderfolgenden Vorgängen in und außer uns beschreibt (Weber 1991: 171). Die Tatsache, daß die Welt mehr Möglichkeiten bereithält, als man sich vorstellen kann, und folglich die Erfahrung, daß mein Zugang zur Welt nicht gleich deinem ist, birgt das „Potential zu einer ‚radikalen‘ Verunsicherung unseres Selbst in der Welt durch das Andere“ (Luhmann 1989: 5). Um diese Verunsicherung zu ertragen, braucht es ein gegenläufiges Phänomen. Das Vertrauen.
Vertrauen richtet sich in die Zukunft und überbrückt damit die unsichere Zeitspanne zwischen dem Jetzt und dem Später. Eine Theorie des Vertrauens ist somit von einer Theorie der Zeit abhängig. Menschlichem Zeiterleben liegt, trotz des ständigen Wechsels von Impressionen, ein Erleben von Dauer zugrunde. So ist die Gegenwart ein Kontinuum im Wechsel der Ereignisse. Vertrauen kann nur in der Gegenwart geschenkt werden. Weder die Vergangenheit noch die Zukunft ist imstande Vertrauen zu erwecken.[20] Denn auch das Gewesene ist nicht sicher „vor der Möglichkeit künftiger Entdeckung einer anderen Vergangenheit“ (ebd.: 12) und der Zukunft ist die Ungewißheit inhärent. Obzwar auch die Enttäuschung von Vertrauenshoffnungen an die Gegenwart gebunden ist, ergeben sich zum einen Auswirkungen hinsichtlich der Interpretation der Vergangenheit und zum anderen Konsequenzen für die Zukunft.
Vertrauen hat die Funktion, die Komplexität der sozialen Welt zu reduzieren. Das unendliche Maß an Möglichkeiten in der Zukunft muß auf das Maß der Gegenwart zurückgeschnitten werden (ebd.). Durch Vertrauen werden Planungen in der Gegenwart verankert. Voraussetzung für Vertrauen ist Vertrautheit, welche sich auf die Vergangenheit bezieht. Reduktion von Komplexität findet demgemäß sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit statt. So ist Geschichte nichts anderes als retrospektive Reduktion der Vergangenheit und Planungen u.ä. eingeschränkte Vorwegnahmen von Zukünftigem
Vertrauen ist eine Willensleistung. An die Stelle der äußeren Komplexität setzt das System innere Sicherheit. Sein Zustandekommen kann auf zwei Arten motiviert sein (ebd.: 28). Einmal kann das Vertrauensobjekt für die „innere Struktur der Erlebnisverarbeitung eine unentbehrliche Funktion“ innehaben, und eine Erschütterung hätte sehr weitreichende Folgen für das Selbstvertrauen. In diesem Fall wird der Gedanke an einen möglichen Vertrauensmißbrauch nicht zugelassen, da dies konsequenterweise zu zeit- und kraftraubenden internen Umstrukturierungen führen müßte. Enge soziale Beziehungen, wie Freundschaften und Partnerschaften aber auch Notgemeinschaften, sind hier beispielhaft anzuführen. Ein anderes Mal bewirkt die starke innere Differenzierung, daß im Fall des Vertrauensmißbrauchs „nur partielle und isolierbare Schäden“ verursacht werden. Dies ist z.B. der Fall, wenn die potentiellen Verluste gering sind und sich das Ausmaß des Vertrauens in Grenzen hält.
Auf der Ebene des Persönlichen bedeutet Vertrauen „die generalisierte Erwartung, daß der andere seine Freiheit, das unheimliche Potential seiner Handlungsmöglichkeiten, im Sinne seiner Persönlichkeit handhaben wird – oder genauer, im Sinne der Persönlichkeit, die er als die seine dargestellt und sozial sichtbar gemacht hat“ (ebd.: 40). Steht die Selbst darstellung mit dem Handeln in Einklang, erzeugt sie Wirklichkeit und hat verpflichtenden Charakter.
Mißtrauen wird oft fälschlicherweise als Antonym zu Vertrauen betrachtet. Es handelt sich dabei aber nicht um positive und negative Ausprägungen eines Phänomens, sondern um funktionale Äquivalente. Beide dienen der Reduktion von Komplexität, wobei das Mißtrauen weniger stark von Informationen abhängt. Vertrauen und Mißtrauen sind außerdem keine universellen Einstellungen, sondern Reaktionsmuster, d.h., sie entfalten sich innerhalb einer Situation (ebd.: 80). Nun gesetzt den Fall, die Entscheidung in einer bestimmten Situation ist zugunsten des Vertrauens gefallen und derjenige, dem dieses Vertrauen gilt, mißbraucht es. Während der Vertrauende für sich Komplexität verringert, lädt sich der das Vertrauen (heimlich!) Mißbrauchende zusätzliche Komplexität auf, denn er muß „eine sehr weitreichende Beherrschung der relevanten Informationen und eine lückenlose Kontrolle der den Vertrauenden zugänglichen Nachrichten sicherstellen, so daß er selbst Gefahr läuft, unter dem Druck der Komplexität zusammenzubrechen“ (ebd.: 70). Es ist in Dauerbeziehungen mithin einfacher, das Vertrauen zu rechtfertigen, da Unaufrichtigkeit ein hohes Maß an Selbstbeherrschung verlangt (ebd.: 79).
Eine weitere Unterscheidung betrifft die gegenstandsverwandten Begriffe Vertrauen und Zuversicht (Luhmann 2001: 147f.). Beide Erscheinungen bergen ein Risiko, denn sie beziehen sich auf Erwartungen, die enttäuscht werden können. Ihre Unterscheidung basiert auf Wahrnehmung und Zuschreibung. Die Zuversicht zieht keine Alternativen in Betracht und im Enttäuschungsfall schreibt man dies den äußeren Umständen zu. Vertrauen dagegen zieht eine Handlungsweise anderen vor, obwohl die Gefahr der Enttäuschung besteht. Tritt letzteres ein, sucht man die „Schuld“ bei sich selbst und bereut die vertrauensvolle Wahl.
Vertrauen bei Luhmann ist eine existentielle Notwendigkeit. Es ist eine Art sozialer Klebstoff, ohne den Gesellschaft nicht möglich wäre.
2.3. Vertrauen aus phänomenologisch-anthropologischer Perspektive
Die existierenden soziologischen Beiträge zum Vertrauen[21] meint Endreß als eine Verengung des Themas zu erkennen. Sein Alternativvorschlag ist ein phänomenologisch-anthropologischer Ansatz (Endreß 2001: 163). Vertrauen ist selbstwirksam, d.h. nicht aus einem reflexiven Entschluß heraus erklärbar. Es stützt sich vielmehr auf Annahmen über Handlungen, Haltungen und Habitualitäten anderer und fungiert in sozialen Beziehungen als „grundlegender Modus des Sich-wechselseitig-Begegnens auf der Basis gewachsener Vertrautheit“ (ebd.: 168). Vertrauen ist klar zu trennen von Begriffen wie Gewohnheit oder Selbstverständlichkeit. Während Gewohnheit eine routinemäßig vollzogene Praxis bezeichnet, handelt es sich bei Selbstverständlichkeit um eine kognitive oder normative Standardisierung bzw. Legitimierung des Verhaltens (ebd.: 169). Eine Vertrauensbeziehung ist ebenfalls klar zu unterscheiden von einem Abhängigkeitsverhältnis. Letzteres steht im Widerspruch zu einem „frei gewählten sozialen Bezug[.] aufgrund bestimmter Relevanzkriterien“ (ebd.: 170), welcher ein Vertrauensverhältnis ausmacht. Vertrauen hat gleichfalls nichts gemein mit blinder naiver Zutraulichkeit, Ausgeliefertsein oder einem gedankenlosen Sich-Nähern. Konstitutiv für Vertrauen ist eine spezifische Toleranz für Varianzen als Bündel anerkannter Alternativen.
Vertrauen in phänomenologisch-anthropologischer Perspektive läßt sich zusammenfassend folgendermaßen beschreiben: Es hat einen kognitiven Vergangenheitsbezug und ist pragmatisch eingespielt. Vertrauen bleibt implizit bis zur Enttäuschung, denn erst im Nachhinein wird einem bewußt, daß man vertraut hat.[22] Vertrauen vollzieht sich als Beziehung zwischen zwei Akteuren und kann somit nicht als einseitige Vorleistung gedeutet werden. Dies erhellt auch, weshalb schon die Thematisierung des Vertrauens ein Indikator für eine latente Beziehungskrise sein kann.
2.4. Vertrauen aus psychologischer und sozialpsychologischer Perspektive
In der Psychologie drückt Vertrauen die Hoffnung darauf aus, daß „der andere für mich irgendwann das tut, was ich für ihn getan habe“ (Petermann 1996: 12). Motivationsprinzip ist hier die Idee der Wiedergutmachung. Die Fähigkeit des Vertrauens entspringt dem sogenannten „Urvertrauen“ (Erikson 1973), das als Eckstein einer stabilen Persönlichkeit angesehen wird. Vertrauen läßt sich weiter präzisieren als ein Zusammenspiel von Einfühlungsvermögen und Selbstwirksamkeit. Empathie, die Fähigkeit, sich in die Lage eines anderen versetzen zu können, ist Vorbedingung für kooperatives Verhalten und hilft, die Absichten und Bedürfnisse des Gegenübers zu registrieren. Einfühlungsvermögen verringert das Risiko, anderen ungerechtfertigt zu vertrauen (ebd. 109f.). Das wiederum hat einen positiven Effekt auf das Selbstvertrauen. Selbstwirksamkeit bezeichnet das Vertrauen darauf, etwas bewirken zu können. Zweifel an den eigenen Fähigkeiten wirken sich hinderlich auf die Problemlösung aus.
Vertrauen entsteht und vergeht. Der Prozeß des Vertrauensaufbaus gliedert sich in drei Aspekte: dem Herstellen einer verständnisvollen Kommunikation, dem Abbau bedrohlicher Handlungen und schließlich dem gezielten Aufbau von Vertrauen durch Übertragung von bewältigbaren, aber dennoch anspruchsvollen Aufgaben. Handlungsweisen, die den Vertrauensverlust nach sich ziehen, bestehen umgekehrt im Zerstören einer vertrauensvollen Kommunikation, der Wahl bedrohlicher Handlungen und im gezielten Vertrauensbruch durch Zynismus und Geringschätzung der Kompetenzen des Partners (ebd.: 155-120).
Der Sozialpsychologe Laucken nähert sich dem Vertrauen über die Umgangssprache. In ihr verbirgt sich das Umgangswissen, welches „reicher als jede existierende psychologische, soziologische oder biologische Theorie“ (Laucken 2001: 62) sei. Sein Meßinstrument ist der „Wegdenk-Test“, d.h. alles, was diesen Test nicht übersteht, ist obligatorisch. Das konstitutive Minimum, also der Kern des Vertrauens, ist die „NSZ-Erwartung (Nicht-Schaden-Zufügens-Erwartung)“ (ebd.: 19ff.). Als Verweisungszusammenhang führt er die Befindlichkeitsdifferenz sorgenvoll / sorglos ein. Vertrauen ist ein existentieller Akt; man schlägt sich in die „sorgenträchtige Welt eine Schneise der Sorglosigkeit“ (ebd.: 25). Für das Vertrauen sind emotive aber auch kognitive Momente bedeutsam, weshalb man von nicht-bewußtem oder unbewußtem Vertrauen nicht sprechen kann. Die Erwägung eines möglichen Schadens muß zumindest einmal aufgeflammt sein ( ebd.: 29). Die Gewährung von Vertrauen erzeugt – im positiven Fall – beim Gegenüber sogenannte Bemühungshandlungen, die dazu dienen, das Vertrauen zu rechtfertigen. Beispiele für solche Handlungen sind Ehrlichkeit, Versprechen halten, Verständnis, Beistand, Unterstützung, Treue, etc. Solche Bemühungshandlungen können motiviert sein durch Zuneigung, Werte, das Austauschprinzip und äußeren oder inneren Druck (ebd.: 33f.).
Um Vertrauensbeziehungen zu verstehen, muß man den Plot, d.h. Geschichte und Handlung, verstehen. Um diesen Plot zu rekonstruieren, übernimmt Laucken das Prinzip der Valenzgrammatik[23] und entwirft Vertrauen als einen Frageraum, bestehend aus thematischen Leerstellen (z.B. soziale Situation, Vertrauender, Vertrauensperson, Handlungsvorhaben, etc.). Die obligatorischen Komponenten des Vertrauens lassen sich im umgangssprachlichen Kontext mit „Wenn-Dann-Obwohl-Weil-Dabei-Deshalb-Somit“ ausdrücken (ebd.: 23). Ein Beispiel: Wenn ich vorhabe, einer ‚flüchtigen Bekannten‘ ein Buch zu leihen, dann tue ich das, obwohl ich weiß, daß die Möglichkeit besteht, daß ich es nicht zurück bekomme, weil ich aber glaube, daß diese Bekannte sich bemühen wird, es mit zurückzugeben; Dabei bin ich mir bewußt, daß der mögliche Schaden beträchtlich sein kann, und deshalb erwarte ich, daß ich das Buch verleihen kann, ohne einen Schaden befürchten zu müssen; somit vertraue ich.
2.5. Vertrauen als geistiges Phänomen
Vertrauen ist hier ein geistiger Zustand, der bestimmt ist durch die Tatsache, daß keine anderen Geisteszustände auftreten (Lagerspetz 2001: 86). Mit dem Vertrauen verhält es sich ähnlich wie mit der Luft: erst sein Fehlen macht es der Wahrnehmung zugänglich. Des weiteren ist Vertrauen unspezifisch, d.h. es wird nicht explizit festgelegt, welche Dinge eingeschlossen sind (ebd.: 95). Vertrauen kann man nicht „tun“; es ist keine geistige Aktivität ebensowenig wie ein Vorhaben. Man kann demnach von Vertrauen nicht in der ersten Person sprechen, sondern nur aus der Position eines Dritten, als Beobachter. Denn, ist man sich seines Vertrauens bewußt, so Lagerspetz, vertraut man nur wenig oder gar nicht. Damit erklärte sich auch die Tatsache, daß sich Vertrauen oft in Unterlassungen bekundet. Vertrauen wird durch den Verrat thematisiert, aber Vertrauen heißt deshalb nicht, den Verrat in Erwägung zu ziehen. Die Trennlinie zwischen Vertrauen und Mißtrauen verläuft nicht zwischen Reflexion und Nicht-Reflexion, sondern zwischen Glauben und Nicht-Glauben (ebd.: 107).
[...]
[1] Lenz verwendet den Begriff „Zweierbeziehung“. Aus oben genannten Gründen habe ich mich jedoch für den Terminus „Paarbeziehung“ entschieden. Die Definition bleibt davon unbeeinflußt.
[2] Interaktion als Begriff wird im folgenden synonym zu Kommunikation verwendet. Denn jede Kommunikation ist Interaktion und vice versa.
[3] Dazu folgen genauere Ausführungen im Kapitel über die Liebe.
[4] Das Wort ‚Freiheit‘ ruft im allgemeinen positive Assoziationen hervor. Es ist jedoch anzumerken, daß die ‚Freiheit‘ auch eine negative semantische Option enthält. Man kann so ‚frei sein von‘ und ‚frei sein zu‘, daß man sich verloren fühlt. Man ist dann frei von Zwängen und Kontrolle, aber auch von Sicherheit.
[5] In Anlehnung an Aristoteles: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
[6] Hier ist anzumerken, daß sich – möglicherweise durch den Boom der Ratgeberliteratur und im Zuge der Paartherapie – das Bewußtsein gewandelt hat Es ist heute geradezu eine alltägliche Erfahrung, daß Paare über ihre „Beziehung“ reden.
[7] Darauf soll hier nicht weiter eingegangen werden. Es handelt sich sicherlich um die Ehe und damit im Zusammenhang stehende Rituale und Mechanismen.
[8] Das Pendeln zwischen Liebe und Treue, also deren Unvermischbarkeit, ließe sich so erklären, daß wenn das Pendel zur Liebe hin ausschlägt, Treue fraglos inhärent ist. Schlägt das Pendel dagegen in Richtung Treue, übernimmt diese für die Zeit des temporären Nachlassens der Liebe abstützende und überbrückende Funktion.
[9] Eine Einführung bietet Lenz 1998.
[10] Von 168 verschiedenen Völkern fanden die Anthropologen Jankoviak und Fischer (1992) in 87% der Fälle direkte Nachweise für die romantische Liebe. Zitiert nach Alberoni 1998.
[11] Klein (1999: 479f.) stellt für die Bundesrepublik fest, daß sie unverändert eine „Paargesellschaft“ sei – entgegen allen Unkenrufen vom Ende der Familie und Partnerschaft. Klein führt an, daß die Fehlinterpretationen daher rühren, daß Ein-Personen-Haushalte mit Single-Haushalten gleichgesetzt wurden. Dies jedenfalls war der fortschreitenden Pluralisierung der Lebensformen nicht angemessen und mußte folglich zu Fehlinterpretationen führen.
[12] Sofern keine nähere Bezeichnung erfolgt, soll hierunter die „romantische Liebe“ verstanden werden.
[13] In den Sprichwörtern finden sich viele Aspekte, die auch in einer wissenschaftlichen Definition vorkommen. So das Prinzip der Gegenseitigkeit, die Überwindung von Grenzen jedweder Art, die Idealisierung des Liebesobjektes uvm. Aus diesem Grunde sollte eine kleine Auswahl an Sprichwörtern hier nicht verwehrt werden.
[14] Weiterhin gibt es Untersuchungen zu kulturellen (Grutzpalk 2000), milieuspezifischen (Maier 1998) und geschlechtsspezifischen Unterschieden (Reinprecht/Weiss 1998; Lautmann 1998; Simmel 1993) Die Auswahl ist freilich nur beispielhaft.
[15] (Lenz 1998: 273) Das romantische Ideal betonte androgyne Tendenzen, indes in der Realität die Polarisierung der Geschlechter unter Berufung auf eben jenes Ideal vorangetrieben wurde. Auch betonte das Ideal nicht die „erste Liebe“, sondern die „wahre Liebe“. Anspruch auf Beziehungserfahrungen hatten somit beide Geschlechter.
[16] Man denke dabei auch an Platons zweite Theorie der Liebe: von den Menschen mit zwei Gesichtern, vier Armen und Beinen, die in zwei Hälften gespalten worden waren: „Als nun so ihre ursprüngliche Gestalt in zwei Teile gespalten war, ward jede Hälfte von Sehnsucht zur Vereinigung mit der anderen getrieben: Sie schlangen die Arme umeinander und schmiegten sich zusammen, voll Begierde zusammenzuwachsen.“ (Zitiert nach: Bergmann 1994: 70ff.)
[17] In diesem Zusammenhang kommt mir der Bataillesche Gedanke vom Verbot und seiner Überschreitung erneut in den Sinn. Dabei stellt das Verbot die Grenze dar. Ohne dieses Verbot bzw. diese Grenze wäre eine Überschreitung nicht möglich.
[18] Neben Soziologie auch Psychologie, Pädagogik, Therapeutik, etc. Einen Überblick gibt Schweer (1997) in seinem Sammelband zum Interpersonalen Vertrauen.
[19] In Anbetracht der Komplexität und Differenziertheit des Phänomens ‚Vertrauen‘ bietet sich, zumindest im Vorfeld, eine interdisziplinäre Betrachtungsweise geradezu an. Das Schauen über den eigenen Tellerrand gibt vielfach Anlaß zu neuen Ideen und Betrachtungsweisen. Es seien in diesem Zusammenhang die Klassiker erwähnt, die als Universalgelehrte das „Querdenken“ praktizierten
[20] Man beachte die Wortwahl Luhmanns: Er sagt erwecken ! Dem ist wohl unumwunden zuzustimmen. Vergangenheit und Zukunft vermögen es jedoch, das bereits vorhandene Vertrauen zu rechtfertigen oder in Frage zu stellen.
[21] Angeführt werden u.a. Giddens, Luhmann, Coleman, Gambetta, Preisendörfer.
[22] Vergl. „Kierkegaards Beobachtung“: „Man versteht das Leben nur rückwärts, aber leben muß man es vorwärts!“ Zitiert nach (Lenk 1990: 71).
[23] Die Valenzgrammatik konstruiert sich aus dem Verb heraus. Jedes Verb einer Sprache hat unterschiedliche Valenzen, d.h. Wertigkeiten. Damit sind logische Leerstellen gemeint, die es, um einen grammatischen Satz zu bilden, zu füllen gilt. Man unterscheidet zwischen obligatorischen und fakultativen Valenzen. Ein Beispiel: das Verb essen hat außer dem Subjekt keine Leerstelle. „Ich esse.“ ist ein grammatischer Satz. „Ich schenke“ ist dagegen unvollständig. Die logischen Leerstellen fragen nach dem Wem und dem Was.
Details
- Titel
- Zur sozialen Konstruktion von Vertrauen in der Paarbeziehung am Beispiel der Ratgeberliteratur
- Hochschule
- Friedrich-Schiller-Universität Jena
- Note
- 2.0
- Autor
- Magistra Artium Bianca Schulze (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 89
- Katalognummer
- V117662
- ISBN (eBook)
- 9783640200474
- ISBN (Buch)
- 9783640206100
- Dateigröße
- 709 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Konstruktion Vertrauen Paarbeziehung Beispiel Ratgeberliteratur
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 55,99
- Arbeit zitieren
- Magistra Artium Bianca Schulze (Autor:in), 2004, Zur sozialen Konstruktion von Vertrauen in der Paarbeziehung am Beispiel der Ratgeberliteratur, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/117662
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









