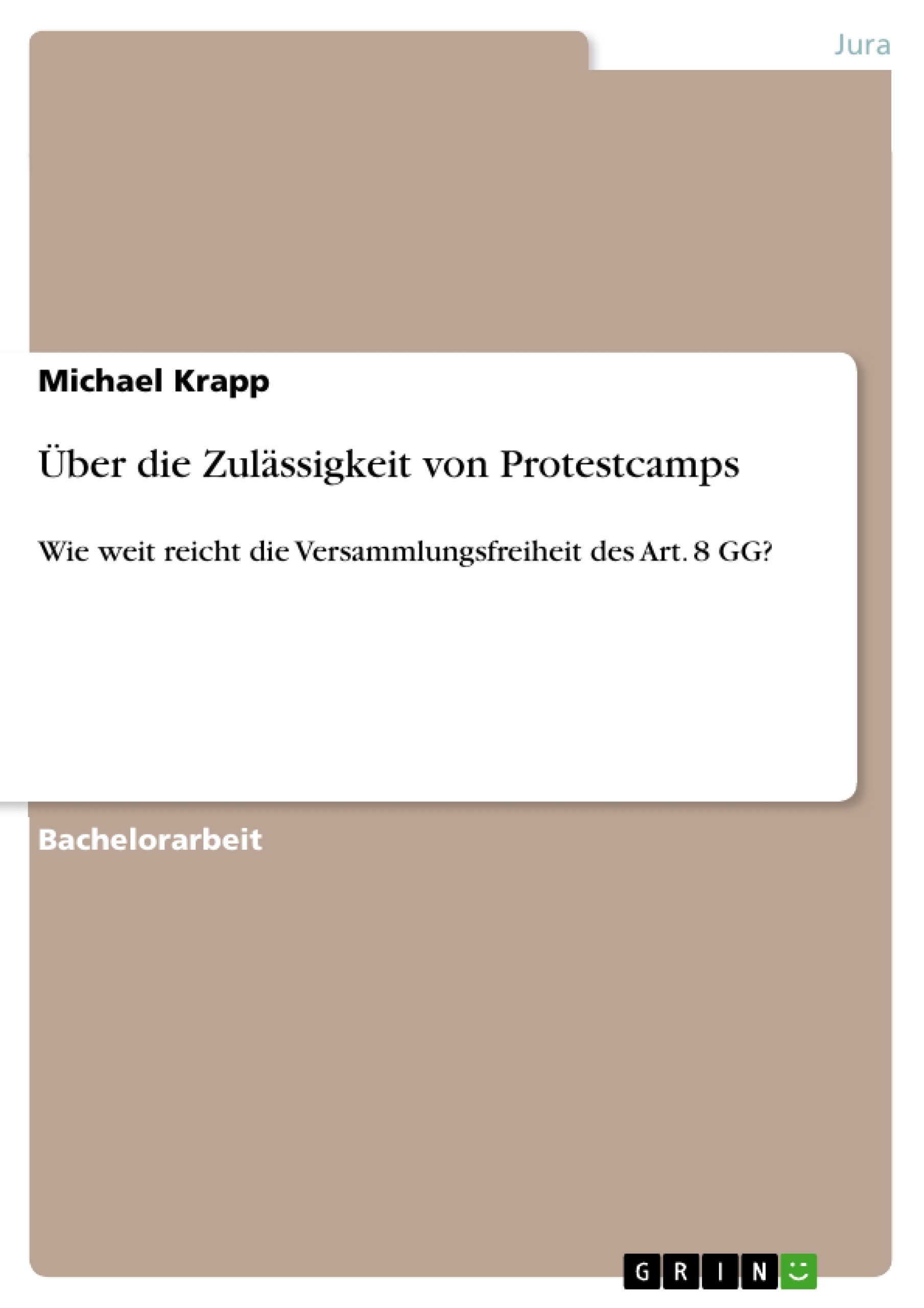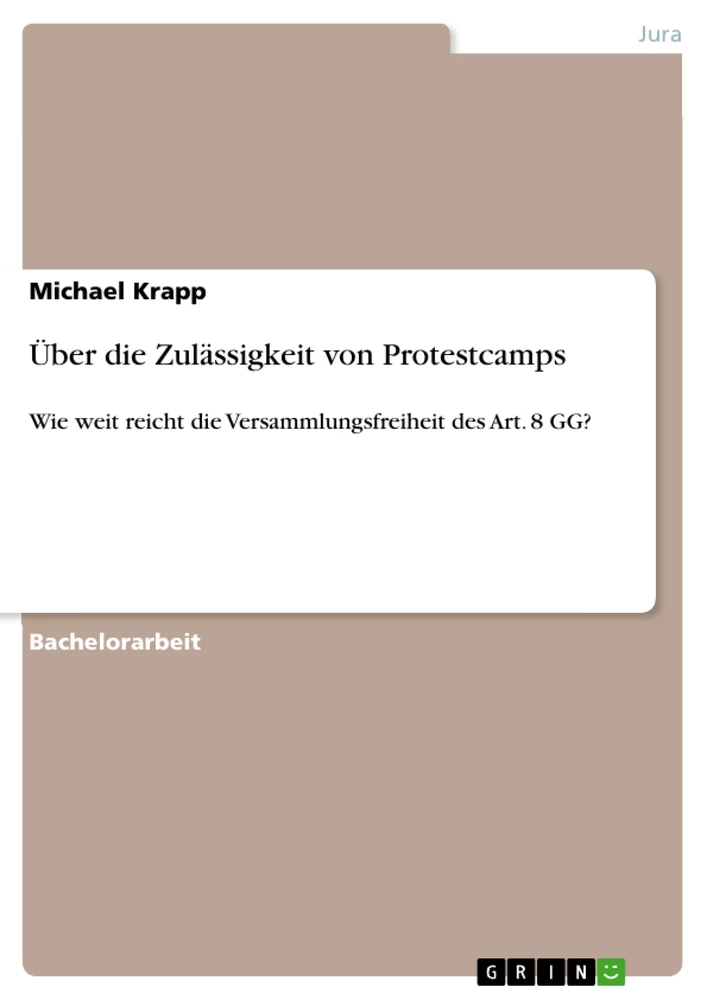
Über die Zulässigkeit von Protestcamps
Bachelorarbeit, 2021
42 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Gendererklärung
- A. Einleitung
- B. Die Versammlungsfreiheit
- I. Historische Herkunft
- II. Aktuelle Bedeutung
- III. Schutzbereich
- 1. Sachlicher Schutzbereich
- 2. Infrastruktureinrichtungen
- 3. Persönlicher Schutzbereich
- 4. Eingriffe
- 5. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
- C. Das Versammlungsgesetz
- I. Hintergrund
- II. Systematik
- III. Verfahren
- 1. Anmeldung
- 2. Konzentrationswirkung
- 3. Kooperation
- IV. Maßnahmen
- 1. Allgemeines
- 2. Feststellung über die Versammlungseigenschaft
- 3. Verbot und Auflage
- 4. Auflösung
- 5. Anwendungsbeispiele
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit widmet sich der rechtlichen Würdigung von Protestcamps als Form der Versammlung und untersucht den Umfang des sachlichen Schutzbereichs der Versammlungsfreiheit im Kontext von Infrastruktureinrichtungen. Die Arbeit beleuchtet die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen und untersucht, inwieweit Eingriffe in den Schutzbereich gerechtfertigt sein können.
- Rechtliche Würdigung von Protestcamps als Form der Versammlung
- Umfang des sachlichen Schutzbereichs der Versammlungsfreiheit im Kontext von Infrastruktureinrichtungen
- Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für die Versammlungsfreiheit
- Rechtfertigung von Eingriffen in den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit
- Analyse des Versammlungsgesetzes im Hinblick auf Protestcamps
Zusammenfassung der Kapitel
- A. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Versammlungsfreiheit im Kontext von Protestcamps ein und stellt die Aktualität und Relevanz der Thematik vor, insbesondere im Lichte der Corona-Pandemie und des G20-Gipfels in Hamburg. Die Arbeit soll die rechtliche Würdigung von Protestcamps als Form der Versammlung beleuchten und den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit im Hinblick auf Infrastruktureinrichtungen untersuchen.
- B. Die Versammlungsfreiheit: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Versammlungsfreiheit und ihre Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Es werden verschiedene Aspekte des Schutzbereichs der Versammlungsfreiheit, wie den sachlichen und persönlichen Schutzbereich sowie Eingriffe und deren Rechtfertigung, untersucht.
- C. Das Versammlungsgesetz: Dieses Kapitel fokussiert auf das Bundesversammlungsgesetz und die darin enthaltenen Regelungen, die den Eingriff in die Versammlungsfreiheit regeln. Es beleuchtet die Systematik des Gesetzes, die verschiedenen Verfahren und Maßnahmen, die von den Behörden ergriffen werden können, sowie konkrete Anwendungsbeispiele.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Versammlungsfreiheit, Protestcamps, Infrastruktureinrichtungen, Eingriffe, Verfassungsrecht, Versammlungsgesetz, Rechtfertigung, Bundesversammlungsgesetz, Schutzbereich und Schutzgut.
Häufig gestellte Fragen
Sind Protestcamps rechtlich als Versammlungen geschützt?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Protestcamps unter den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit fallen und welche Infrastrukturelemente davon abgedeckt sind.
Wie weit reicht die Gestaltungsfreiheit des Veranstalters bei Infrastruktur?
Es wird analysiert, ob Zelte, Küchen oder andere Camp-Einrichtungen als Teil der kollektiven Meinungskundgabe verfassungsrechtlich geschützt sind.
Wann darf der Staat in ein Protestcamp eingreifen?
Eingriffe können gerechtfertigt sein, wenn sie auf dem Versammlungsgesetz basieren und verhältnismäßig sind, um andere Schutzgüter zu wahren.
Welche Rolle spielt die Anmeldung beim Versammlungsgesetz?
Die Arbeit beleuchtet das Anmeldeverfahren, die Kooperationspflicht zwischen Veranstalter und Behörden sowie die Konzentrationswirkung von Genehmigungen.
Welche Maßnahmen können Behörden gegen Camps ergreifen?
Behörden können Auflagen erteilen, bestimmte Teile des Camps verbieten oder im Extremfall die Versammlung auflösen, wenn die Versammlungseigenschaft fehlt oder Gefahren drohen.
Details
- Titel
- Über die Zulässigkeit von Protestcamps
- Untertitel
- Wie weit reicht die Versammlungsfreiheit des Art. 8 GG?
- Hochschule
- Fachhochschule Kehl
- Note
- 1,3
- Autor
- Michael Krapp (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 42
- Katalognummer
- V1177082
- ISBN (eBook)
- 9783346598684
- ISBN (Buch)
- 9783346598691
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Versammlungsrecht Protestcamp Zeltcamp Versammlungsfreiheit Grundrechte
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Michael Krapp (Autor:in), 2021, Über die Zulässigkeit von Protestcamps, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1177082
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-