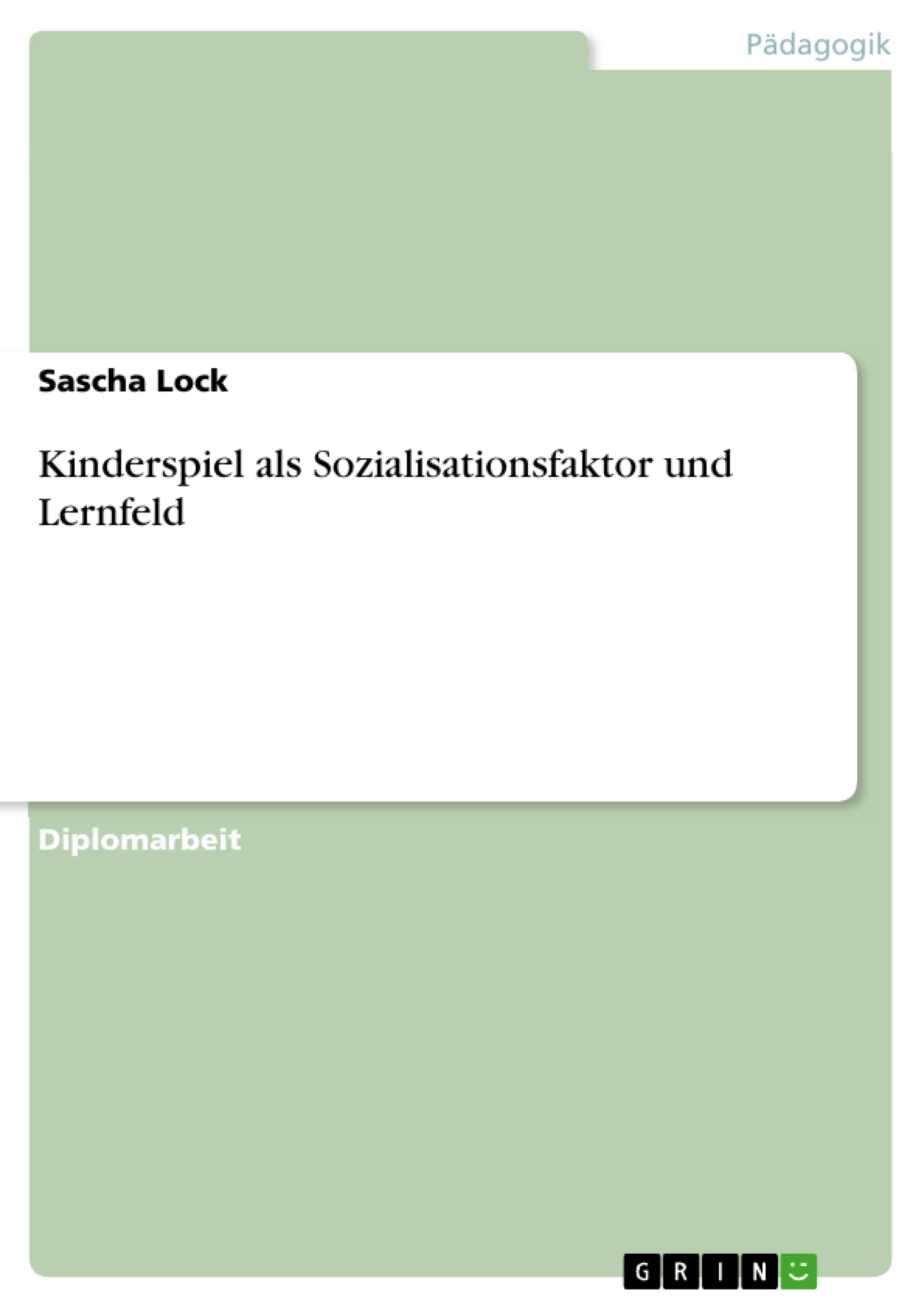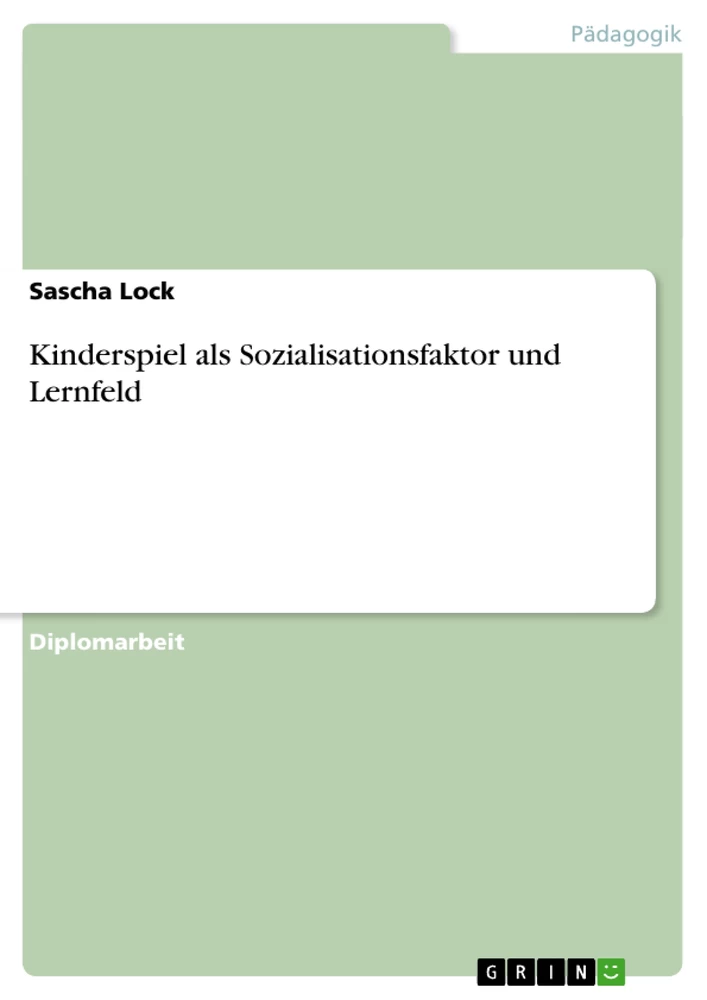
Kinderspiel als Sozialisationsfaktor und Lernfeld
Diplomarbeit, 2002
151 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Ansätze zum Kinderspiel
- Vorüberlegungen zu den Ansätzen
- Das Kinderspiel aus einer motivationspsychologischen Perspektive
- Das Kinderspiel aus einer interaktionistischen Perspektive
- Das Kinderspiel aus einer psychoanalytischen Perspektive
- Das Kinderspiel aus einer ökopsychischen und sozialkulturellen Perspektive
- Zusammenfassung
- Die Entwicklung des Kinderspiels
- Die Klassifikation der Kinderspiele nach Einsiedler
- Die psychomotorischen Spiele
- Die Phantasie- und Rollenspiele
- Die Bauspiele
- Die Regelspiele
- Die Klassifikation der Kinderspiele nach Einsiedler
- Fazit: Bedeutung des Kinderspiels aus entwicklungspsychologischer und sozialisationstheoretischer Sicht und aus der Perspektive von Kindern
- Spielen pädagogisch fördern und initiieren
- Einführung in die Spielpädagogik
- Voraussetzung für das Kinderspiel
- Aufgabenbereiche der Spielpädagogik
- Spielpädagogische Planung, Durchführung und Reflexion von Regelspielen in Gruppen
- Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Funktionen des Kinderspiels und Möglichkeiten seiner spielpädagogischen Förderung und Initiierung. Sie beleuchtet die Wirkungen des Spiels aus entwicklungspsychologischer und sozialisationstheoretischer Sicht sowie aus der Perspektive der Kinder selbst. Zusätzlich werden die Rahmenbedingungen, Spieltypen und die Entwicklung des Spielverhaltens im Laufe des Kinderalters betrachtet.
- Funktionen des Kinderspiels aus verschiedenen Perspektiven (entwicklungspsychologisch, sozialisationstheoretisch, kindliche Perspektive)
- Typen und Merkmale von Kinderspielen
- Entwicklung des Spielverhaltens im Kindesalter
- Rahmenbedingungen für das Kinderspiel
- Spielpädagogische Förderung und Initiierung von Kinderspielen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den persönlichen Werdegang des Autors im Bereich der Spielpädagogik und begründet die Wahl des Themas. Sie führt die Forschungsleitfrage ein: Welche Funktionen hat das Kinderspiel, und wie kann es spielpädagogisch gefördert und initiiert werden? Der Umfang und die Komplexität des Themas werden angesprochen, und die wichtigsten Forschungsfragen werden skizziert.
Theoretische Ansätze zum Kinderspiel: Dieses Kapitel analysiert verschiedene theoretische Perspektiven auf das Kinderspiel, einschließlich motivationspsychologischer, interaktionistischer, psychoanalytischer und ökopsychisch-soziokultureller Ansätze. Die Kapitel untersucht die verschiedenen theoretischen Ansätze und ihre jeweiligen Erklärungen für die Bedeutung des Kinderspiels. Der Vergleich der Ansätze und die daraus resultierenden unterschiedlichen Interpretationen des Kinderspiels werden hervorgehoben, um ein breites Verständnis zu schaffen.
Die Entwicklung des Kinderspiels: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Kinderspiels anhand der Klassifikation von Einsiedler. Es werden verschiedene Spieltypen (psychomotorische Spiele, Phantasie- und Rollenspiele, Bauspiele, Regelspiele) detailliert beschrieben, ihre Entwicklungsphasen im Kindesalter analysiert und deren Funktionen beleuchtet. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Veränderungen im Spielverhalten im Laufe der Entwicklung und dem Zusammenhang mit der kognitiven und sozialen Entwicklung des Kindes.
Spielen pädagogisch fördern und initiieren: Dieses Kapitel befasst sich mit der spielpädagogischen Förderung und Initiierung des Kinderspiels. Es werden Voraussetzungen für das Kinderspiel geschaffen, spieldidaktische und methodische Aspekte der Spielanleitung erläutert und die Rolle der Spielpädagogik im Allgemeinen diskutiert. Praktische Beispiele, wie das Geländespiel „Outback“, veranschaulichen die Konzepte der Spielplanung und -durchführung. Der Abschnitt behandelt konkrete Aufgabenbereiche der Spielpädagogik, z.B. die Gestaltung geeigneter Spielräume und die Auswahl passender Spielmittel.
Schlüsselwörter
Kinderspiel, Spielpädagogik, Sozialisation, Entwicklungspsychologie, Spielverhalten, Spieltypen, psychomotorische Spiele, Phantasie- und Rollenspiele, Bauspiele, Regelspiele, Spielförderung, Spielinitiierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Funktionen des Kinderspiels und Möglichkeiten seiner spielpädagogischen Förderung und Initiierung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Funktionen des Kinderspiels und Möglichkeiten seiner spielpädagogischen Förderung und Initiierung. Sie beleuchtet die Wirkungen des Spiels aus entwicklungspsychologischer und sozialisationstheoretischer Sicht sowie aus der Perspektive der Kinder selbst. Zusätzlich werden die Rahmenbedingungen, Spieltypen und die Entwicklung des Spielverhaltens im Laufe des Kinderalters betrachtet.
Welche theoretischen Ansätze werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Perspektiven auf das Kinderspiel, darunter motivationspsychologische, interaktionistische, psychoanalytische und ökopsychisch-soziokulturelle Ansätze. Es wird ein Vergleich der Ansätze und deren unterschiedliche Interpretationen des Kinderspiels vorgenommen.
Wie wird die Entwicklung des Kinderspiels beschrieben?
Die Entwicklung des Kinderspiels wird anhand der Klassifikation von Einsiedler beschrieben. Es werden verschiedene Spieltypen (psychomotorische Spiele, Phantasie- und Rollenspiele, Bauspiele, Regelspiele) detailliert beschrieben, ihre Entwicklungsphasen im Kindesalter analysiert und deren Funktionen beleuchtet.
Was beinhaltet der Abschnitt zur spielpädagogischen Förderung?
Dieser Abschnitt befasst sich mit der spielpädagogischen Förderung und Initiierung des Kinderspiels. Es werden Voraussetzungen für das Kinderspiel geschaffen, spieldidaktische und methodische Aspekte der Spielanleitung erläutert und die Rolle der Spielpädagogik im Allgemeinen diskutiert. Praktische Beispiele veranschaulichen die Konzepte der Spielplanung und -durchführung. Der Abschnitt behandelt konkrete Aufgabenbereiche der Spielpädagogik, z.B. die Gestaltung geeigneter Spielräume und die Auswahl passender Spielmittel.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Funktionen hat das Kinderspiel, und wie kann es spielpädagogisch gefördert und initiiert werden?
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderspiel, Spielpädagogik, Sozialisation, Entwicklungspsychologie, Spielverhalten, Spieltypen, psychomotorische Spiele, Phantasie- und Rollenspiele, Bauspiele, Regelspiele, Spielförderung, Spielinitiierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretische Ansätze zum Kinderspiel, Die Entwicklung des Kinderspiels, Spielen pädagogisch fördern und initiieren, und Schlussgedanken. Jedes Kapitel enthält detaillierte Unterpunkte, die im Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind.
Welche Perspektiven werden auf das Kinderspiel eingenommen?
Die Arbeit betrachtet das Kinderspiel aus verschiedenen Perspektiven: entwicklungspsychologisch, sozialisationstheoretisch und aus der Perspektive der Kinder selbst.
Details
- Titel
- Kinderspiel als Sozialisationsfaktor und Lernfeld
- Hochschule
- Philipps-Universität Marburg (Institut der Erziehungswissenschaft)
- Note
- 1
- Autor
- Sascha Lock (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2002
- Seiten
- 151
- Katalognummer
- V11793
- ISBN (eBook)
- 9783638178495
- ISBN (Buch)
- 9783640860807
- Dateigröße
- 836 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Spiel Kinder Kinderspiel Piaget Fritz Spielmobil Marburg
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 54,99
- Arbeit zitieren
- Sascha Lock (Autor:in), 2002, Kinderspiel als Sozialisationsfaktor und Lernfeld, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/11793
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-