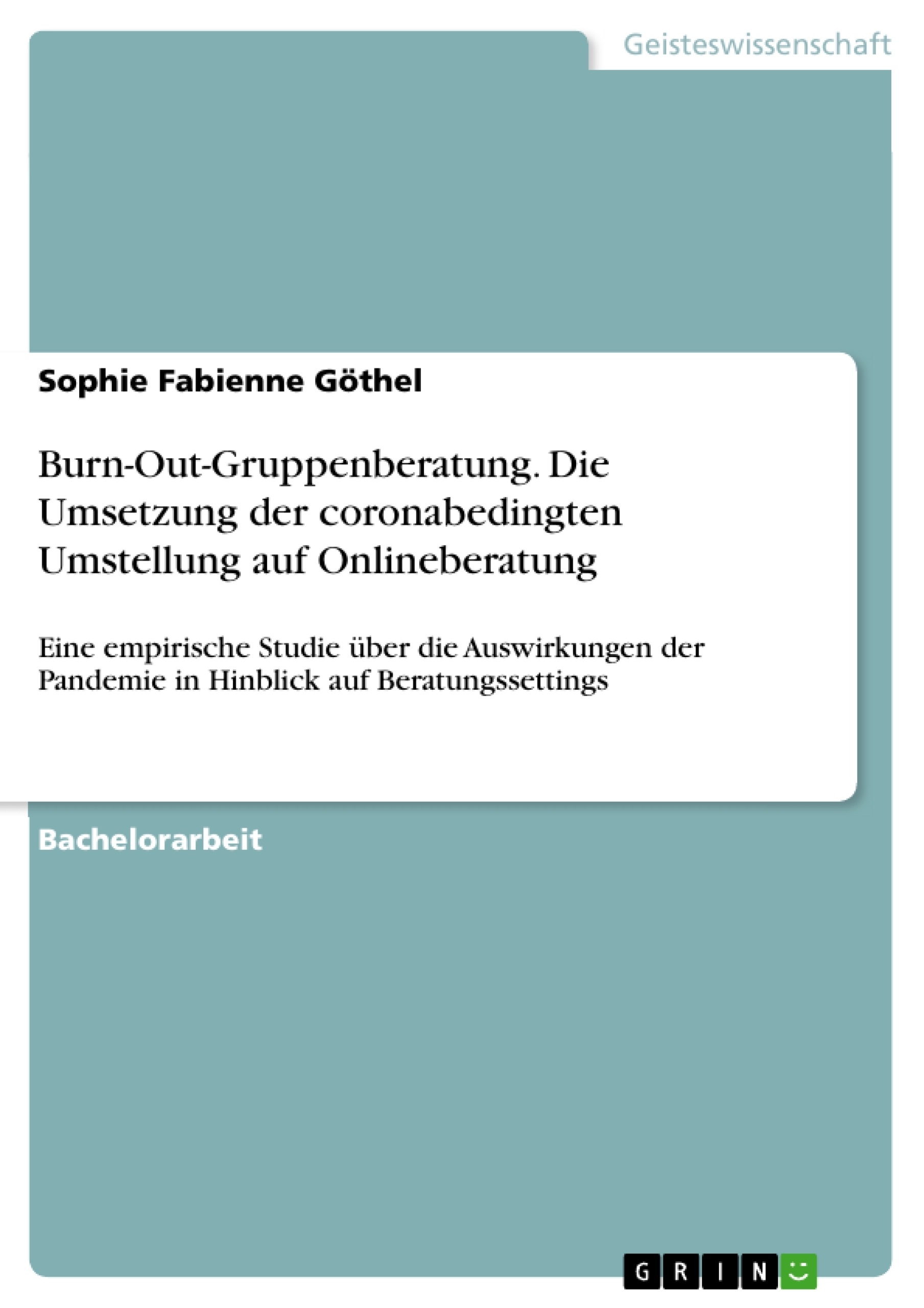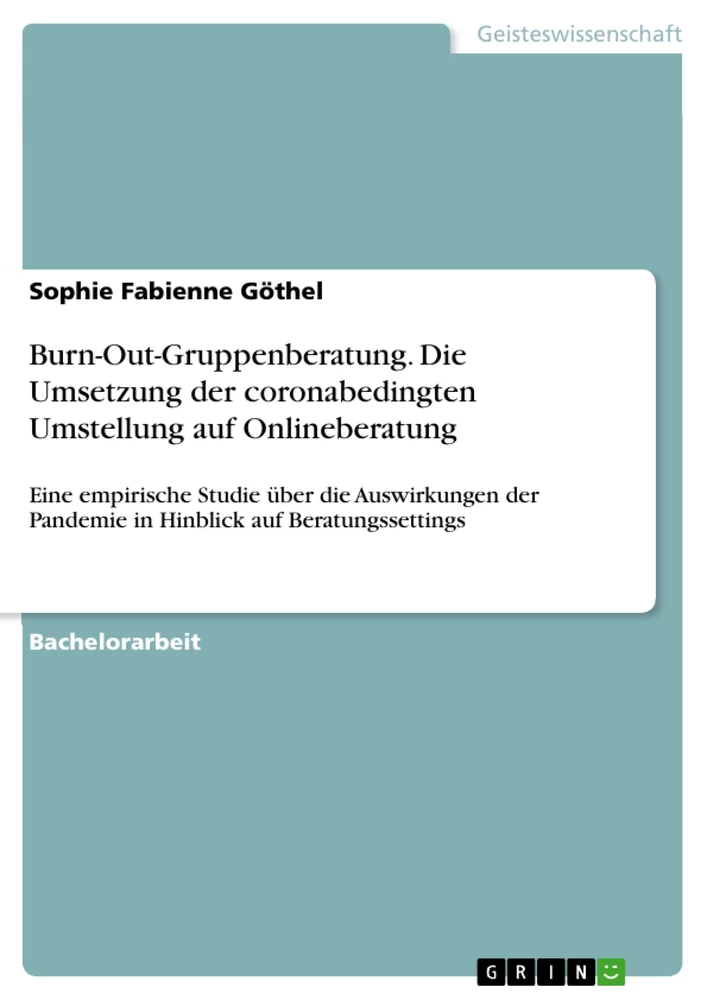
Burn-Out-Gruppenberatung. Die Umsetzung der coronabedingten Umstellung auf Onlineberatung
Bachelorarbeit, 2021
52 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Burn-Out und Selbsthilfegruppen
- Das Burn-Out-Syndrom
- Selbsthilfe als psychosoziale Beratungsform
- Einführung in die Online-Beratung
- Chat-Beratung
- Video-Beratung
- Methodik der Empirie
- Fragestellung und Hintergrund
- Die Interviewmethode
- Die Auswertung
- Ergebnisdarstellung
- Burn-Out-Beratung
- Rahmenbedingungen der Umgebung
- Ablauf
- Technik
- Hilfreiche Faktoren
- Vertrauen und Datenschutz
- Emotionale Nähe
- Zukunftsperspektive
- Ergebnisdiskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der coronabedingten Umstellung auf Onlineberatung am Beispiel von Burn-Out-Selbsthilfegruppen. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich durch die Einführung digitaler Beratungssettings ergeben. Ziel ist es, einen Einblick in die Erfahrungen und Perspektiven von Klienten und Beratern im Kontext von Burn-Out-Gruppenberatung zu gewinnen.
- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Beratungssettings
- Die Umstellung von Präsenz- auf Online-Beratungssettings im Bereich der Burn-Out-Selbsthilfegruppen
- Die Herausforderungen und Chancen der Online-Beratung im Kontext von Burn-Out
- Die Erfahrungen und Perspektiven von Klienten und Beratern in digitalen Beratungssettings
- Die Bedeutung von Vertrauen, Datenschutz und emotionaler Nähe in der Online-Beratung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Relevanz des Forschungsthemas dar und verdeutlicht die Notwendigkeit der Anpassung von Beratungssettings im Kontext der Corona-Pandemie. Kapitel 2 bietet eine theoretische Einführung in das Burn-Out-Syndrom und die Bedeutung von Selbsthilfegruppenberatung. Kapitel 3 erläutert verschiedene Formen der Online-Beratung. Die Methodik der Empirie wird in Kapitel 4 vorgestellt, inklusive der Forschungsfrage, der Interviewmethode und der Auswertung. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Interviews, die sich auf verschiedene Aspekte der Online-Gruppenberatung beziehen, wie z.B. die Rahmenbedingungen, den Ablauf, die Technik, die hilfreichen Faktoren und die Bedeutung von Vertrauen und emotionaler Nähe.
Schlüsselwörter
Burn-Out-Syndrom, Selbsthilfegruppenberatung, Online-Beratung, Corona-Pandemie, digitale Beratungssettings, Interviewmethode, qualitative Forschung, Vertrauen, Datenschutz, emotionale Nähe.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Corona-Pandemie auf Burn-Out-Selbsthilfegruppen ausgewirkt?
Die Pandemie führte zu einer notwendigen Umstellung von Präsenztreffen auf digitale Online-Beratungssettings (Chat- oder Video-Beratung).
Bietet Online-Beratung Vorteile gegenüber Präsenztreffen?
Ja, sie ermöglicht eine höhere Flexibilität, spart Anfahrtswege und kann in Krisenzeiten die Kontinuität der Unterstützung sichern.
Was sind die größten Herausforderungen der digitalen Gruppenberatung?
Dazu zählen technische Hürden, Datenschutzbedenken und die Schwierigkeit, eine vergleichbare emotionale Nähe wie im physischen Raum aufzubauen.
Welche Rolle spielt der Datenschutz bei der Online-Beratung?
Vertrauen und sichere Kommunikationssysteme sind essenziell, da in Selbsthilfegruppen hochsensible persönliche Informationen geteilt werden.
Wie wurde die Untersuchung durchgeführt?
Es wurden sechs halboffene Interviews mit Klienten und Beratern aus Selbsthilfegruppen in Nordrhein-Westfalen geführt und ausgewertet.
Details
- Titel
- Burn-Out-Gruppenberatung. Die Umsetzung der coronabedingten Umstellung auf Onlineberatung
- Untertitel
- Eine empirische Studie über die Auswirkungen der Pandemie in Hinblick auf Beratungssettings
- Hochschule
- Universität Duisburg-Essen
- Note
- 1,3
- Autor
- Sophie Fabienne Göthel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 52
- Katalognummer
- V1180644
- ISBN (eBook)
- 9783346599971
- ISBN (Buch)
- 9783346599988
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- burn-out-gruppenberatung umsetzung umstellung onlineberatung eine studie auswirkungen pandemie hinblick beratungssettings Burnout Beratung Corona Burn-Out Psychologie Empirie Covid-19 Depressionen Selbsthilfe Selbsthilfegruppen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 21,99
- Preis (Book)
- US$ 32,99
- Arbeit zitieren
- Sophie Fabienne Göthel (Autor:in), 2021, Burn-Out-Gruppenberatung. Die Umsetzung der coronabedingten Umstellung auf Onlineberatung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1180644
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-