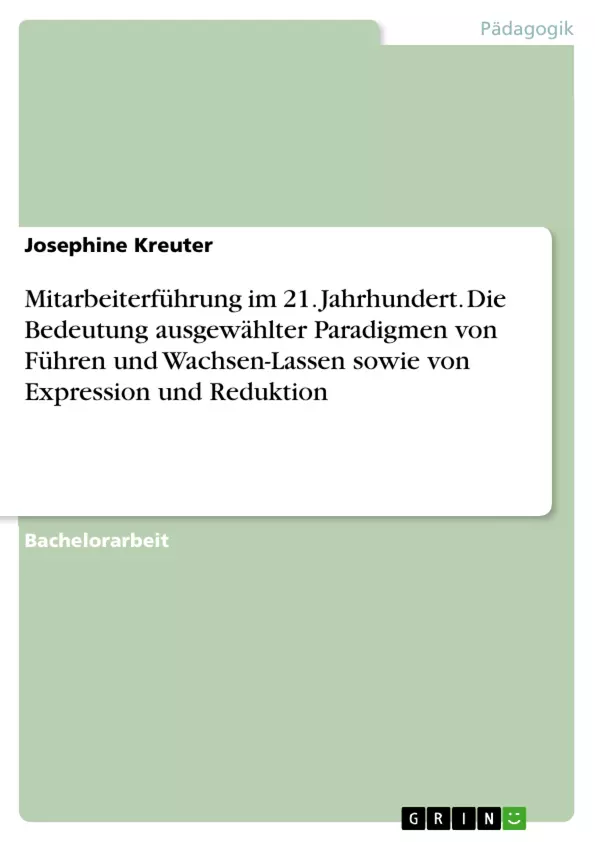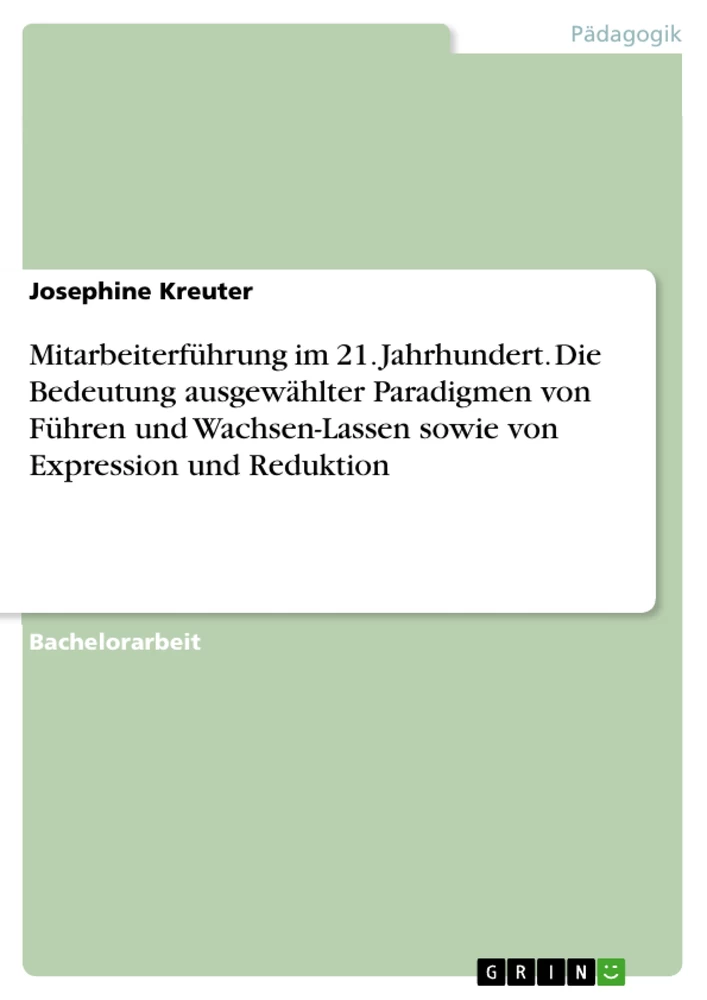
Mitarbeiterführung im 21. Jahrhundert. Die Bedeutung ausgewählter Paradigmen von Führen und Wachsen-Lassen sowie von Expression und Reduktion
Bachelorarbeit, 2021
46 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie des Führens und Wachsen-Lassens
- Begriffsklärung von Erziehung und Bildung
- Der Erzieherwille im Verhältnis zur Zukunft
- Die Ablehnung von Vergangenheit und Gegenwart
- Das Vorweggreifen der Zukunft und die Rolle des Bildungsideals
- Der Erzieherwille im Verhältnis zu Gegenwart und Vergangenheit
- Der positive Nutzen des Wachsen-Lassens
- Der positive Nutzen des Führens
- Das dialektische Verhältnis von Führen und Wachsen-Lassen
- Die Theorie der Expression und Reduktion
- Menschen und Kulturen im Antizyklus
- Die Einheit und Freisetzung von Expression und Reduktion
- Die Übersteigerung expressiver und reduktiver Prozesse
- Das anoiktische Erleben
- Menschen und Kulturen im Spannungsgefüge
- Menschen und Kulturen im Antizyklus
- Grundlagen zeitgemäßer Mitarbeiterführung im 21. Jahrhundert
- Zum Begriff Führung
- Formen der Einflussnahme in der Mitarbeiterführung
- Die Rolle der Führungskraft
- Das Rollenkonzept in der Mitarbeiterführung
- Die Gestaltung und Durchsetzung der Rolle als Führungskraft
- Kriterien des Führungserfolgs
- Die Bedeutung ausgewählter Paradigmen von Führen und Wachsen-Lassen sowie von Expression und Reduktion für eine zeitgemäße Mitarbeiterführung
- Gegenwärtige Herausforderungen einer Mitarbeiterführung
- Schlüsselkompetenzen für Führungskräfte
- Gleichwertige Führungsbeziehungen
- Die Mitarbeiterführung als dialektischer Prozess
- Interaktionistische Führungstheorien
- Transaktionale Führung
- Transformationale Führung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Relevanz ausgewählter Paradigmen des Führens und Wachsen-Lassens sowie der Expression und Reduktion für die moderne Mitarbeiterführung im 21. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der Anwendung dieser pädagogischen Konzepte im Kontext der Arbeitsorganisation.
- Die Bedeutung der Theorien von Litt (Führen und Wachsen-Lassen) und Twellmann et al. (Expression und Reduktion) für die Mitarbeiterführung.
- Analyse der Herausforderungen moderner Mitarbeiterführung im Kontext von Globalisierung und technologischem Wandel.
- Untersuchung verschiedener Führungsstile und -ansätze.
- Die Rolle von Führungskräften und die Gestaltung von Führungsbeziehungen.
- Kriterien für erfolgreichen Führungserfolg.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den zunehmend herausfordernden Kontext der Mitarbeiterführung im 21. Jahrhundert, geprägt von Globalisierung, technologischem Fortschritt und kulturellem Wandel. Sie hebt die unterschiedlichen Führungsverständnisse hervor und die daraus resultierenden differenzierten Sichtweisen. Die Arbeit untersucht die Parallelen zwischen Theorien des Erziehungsprozesses (Litt, Twellmann et al.) und zeitgemäßer Mitarbeiterführung, um bedeutsame Annahmen für die heutige Führungspraxis zu identifizieren.
Die Theorie des Führens und Wachsen-Lassens: Dieses Kapitel erläutert die pädagogische Theorie des Führens und Wachsen-Lassens von Theodor Litt. Es beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen der Begriffe „Führen“ und „Wachsen-Lassen“, die auf Missverständnissen in der Begriffsbildung beruhen. Der Fokus liegt auf der Klärung der Begriffe Erziehung und Bildung und ihrer komplexen Beziehung zueinander, um den theoretischen Hintergrund für die Analyse der Führungsstile zu schaffen. Die Vieldeutigkeit von Erziehung und Bildung wird ausführlich diskutiert.
Die Theorie der Expression und Reduktion: Dieses Kapitel befasst sich mit der Theorie der Expression und Reduktion in der Pädagogik. Es analysiert die Dynamik zwischen diesen beiden Polen im menschlichen Handeln und im kulturellen Kontext. Das Kapitel erörtert die Bedeutung der Balance zwischen Expression und Reduktion und die möglichen negativen Folgen einer Übersteigerung beider. Der Begriff des „anoiktischen Erlebens“ wird im Kontext der Theorie erläutert.
Grundlagen zeitgemäßer Mitarbeiterführung im 21. Jahrhundert: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die Anwendung der pädagogischen Theorien auf die moderne Mitarbeiterführung. Es definiert den Begriff der Führung, beschreibt verschiedene Formen der Einflussnahme und analysiert die Rolle der Führungskraft, inklusive der Gestaltung und Durchsetzung ihrer Rolle. Schließlich werden Kriterien für den Erfolg von Führung definiert und im Kontext der vorhergehenden Kapitel erläutert.
Die Bedeutung ausgewählter Paradigmen von Führen und Wachsen-Lassen sowie von Expression und Reduktion für eine zeitgemäße Mitarbeiterführung: Dieses Kapitel verbindet die zuvor dargestellten Theorien mit der Praxis der modernen Mitarbeiterführung. Es analysiert aktuelle Herausforderungen und identifiziert Schlüsselkompetenzen für Führungskräfte. Es beleuchtet die Bedeutung gleichwertiger Führungsbeziehungen und beschreibt die Mitarbeiterführung als einen dialektischen Prozess, wobei verschiedene Führungstheorien (interaktionistisch, transaktional, transformational) im Kontext der vorhergehenden Kapitel diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Mitarbeiterführung, Führungstheorien, Führen und Wachsen-Lassen, Expression und Reduktion, Erziehung, Bildung, Globalisierung, technologischer Wandel, Rollenkonzept, Führungserfolg, Interaktionistische Führung, Transaktionale Führung, Transformationale Führung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Führen und Wachsen-Lassen sowie Expression und Reduktion in der Mitarbeiterführung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Relevanz ausgewählter pädagogischer Paradigmen – "Führen und Wachsen-Lassen" (Litt) und "Expression und Reduktion" (Twellmann et al.) – für die moderne Mitarbeiterführung im 21. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der Anwendung dieser Konzepte im Kontext der Arbeitsorganisation und den Herausforderungen der Globalisierung und des technologischen Wandels.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die pädagogischen Theorien von Theodor Litt ("Führen und Wachsen-Lassen") und Twellmann et al. ("Expression und Reduktion"). Es wird analysiert, wie diese Theorien auf die Herausforderungen der modernen Mitarbeiterführung angewendet werden können. Die Vieldeutigkeit von Erziehung und Bildung im Kontext von Litts Theorie wird ausführlich diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Theorie des Führens und Wachsen-Lassens, ein Kapitel zur Theorie der Expression und Reduktion, ein Kapitel zu Grundlagen zeitgemäßer Mitarbeiterführung und ein Kapitel, welches die Bedeutung der ausgewählten Paradigmen für die zeitgemäße Mitarbeiterführung verbindet. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Theorie und deren Relevanz für die Praxis.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Zentrale Themen sind die Bedeutung der Theorien von Litt und Twellmann et al. für die Mitarbeiterführung, die Herausforderungen moderner Mitarbeiterführung (Globalisierung, technologischer Wandel), verschiedene Führungsstile und -ansätze, die Rolle von Führungskräften, die Gestaltung von Führungsbeziehungen und Kriterien für erfolgreichen Führungserfolg.
Wie werden die Theorien von Litt und Twellmann et al. angewendet?
Die Arbeit zeigt Parallelen zwischen den pädagogischen Theorien und der modernen Mitarbeiterführung auf. Die Konzepte des Führens und Wachsen-Lassens sowie der Expression und Reduktion werden analysiert und auf ihre Anwendbarkeit in verschiedenen Führungssituationen untersucht. Es werden verschiedene Führungstheorien (interaktionistisch, transaktional, transformational) im Kontext dieser Paradigmen diskutiert.
Welche Schlüsselkompetenzen für Führungskräfte werden identifiziert?
Die Arbeit identifiziert Schlüsselkompetenzen für Führungskräfte im Kontext der untersuchten Theorien und der Herausforderungen der modernen Mitarbeiterführung. Dies beinhaltet unter anderem die Fähigkeit, gleichwertige Führungsbeziehungen zu gestalten und die Mitarbeiterführung als einen dialektischen Prozess zu verstehen.
Welche Herausforderungen der modernen Mitarbeiterführung werden angesprochen?
Die Arbeit analysiert aktuelle Herausforderungen der Mitarbeiterführung, die durch Globalisierung, technologischen Fortschritt und kulturellen Wandel entstehen. Diese Herausforderungen werden im Kontext der untersuchten Theorien diskutiert, um Lösungen und Strategien für eine erfolgreiche Mitarbeiterführung zu entwickeln.
Welche Arten von Führung werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Führungsstile und -ansätze, darunter interaktionistische, transaktionale und transformationale Führung. Diese werden im Kontext der Theorien des Führens und Wachsen-Lassens sowie der Expression und Reduktion analysiert und bewertet.
Was sind die Kriterien für erfolgreichen Führungserfolg?
Die Arbeit definiert Kriterien für erfolgreichen Führungserfolg, basierend auf den untersuchten Theorien und den Herausforderungen der modernen Mitarbeiterführung. Diese Kriterien werden im Kontext der gesamten Analyse diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Mitarbeiterführung, Führungstheorien, Führen und Wachsen-Lassen, Expression und Reduktion, Erziehung, Bildung, Globalisierung, technologischer Wandel, Rollenkonzept, Führungserfolg, Interaktionistische Führung, Transaktionale Führung und Transformationale Führung.
Details
- Titel
- Mitarbeiterführung im 21. Jahrhundert. Die Bedeutung ausgewählter Paradigmen von Führen und Wachsen-Lassen sowie von Expression und Reduktion
- Hochschule
- Universität Augsburg (Erziehungswissenschaft)
- Note
- 1,0
- Autor
- Josephine Kreuter (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V1183086
- ISBN (Buch)
- 9783346612564
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Mitarbeiterführung Pädagogik Führen und Wachsen-Lassen Theodor Litt Reduktion und Expression Expressive Pädagogik Erziehungswissenschaft Erwachsenenbildung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Josephine Kreuter (Autor:in), 2021, Mitarbeiterführung im 21. Jahrhundert. Die Bedeutung ausgewählter Paradigmen von Führen und Wachsen-Lassen sowie von Expression und Reduktion, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1183086
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-