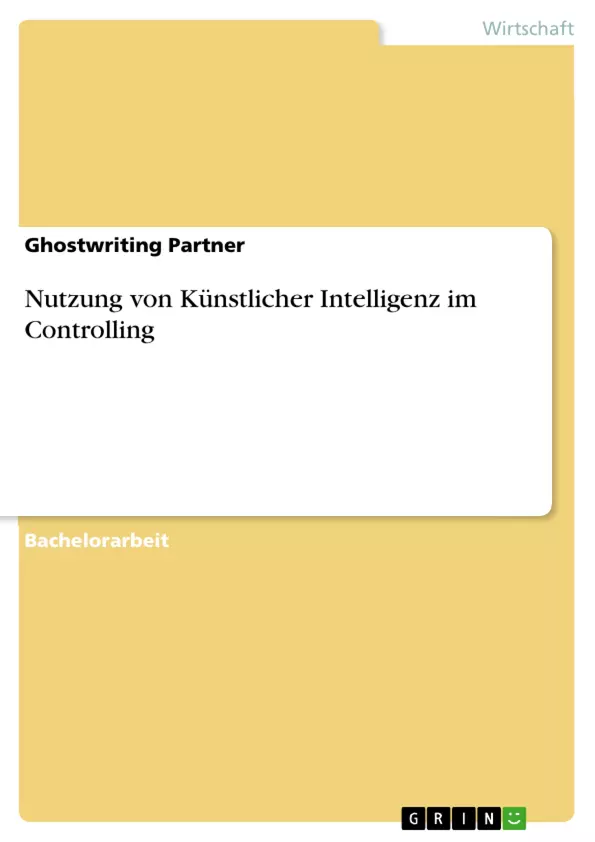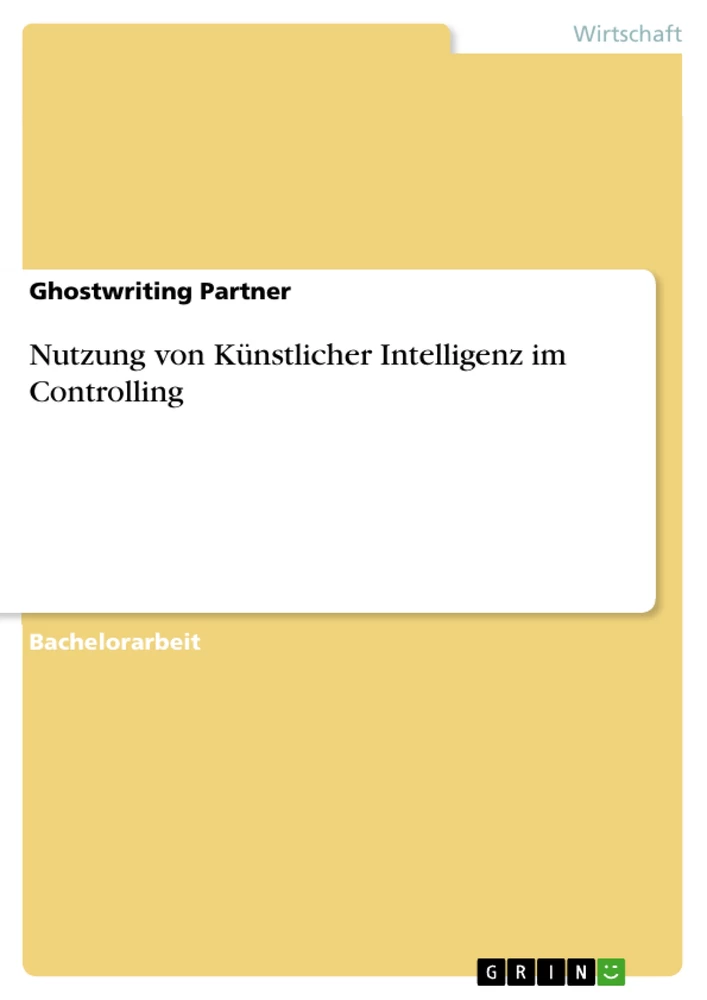
Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Controlling
Bachelorarbeit, 2021
48 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage
- Ziele und Fragestellungen
- Methodik und Vorgehensweise
- Theoretische Grundlagen
- Definition
- Merkmale Künstlicher Intelligenz
- Machine Learning
- Aufgaben, Prozesse und Organisation des Controllings
- Künstliche Neuronale Netze
- Grundlagen der KNN
- Typische Aufgaben von KNN
- Deep Learning
- KI-Anwendungen und ihre Verwendungsmöglichkeiten für das Controlling
- Maschine-zu-Maschine-Prozesse
- Mensch-zu-Maschine-Prozesse
- Big Data-Tools
- Intelligente Automatisierung
- Business Intelligence
- Business Analytics
- Planung / Forecasting
- Künstliche Intelligenz im Controlling
- Anwendung von KI auf die Prozesse des Controllings
- Auswirkung auf Planung und Forecast
- Ergebnisrechnung
- Reporting
- Auswirkungen auf die Controller
- Chancen und Risiken von KI im Controlling
- Schlussbetrachtung
- Kritische Würdigung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Controlling. Sie analysiert die potenziellen Chancen und Herausforderungen, die sich durch den Einsatz von KI-Technologien für die Controlling-Funktion ergeben. Im Zentrum der Untersuchung stehen die Auswirkungen von KI auf die Prozesse des Controllings, insbesondere in Bezug auf Planung und Forecast, Ergebnisrechnung sowie Reporting. Darüber hinaus werden die Veränderungen, die sich für die Rolle des Controllers durch den Einsatz von KI ergeben, beleuchtet.
- Einsatz von KI-Technologien im Controlling
- Auswirkungen von KI auf die Prozesse des Controllings
- Chancen und Risiken von KI im Controlling
- Veränderungen der Rolle des Controllers im Zuge der KI-Nutzung
- Potenziale und Herausforderungen der KI-Integration im Controlling
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Ausgangslage dar, die den Einsatz von KI-Technologien im Controlling erforderlich macht. Sie erläutert die Bedeutung von effizienter Unternehmensführung und die Rolle des Controllings bei der Entscheidungsfindung.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Künstlichen Intelligenz und beschreibt verschiedene Merkmale sowie das Konzept des Machine Learning. Es liefert somit die notwendigen theoretischen Grundlagen, um die Anwendung von KI im Controlling zu verstehen.
- Aufgaben, Prozesse und Organisation des Controllings: Dieses Kapitel beleuchtet die grundlegenden Aufgaben, Prozesse und die Organisation des Controllings innerhalb eines Unternehmens. Es stellt den Zusammenhang zwischen Controlling und anderen Unternehmensbereichen her.
- Künstliche Neuronale Netze: Dieses Kapitel fokussiert auf Künstliche Neuronale Netze (KNN) als eine spezielle Form der KI. Es erläutert die Funktionsweise von KNN und beschreibt deren typische Einsatzgebiete. Darüber hinaus geht es auf das Thema Deep Learning ein.
- KI-Anwendungen und ihre Verwendungsmöglichkeiten für das Controlling: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Möglichkeiten, wie KI-Technologien im Controlling eingesetzt werden können. Es beleuchtet Machine-zu-Maschine- und Mensch-zu-Maschine-Prozesse, Big Data-Tools und intelligente Automatisierung.
- Künstliche Intelligenz im Controlling: Dieses Kapitel untersucht, wie KI konkret auf die Prozesse des Controllings angewendet werden kann. Es analysiert die Auswirkungen von KI auf Planung und Forecast, Ergebnisrechnung und Reporting. Zudem werden die Auswirkungen von KI auf die Rolle des Controllers diskutiert.
Schlüsselwörter
Künstliche Intelligenz, Controlling, Machine Learning, Big Data, Business Intelligence, Business Analytics, Planung, Forecasting, Ergebnisrechnung, Reporting, Automatisierung, Chancen, Risiken, Digitalisierung, Industrie 4.0
Details
- Titel
- Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Controlling
- Hochschule
- Universität Duisburg-Essen
- Note
- 1,3
- Autor
- Ghostwriting Partner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V1185540
- ISBN (eBook)
- 9783346617040
- ISBN (Buch)
- 9783346617057
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Künstliche Intelligenz Controlling Big Data Data Analytics Business Intelligence Neuronale Netze Forecast
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Ghostwriting Partner (Autor:in), 2021, Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Controlling, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1185540
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-