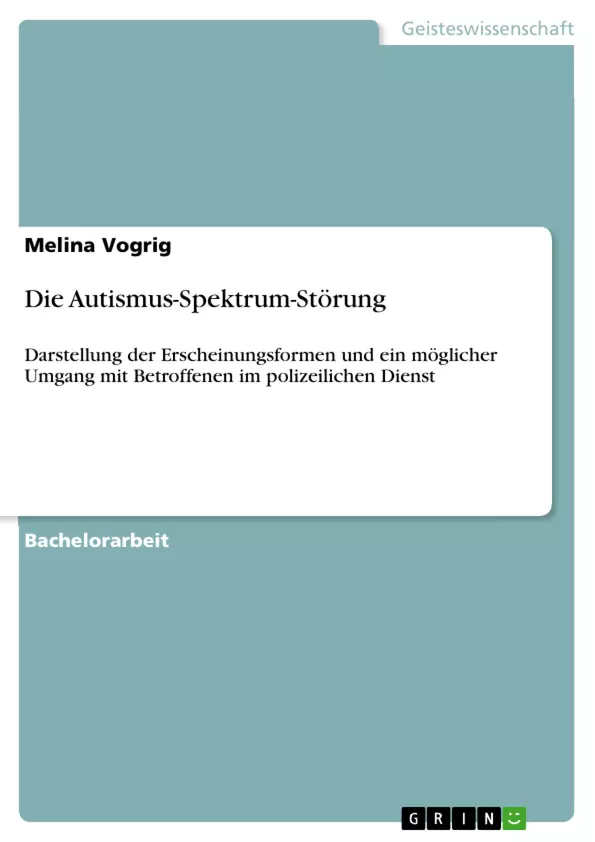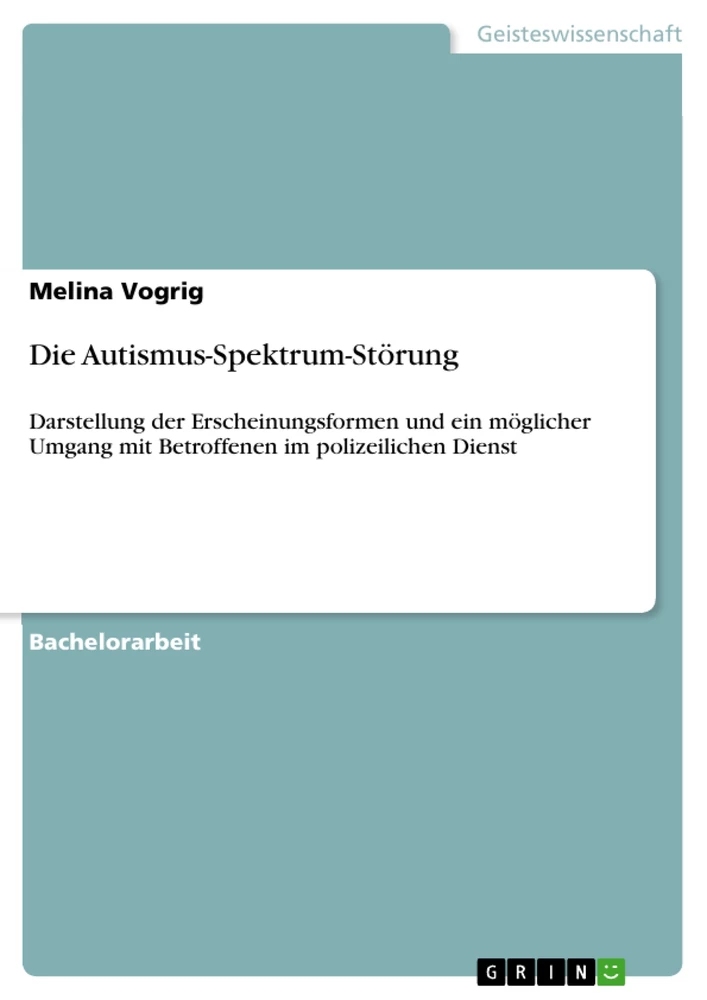
Die Autismus-Spektrum-Störung
Bachelorarbeit, 2021
53 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Autismus-Spektrum-Störung
- 2.1 Die geschichtliche Entwicklung des Begriffes „Autismus-Spektrum-Störung“
- 2.2 Die Diagnose: was genau ist Autismus?
- 2.2.1 Die Erscheinungsformen des Autismus
- 2.2.2 Autismus bei Mädchen und Frauen
- 2.2.3 Die Diagnose im Kindesalter
- 2.2.4 Die Diagnose im Erwachsenenalter
- 2.3 Ursachen und Risikofaktoren
- 2.4 Häufigkeit in der Bevölkerung
- 2.5 Einblicke in das Leben Betroffener
- 2.6 Therapiemöglichkeiten
- 3. Der Bezug zum polizeilichen Dienst
- 3.1 Praktische Hinweise zur Erkennung
- 3.2 Konfliktpotential und Lösungsansätze
- 4. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ziel ist es, die wichtigsten Fakten zur ASS darzustellen, einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung und die grundlegenden Erscheinungsformen zu geben und verschiedene Diagnosekriterien zu erläutern. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob ASS immer mit Leidensdruck einhergeht oder auch eine besondere Ausprägung der menschlichen neurologischen Vielfalt sein kann. Schließlich wird der Bezug zum polizeilichen Dienst hergestellt und betrachtet, wie Polizisten mit Menschen mit ASS im Einsatz umgehen können.
- Geschichtliche Entwicklung und Definition der Autismus-Spektrum-Störung
- Erscheinungsformen und Diagnosekriterien der ASS
- Lebenssituation und Herausforderungen von Menschen mit ASS
- Häufigkeit von ASS in der Bevölkerung
- Umgang mit Menschen mit ASS im polizeilichen Dienst
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Leonardo da Vinci und führt in das Thema Autismus ein. Sie hebt die Andersartigkeit von Menschen mit Autismus hervor und betont, dass sie oftmals gezwungen sind, Dinge zu erlernen, die sie nicht können, während ihre Fähigkeiten und Talente oft nicht ausreichend gewürdigt werden. Die Arbeit soll einen Überblick über die Autismus-Spektrum-Störung geben, verschiedene Diagnosekriterien erläutern und die Frage beleuchten, ob Autismus eine Erkrankung oder eine besondere Ausprägung der menschlichen neurologischen Vielfalt ist. Einblicke in das Leben von Autisten und der Bezug zum polizeilichen Dienst werden als weitere Schwerpunkte genannt.
2. Die Autismus-Spektrum-Störung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Autismus-Spektrum-Störung. Es behandelt die geschichtliche Entwicklung des Begriffs, detaillierte Informationen zur Diagnose und verschiedenen Erscheinungsformen des Autismus, einschließlich frühkindlichem Autismus, atypischem Autismus, Rett-Syndrom und Asperger-Syndrom. Zusätzlich werden Aspekte wie Autismus bei Mädchen und Frauen, Diagnosekriterien im Kindes- und Erwachsenenalter, Ursachen und Risikofaktoren sowie die Häufigkeit in der Bevölkerung diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf Einblicken in das Leben Betroffener, ihre Wahrnehmung, Rituale, Kommunikation, Theory of Mind, Spezialinteressen und die Herausforderungen im Umgang mit Kontextinformationen.
3. Der Bezug zum polizeilichen Dienst: Dieses Kapitel untersucht den Umgang mit Menschen mit Autismus im polizeilichen Kontext. Es werden praktische Hinweise zur Erkennung von Autismus bei Personen gegeben und das Konfliktpotential sowie mögliche Lösungsansätze diskutiert. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, vor die sowohl Polizisten als auch Menschen mit Autismus in solchen Begegnungen gestellt werden, und sucht nach geeigneten Strategien für eine deeskalierende und erfolgreiche Interaktion. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Sensibilität und Verständnis für die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Autismus im polizeilichen Alltag.
Schlüsselwörter
Autismus-Spektrum-Störung, Diagnose, Erscheinungsformen, Autismus bei Frauen und Mädchen, Polizisten, Konfliktmanagement, Empathie, Wahrnehmung, Kommunikation, Spezialinteressen, Herausforderungen, Lösungsansätze, polizeilicher Dienst.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Autismus-Spektrum-Störung und Polizeiarbeit
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und deren Relevanz für den polizeilichen Dienst. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die ASS, ihre Diagnose, Erscheinungsformen und Herausforderungen im Alltag Betroffener. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Umgang von Polizisten mit Menschen mit ASS und der Entwicklung geeigneter Strategien für eine erfolgreiche und deeskalierende Interaktion.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die geschichtliche Entwicklung des Begriffs "Autismus-Spektrum-Störung", verschiedene Diagnosekriterien, Erscheinungsformen der ASS (inklusive Autismus bei Mädchen und Frauen), Ursachen und Risikofaktoren, die Häufigkeit von ASS in der Bevölkerung, Einblicke in das Leben Betroffener und schließlich den Umgang mit Menschen mit ASS im polizeilichen Kontext (praktische Hinweise zur Erkennung, Konfliktpotential und Lösungsansätze).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Die Autismus-Spektrum-Störung (mit Unterkapiteln zur Diagnose, Erscheinungsformen, Ursachen etc.), 3. Der Bezug zum polizeilichen Dienst und 4. Schlusswort. Jedes Kapitel bietet detaillierte Informationen zu den jeweiligen Themen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die wichtigsten Fakten zur ASS darzustellen, einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung und die grundlegenden Erscheinungsformen zu geben und verschiedene Diagnosekriterien zu erläutern. Sie untersucht, ob ASS immer mit Leidensdruck einhergeht oder auch eine besondere Ausprägung der menschlichen neurologischen Vielfalt sein kann und beleuchtet den Umgang von Polizisten mit Menschen mit ASS im Einsatz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Autismus-Spektrum-Störung, Diagnose, Erscheinungsformen, Autismus bei Frauen und Mädchen, Polizisten, Konfliktmanagement, Empathie, Wahrnehmung, Kommunikation, Spezialinteressen, Herausforderungen, Lösungsansätze, polizeilicher Dienst.
Wie wird der Bezug zum polizeilichen Dienst hergestellt?
Das Kapitel "Der Bezug zum polizeilichen Dienst" konzentriert sich auf den Umgang von Polizisten mit Menschen mit ASS. Es werden praktische Hinweise zur Erkennung von ASS gegeben, das Konfliktpotential in solchen Begegnungen analysiert und mögliche Lösungsansätze diskutiert, um deeskalierende und erfolgreiche Interaktionen zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Sensibilität und Verständnis für die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit ASS im polizeilichen Alltag.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die einen kurzen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels bietet.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler, Polizeibeamte, Sozialarbeiter und alle, die sich für die Autismus-Spektrum-Störung und den Umgang mit Menschen mit ASS im beruflichen Kontext interessieren.
Details
- Titel
- Die Autismus-Spektrum-Störung
- Untertitel
- Darstellung der Erscheinungsformen und ein möglicher Umgang mit Betroffenen im polizeilichen Dienst
- Hochschule
- Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen; Hagen (HSPV NRW)
- Note
- 1,0
- Autor
- Melina Vogrig (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 53
- Katalognummer
- V1187770
- ISBN (eBook)
- 9783346618658
- ISBN (Buch)
- 9783346618665
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Polizei Autismus Autismus-Spektrum-Störung Asperger Hochfunktionaler Autismus Bachelorarbeit Entwicklungsstörung Psychologie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Melina Vogrig (Autor:in), 2021, Die Autismus-Spektrum-Störung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1187770
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-