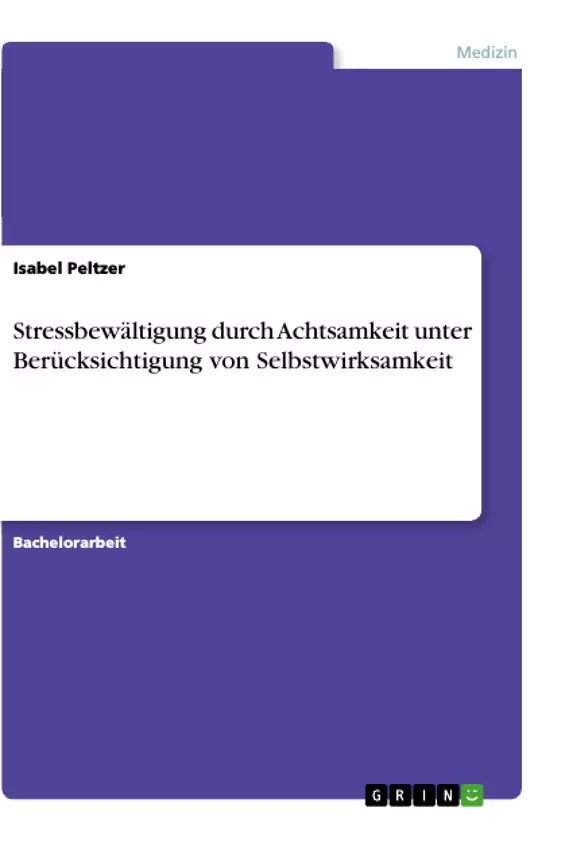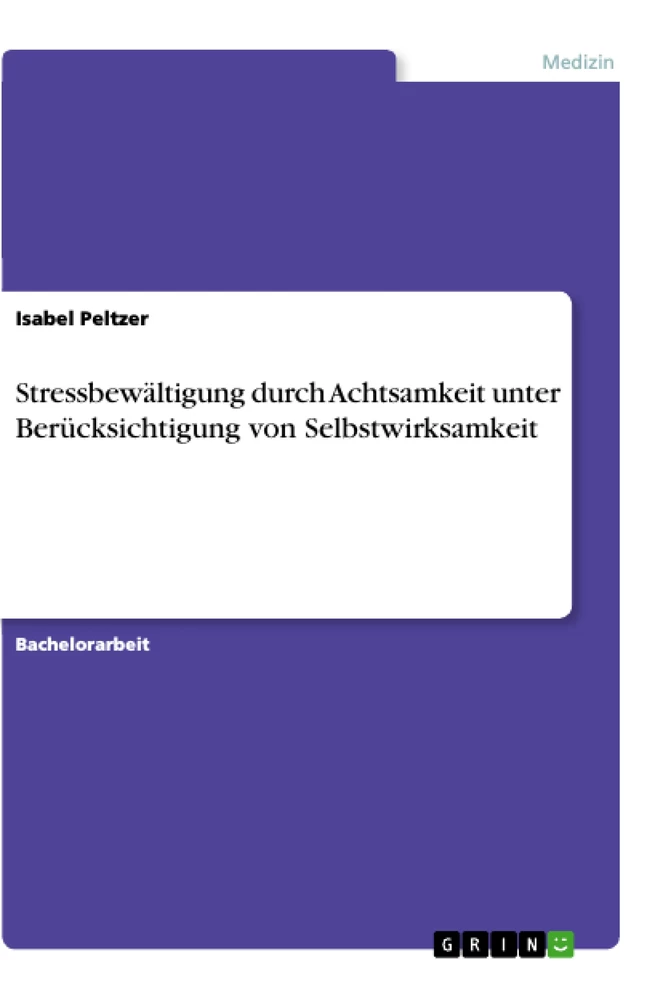
Stressbewältigung durch Achtsamkeit unter Berücksichtigung von Selbstwirksamkeit
Bachelorarbeit, 2022
108 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Stresserleben
- 2.1.1 Definition von Stress
- 2.1.2 Stresstheorien
- 2.1.3 Stresserleben von Studierenden
- 2.2 Achtsamkeit
- 2.2.1 Historie der Achtsamkeit
- 2.2.2 Definition von Achtsamkeit
- 2.3 Achtsamkeitsbasierte Verfahren
- 2.3.1 Atemraum
- 2.3.2 Body-Scan
- 2.4 Selbstwirksamkeit
- 2.4.1 Definition der Selbstwirksamkeitserwartung
- 2.5 Aktueller Forschungsstand
- 3 Hypothesen
- 4 Methode
- 4.1 Studiendesign
- 4.2 Erhebungsinstrument
- 4.2.1 Methode zur Erfassung der Konstrukte
- 4.2.2 Gütekriterien der verwendeten Instrumente
- 4.3 Stichprobenkonstruktion
- 4.4 Durchführung
- 4.5 Statistische Auswertung
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Stichprobenbeschreibung
- 5.2 Vergleich der beiden Messzeitpunkte
- 5.3 Hypothesenprüfende Datenauswertung
- 6 Diskussion und Ausblick
- 6.1 Interpretation der Untersuchungsergebnisse
- 6.2 Reflexion der Untersuchung
- 6.3 Implikation für die weitere Forschung
- 6.4 Implikation für die Praxis
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Achtsamkeit auf das Stresserleben von Studierenden und beleuchtet die Rolle der Selbstwirksamkeitserwartung in diesem Zusammenhang. Die Studie zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit, Selbstwirksamkeit und Stresserleben bei Studierenden zu analysieren.
- Stresserleben von Studierenden
- Achtsamkeit und ihre Rolle bei der Stressbewältigung
- Selbstwirksamkeitserwartung als Einflussfaktor auf Achtsamkeit und Stresserleben
- Empirische Analyse des Zusammenhanges zwischen den drei Konstrukten
- Implikationen für die Praxis und die weitere Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Forschungsstand zum Thema Stresserleben von Studierenden beleuchtet und die Relevanz von Achtsamkeitsinterventionen im Kontext von Stressbewältigung hervorhebt. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund und definiert die Kernbegriffe Stresserleben, Achtsamkeit und Selbstwirksamkeit. Es werden verschiedene Stresstheorien vorgestellt und die Bedeutung der Achtsamkeit und Selbstwirksamkeit im Umgang mit Stress erörtert. Darüber hinaus werden achtsamkeitsbasierte Verfahren wie Atemraum und Body-Scan beschrieben.
Kapitel 3 stellt die Hypothesen der Studie vor, die den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit, Selbstwirksamkeit und Stresserleben untersuchen. Die Methode der Studie wird in Kapitel 4 erläutert. Hier werden das Studiendesign, die Erhebungsinstrumente, die Stichprobenkonstruktion und die statistische Auswertung detailliert dargestellt. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Die Stichprobenbeschreibung, der Vergleich der beiden Messzeitpunkte und die hypothesenprüfende Datenauswertung werden in diesem Kapitel vorgestellt.
Die Diskussion und der Ausblick in Kapitel 6 befassen sich mit der Interpretation der Untersuchungsergebnisse, der Reflexion der Studie und den Implikationen für die weitere Forschung und die Praxis. Schließlich fasst das Fazit die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Schlüsselwörter Stresserleben, Achtsamkeit, Selbstwirksamkeitserwartung, Studierende, Bewältigungsstrategie, quantitative Datenerhebung, Längsschnittstudie. Diese Begriffe sind eng miteinander verbunden und bilden den Kern der Forschung.
Details
- Titel
- Stressbewältigung durch Achtsamkeit unter Berücksichtigung von Selbstwirksamkeit
- Hochschule
- Hochschule Fresenius Düsseldorf
- Note
- 1,7
- Autor
- Isabel Peltzer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 108
- Katalognummer
- V1188497
- ISBN (Buch)
- 9783346623447
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- stressbewältigung achtsamkeit berücksichtigung selbstwirksamkeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 55,99
- Arbeit zitieren
- Isabel Peltzer (Autor:in), 2022, Stressbewältigung durch Achtsamkeit unter Berücksichtigung von Selbstwirksamkeit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1188497
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-