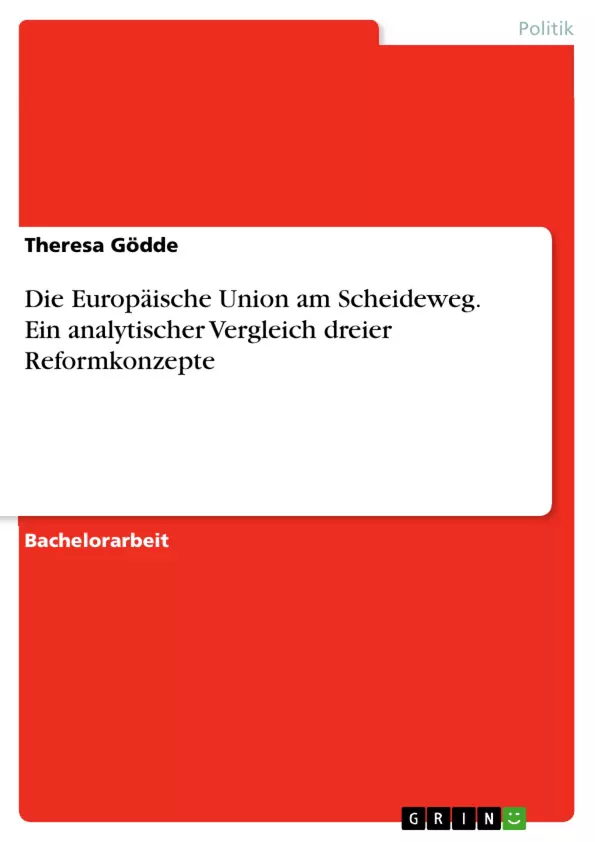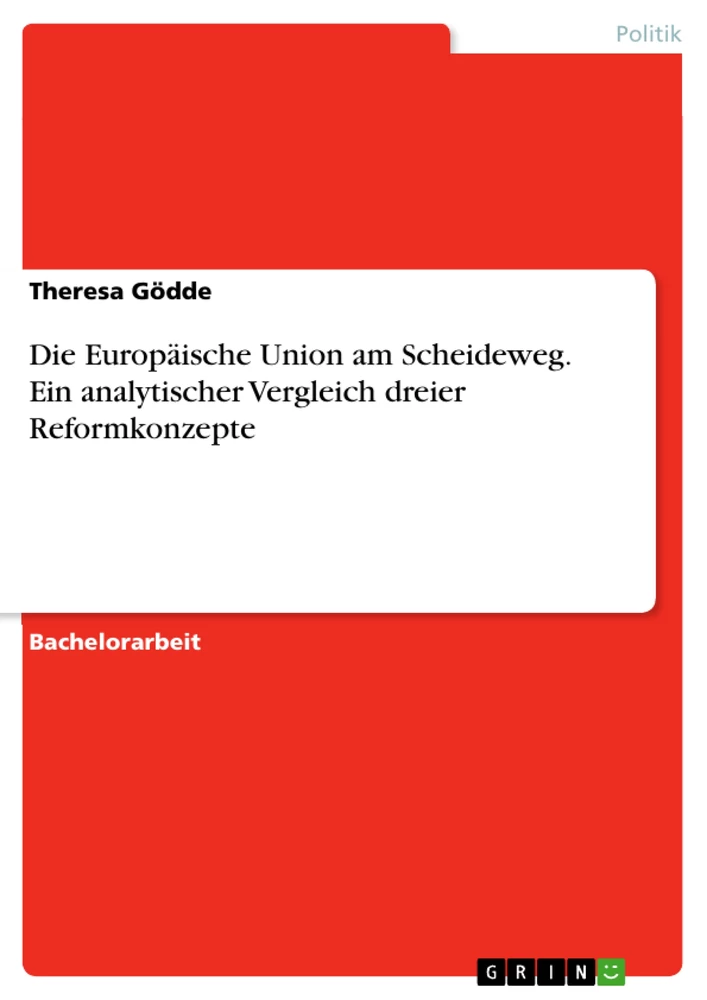
Die Europäische Union am Scheideweg. Ein analytischer Vergleich dreier Reformkonzepte
Bachelorarbeit, 2020
37 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Die Reformdebatte über die Zukunft der Europäischen Union
- Darstellung der Auswirkungen der Krisen auf den Status quo der Europäischen Union
- Vorstellung der Reformkonzepte verschiedener Akteure für die zukünftige europäische Integration
- Die Europäische Kommission: „Weißbuch zur Zukunft Europas“
- Die deutsch-französische Perspektive mit Fokus auf der Erklärung von Meseberg
- Die Union Europäischer Föderalisten: “A united Europe now more than ever”
- Analytischer Vergleich der ausgewählten Reformkonzepte
- Art der Reformvorschläge und Zielsetzung der Gesamtkonzepte
- Verhältnis der Reformvorschläge zu den krisenverursachten Mängeln
- Fazit: Reparatur oder Neugründung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Reformkonzepte für die Zukunft der europäischen Integration im Kontext der aktuellen Krisen. Sie untersucht, welche Reformvorschläge von der Europäischen Kommission, Deutschland und Frankreich sowie den Union Europäischer Föderalisten erarbeitet wurden und welche Zielsetzungen diese verfolgen. Der Fokus liegt auf drei zentralen Politikbereichen: Wirtschaft und Währung, Asyl und Migration sowie Sicherheit und Verteidigung. Ziel ist es, die Reformvorschläge hinsichtlich ihrer Eignung zur Bewältigung der krisenbedingten Schwächen der EU zu bewerten und zu beurteilen, ob eine Reparatur oder eine Neugründung der Union notwendig ist.
- Die Reformdebatte über die Zukunft der EU im Kontext von Krisen
- Analyse von Reformkonzepten verschiedener Akteure
- Vergleich der Reformvorschläge in den Bereichen Wirtschaft und Währung, Asyl und Migration sowie Sicherheit und Verteidigung
- Bewertung der Reformvorschläge hinsichtlich ihrer Eignung zur Bewältigung von Krisen
- Diskussion der Notwendigkeit einer Reparatur oder Neugründung der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 eröffnet die Arbeit mit einer Einleitung in die Reformdebatte über die Zukunft der Europäischen Union. Es werden die wichtigsten Akteur*innen und ihre Beiträge zur Debatte vorgestellt und der wissenschaftliche Diskurs in Bezug auf die Analyse der Reformvorschläge umrissen.
Kapitel 2 analysiert die Auswirkungen der Krisen auf den Status quo der Europäischen Union. Es werden die krisenbedingten Mängel der Union dargestellt, die als Grundlage für die spätere Bewertung der Reformvorschläge dienen.
Kapitel 3 stellt die Reformkonzepte der Europäischen Kommission, Deutschlands und Frankreichs sowie der Union Europäischer Föderalisten vor. Dabei werden die jeweiligen Reformvorschläge in den Bereichen Wirtschaft und Währung, Asyl und Migration sowie Sicherheit und Verteidigung im Detail erläutert.
Kapitel 4 bietet einen analytischen Vergleich der ausgewählten Reformkonzepte. Es wird untersucht, auf welche Art und Weise die Verfasser der Konzepte beabsichtigen, die Union zu reformieren und welche Zielsetzung sie damit verfolgen. Des Weiteren werden die Reformvorschläge hinsichtlich ihrer Eignung zur Behebung der in Kapitel 2 dargestellten Mängel der EU bewertet.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Reformdebatte, Krisen, Integration, Reformkonzepte, Weißbuch, deutsch-französische Perspektive, Union Europäischer Föderalisten, Wirtschaft und Währung, Asyl und Migration, Sicherheit und Verteidigung, Reparatur, Neugründung, Mängel, Widerstandsfähigkeit.
Details
- Titel
- Die Europäische Union am Scheideweg. Ein analytischer Vergleich dreier Reformkonzepte
- Hochschule
- Universität Passau
- Note
- 1,0
- Autor
- Theresa Gödde (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 37
- Katalognummer
- V1188694
- ISBN (Buch)
- 9783346623089
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- EU-Reform Reformkonzepte Europäische Kommission Weißbuch zur Zukunft Europas Europäische Integration Zukunft Europas Europäische Union EU Erklärung von Meseberg Union Europäischer Föderalisten Wirtschaft und Währung Asyl und Migration Sicherheit und Verteidigung Politik Staatsschuldenkrise Flüchtlingskrise
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Theresa Gödde (Autor:in), 2020, Die Europäische Union am Scheideweg. Ein analytischer Vergleich dreier Reformkonzepte, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1188694
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-