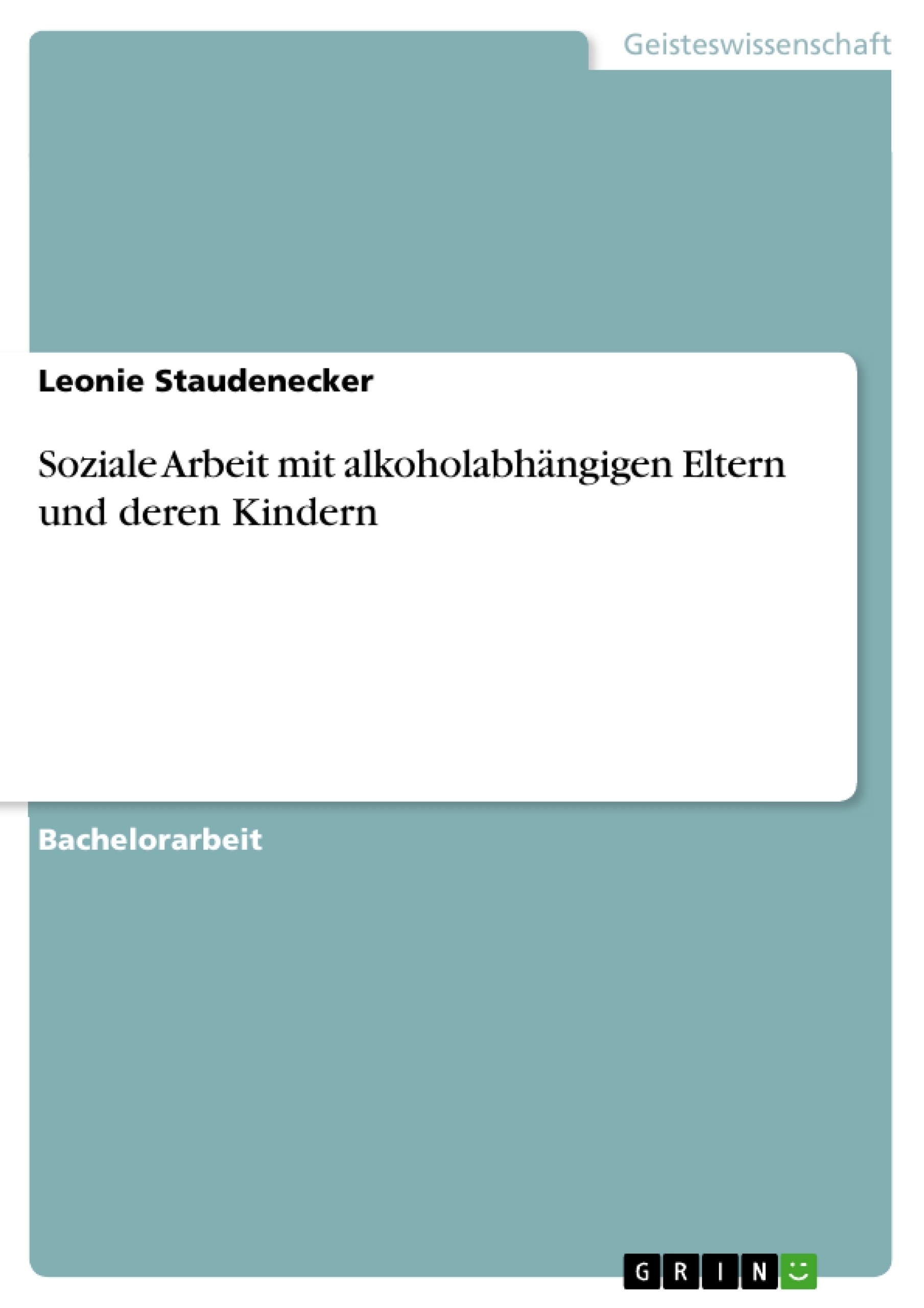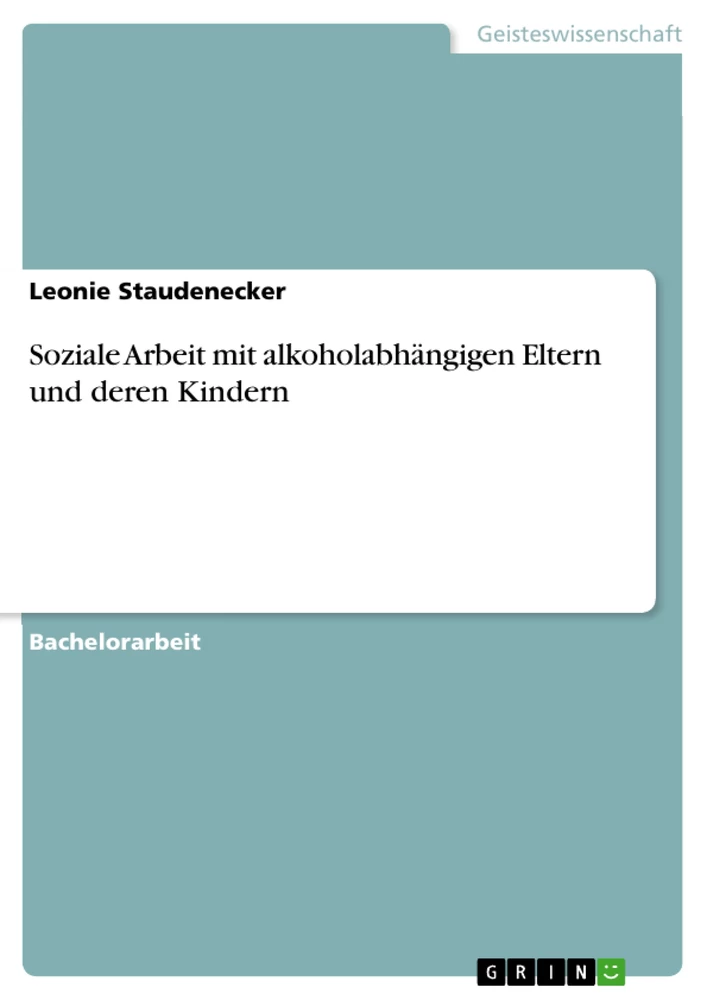
Soziale Arbeit mit alkoholabhängigen Eltern und deren Kindern
Bachelorarbeit, 2022
59 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Alkoholabhängigkeit
- 2.1 Zahlen und Fakten zur Alkoholabhängigkeit
- 2.2 Entstehung der Alkoholabhängigkeit
- 3. Auswirkungen auf die Kinder
- 3.1 Das Kindes- und Jugendalter
- 3.2 Ein Fallbeispiel
- 3.3 Die familiäre Situation
- 3.4 Die Rollen der Kinder in der Familie
- 3.5 Körperliche, psychische und soziale Folgen für die Kinder
- 3.5.1 Direkte Folgen
- 3.5.2 Indirekte Folgen
- 3.6 Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung seitens der alkoholabhängigen Eltern
- 4. Erklärung der Auswirkungen auf die Kinder und deren Verhalten
- 4.1 Risikofaktoren im Leben der Kinder
- 4.2 Die Bedeutung von Resilienz in Anbetracht der Auswirkungen auf die Kinder
- 4.3 Das bio-psycho-soziale Modell
- 4.4 Das stress-strain-coping-support Modell
- 5. Ziele innerhalb der Arbeit mit Kindern alkoholabhängiger Eltern
- 6. Hilfen der Sozialen Arbeit für Kinder aus alkoholbelasteten Familien
- 6.1 Herausforderungen in der Erreichbarkeit von Kindern und Eltern mit Alkoholbelastung
- 6.2 Prävention und Frühintervention als Handlungsmodell
- 6.2.1 Definition und Begriffserklärung
- 6.2.2 Die Wirksamkeit von Prävention und Frühintervention
- 6.2.3 Spezifische Hilfen
- 6.2.3.1 Aktuelle Situation der Hilfen für Kinder alkoholkranker Eltern in Deutschland
- 6.2.3.2 Vernetzung und Koordination der Hilfen
- 6.2.3.3 Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
- 6.3 Explizite Angebote für Kinder und Eltern
- 6.3.1 Gruppenangebote
- 6.3.1 Internetangebote
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Thematik der sozialen Arbeit mit alkoholabhängigen Eltern und deren Kindern. Die Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen von Alkoholabhängigkeit auf Kinder zu analysieren, die relevanten Hilfsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit zu beleuchten und Handlungsansätze zur Prävention und Frühintervention zu entwickeln.
- Die Folgen von Alkoholabhängigkeit für Kinder und Jugendliche
- Die Rolle der Familie und die Herausforderungen für die betroffenen Kinder
- Die Bedeutung von Resilienz und Schutzfaktoren
- Präventions- und Frühinterventionsmaßnahmen in der Sozialen Arbeit
- Aktuelle Hilfen für Kinder und Eltern aus alkoholbelasteten Familien
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Arbeit mit alkoholabhängigen Eltern und deren Kindern ein und erläutert die Relevanz des Themas.
Kapitel 2: Alkoholabhängigkeit
Dieses Kapitel beleuchtet den Aspekt der Alkoholabhängigkeit und bietet relevante Zahlen und Fakten zum Thema. Des Weiteren werden die Ursachen und Entstehungsbedingungen von Alkoholabhängigkeit beleuchtet.
Kapitel 3: Auswirkungen auf die Kinder
Dieses Kapitel widmet sich den Auswirkungen von Alkoholabhängigkeit auf Kinder. Es werden verschiedene Aspekte wie die familiäre Situation, die Rollen der Kinder in der Familie und die körperlichen, psychischen sowie sozialen Folgen für die Kinder diskutiert.
Kapitel 4: Erklärung der Auswirkungen auf die Kinder und deren Verhalten
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Erklärung der Auswirkungen von Alkoholabhängigkeit auf Kinder und deren Verhalten. Es werden Risikofaktoren im Leben der Kinder, die Bedeutung von Resilienz sowie verschiedene theoretische Modelle wie das bio-psycho-soziale Modell und das stress-strain-coping-support Modell vorgestellt.
Kapitel 5: Ziele innerhalb der Arbeit mit Kindern alkoholabhängiger Eltern
In diesem Kapitel werden die Ziele innerhalb der Arbeit mit Kindern alkoholabhängiger Eltern dargelegt. Es geht um die Unterstützung und Förderung der Kinder sowie die Prävention von möglichen Folgen der Alkoholabhängigkeit.
Kapitel 6: Hilfen der Sozialen Arbeit für Kinder aus alkoholbelasteten Familien
Dieses Kapitel präsentiert die Hilfen der Sozialen Arbeit für Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Es werden Herausforderungen in der Erreichbarkeit von Kindern und Eltern mit Alkoholbelastung betrachtet, sowie verschiedene Ansätze der Prävention und Frühintervention erläutert.
Schlüsselwörter
Alkoholabhängigkeit, Eltern, Kinder, Folgen, Auswirkungen, Familie, Resilienz, Prävention, Frühintervention, Soziale Arbeit, Hilfen, Deutschland.
Details
- Titel
- Soziale Arbeit mit alkoholabhängigen Eltern und deren Kindern
- Hochschule
- Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
- Note
- 1,7
- Autor
- Leonie Staudenecker (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V1189934
- ISBN (Buch)
- 9783346628589
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Bachelorarbeit BA Abschlussarbeit Sucht Kinder alkoholabhängiger Eltern Alkoholmissbrauch Alkoholabhängigkeit Kindeswohl Vernachlässigung Missbrauch Hilfen Onlineberatung Vernetzung Kooperation ABCX-Modell Rollen der Kinder Wegscheider Psychologie Pädagogik fetales Alkoholsyndrom Auswirkungen Gewalt Resilienz Resilienzförderung Bio-psycho-soziales Modell Mehrebenenmodell stress-strain-coping Modell Prävention Frühintervention Stressbewältigung Gruppenangebote Internetangebote
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Leonie Staudenecker (Autor:in), 2022, Soziale Arbeit mit alkoholabhängigen Eltern und deren Kindern, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1189934
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-