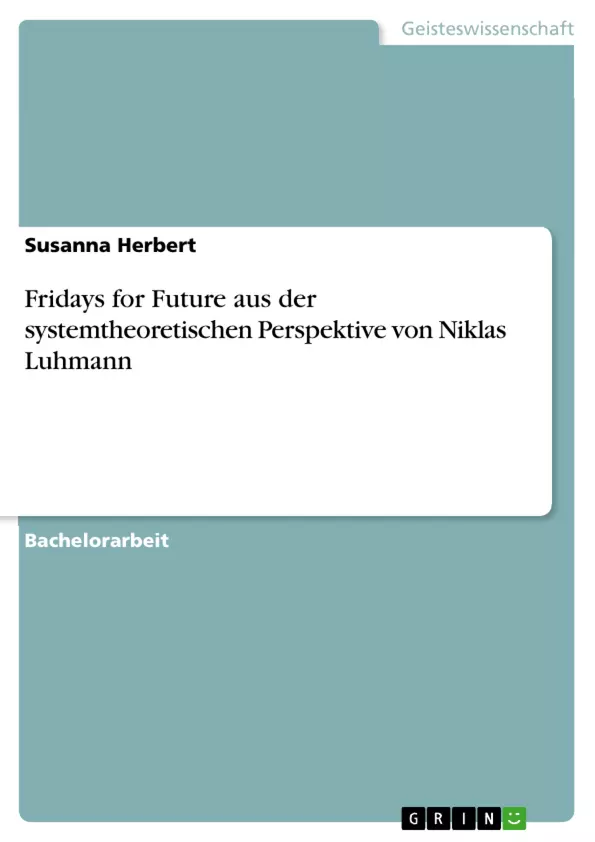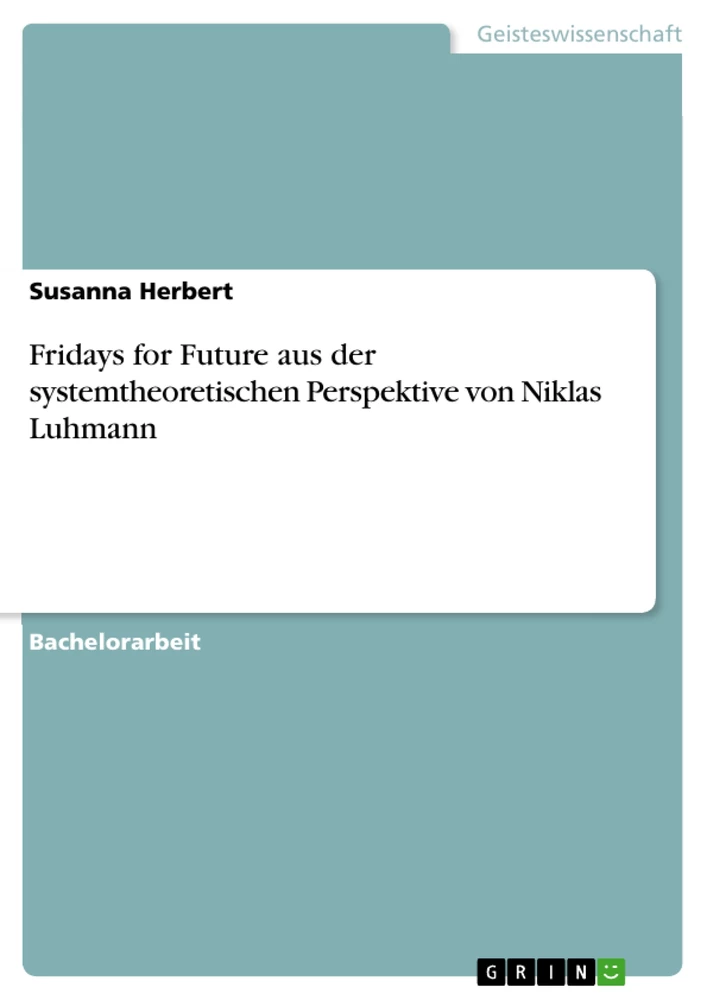
Fridays for Future aus der systemtheoretischen Perspektive von Niklas Luhmann
Bachelorarbeit, 2021
53 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz
- Forschungsstand
- Fridays for Future
- Jugend - Generation Z
- Scientists for Future
- Umweltbewusstsein
- Soziale Bewegung
- Niklas Luhmann
- Protest nach Niklas Luhmann
- Die Unterscheidung von Risiko und Gefahr
- Systemtheorie und Soziale Bewegungen
- Funktionen der neuen sozialen Bewegungen
- Motivation der sozialen Bewegungen
- Massenmedien als Umwelt von Protestbewegungen
- Umweltbewusstsein
- Diskussion: Anwendung systemtheoretische Perspektive auf FFF
- Soziale Systeme
- Politik
- Massenmedien
- Risiko/Gefahr Zuordnung
- Soziale Bewegung / neue soziale Bewegung
- Funktionen der FFF-Bewegung
- Motivation der FFF-Bewegung
- Umweltbewusstsein
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorthesis befasst sich mit der Fridays for Future (FFF) Bewegung aus systemtheoretischer Perspektive. Die Arbeit analysiert die Bewegung unter Verwendung des systemtheoretischen Ansatzes von Niklas Luhmann, um zu verstehen, wie sich ihre Aspekte anhand seiner Theorie erklären lassen.
- Die Relevanz der FFF-Bewegung im Kontext der Klimakrise
- Die Rolle der Jugend und Generation Z in der FFF-Bewegung
- Die Anwendung der Systemtheorie auf Protestbewegungen
- Die Bedeutung von Risiko und Gefahr im Kontext der Klimaproblematik
- Die Rolle der Massenmedien in der FFF-Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die FFF-Bewegung vor, beleuchtet ihre Relevanz und den Forschungsstand.
- Fridays for Future: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung, die Ziele und die Akteure der FFF-Bewegung.
- Niklas Luhmann: Hier wird die systemtheoretische Perspektive von Niklas Luhmann vorgestellt, insbesondere seine Ansichten zum Protest und zu sozialen Bewegungen.
- Diskussion: Anwendung systemtheoretische Perspektive auf FFF: Dieses Kapitel analysiert die FFF-Bewegung anhand der systemtheoretischen Perspektive von Niklas Luhmann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Fridays for Future, systemtheoretische Perspektive, Niklas Luhmann, Protestbewegungen, neue soziale Bewegungen, Umweltbewusstsein, Risiko, Gefahr, Massenmedien und Klimakrise.
Häufig gestellte Fragen
Wie erklärt die Systemtheorie die Fridays-for-Future-Bewegung?
Die Arbeit nutzt Niklas Luhmanns Perspektive, um FFF als Protestbewegung zu analysieren, die ökologische Kommunikation in die Funktionssysteme wie Politik und Massenmedien einbringt.
Was ist der Unterschied zwischen Risiko und Gefahr bei Luhmann?
Risiko bezieht sich auf Schäden, die als Folge eigener Entscheidungen gesehen werden, während Gefahr Schäden bezeichnet, die der Umwelt zugeschrieben werden und auf die man keinen direkten Einfluss zu haben glaubt.
Welche Rolle spielen Massenmedien für FFF?
Massenmedien fungieren als "Umwelt" der Protestbewegung; sie entscheiden darüber, welche Themen der Bewegung öffentliche Aufmerksamkeit erhalten und wie sie gerahmt werden.
Warum ist FFF laut Luhmann eine "neue" soziale Bewegung?
Weil sie nicht mehr primär zwischen Gesellschaftsklassen ausgetragen wird, sondern eine übergeordnete Dimension (das Überleben der Biosphäre) erreicht, die alle Systeme betrifft.
Was bedeutet "Ökologische Kommunikation" in diesem Kontext?
Es beschreibt die Art und Weise, wie die Gesellschaft auf ökologische Gefährdungen reagiert und ob bzw. wie diese Informationen in den spezialisierten Teilsystemen (Recht, Wirtschaft, Politik) verarbeitet werden.
Details
- Titel
- Fridays for Future aus der systemtheoretischen Perspektive von Niklas Luhmann
- Hochschule
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
- Note
- 2,3
- Autor
- Susanna Herbert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 53
- Katalognummer
- V1190602
- ISBN (Buch)
- 9783346633491
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Luhmann Systemtheorie Fridays for Future Soziologie Protest
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Susanna Herbert (Autor:in), 2021, Fridays for Future aus der systemtheoretischen Perspektive von Niklas Luhmann, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1190602
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-